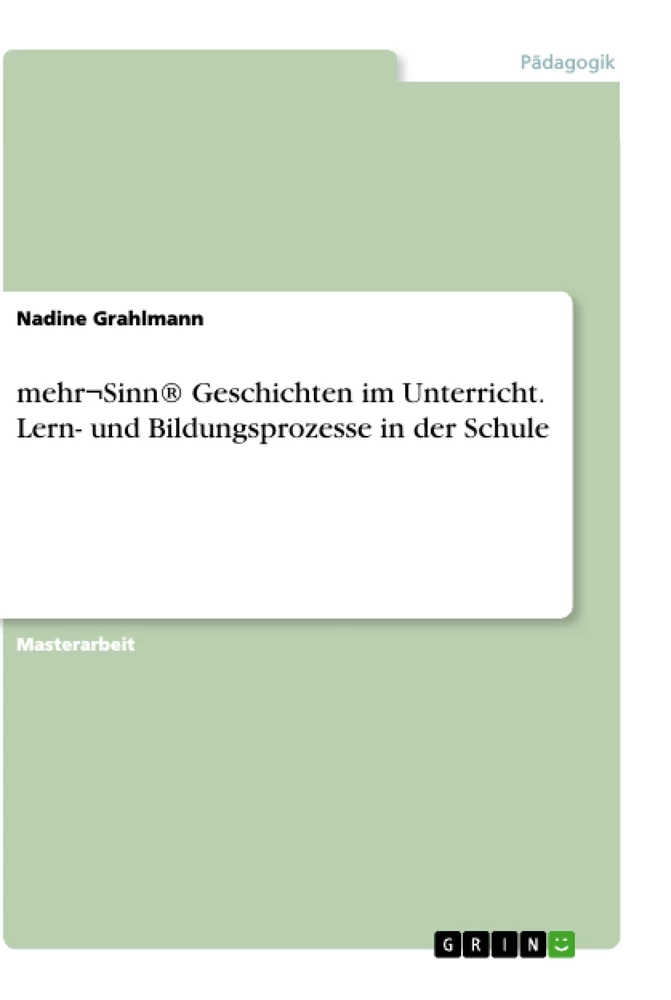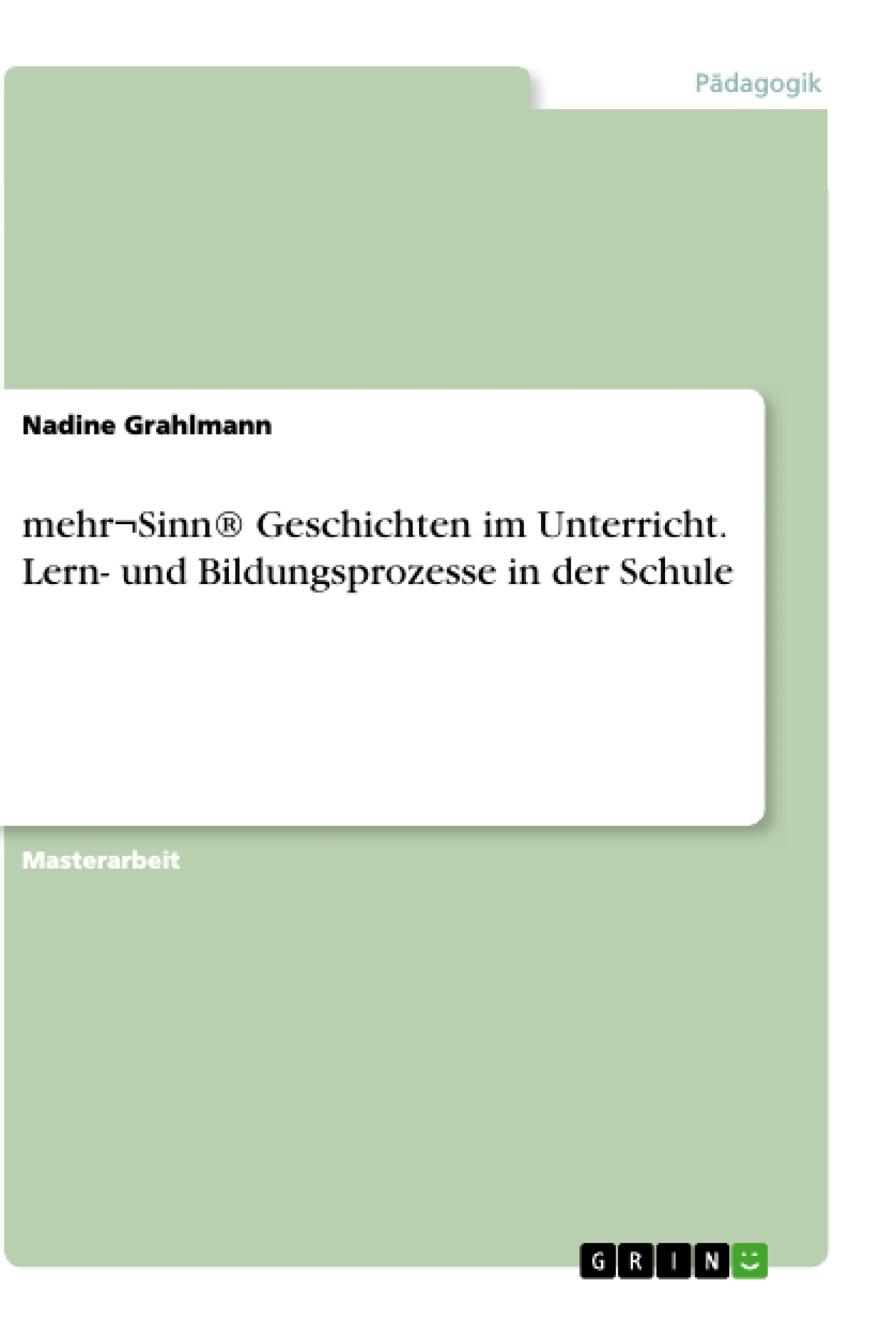In dieser Arbeit wird das Konzept der mehr¬Sinn Geschichten vorgestellt. Dabei soll vor allem geklärt werden, was mehr¬Sinn Geschichten überhaupt sind und wie sie konkret erzählt werden. Daran anschließend soll der Blick auf die Lern- und Bildungsprozesse im Schulkontext gerichtet werden. Dafür werden vielseitige Unterrichtsprinzipien präsentiert und auf den Einsatz in verschiedenen Schulformen bezogen.
Aus den zusammengetragenen theoretischen Inhalten wird im darauffolgenden Kapitel ein Kriterienkatalog entwickelt, welcher für die Bewertung von mehr sinnlichen Geschichten im Unterricht herangezogen werden kann. Im sechsten Kapitel wird die Entwicklung der Konzeption der mehr sinnlichen Geschichte zum Bilderbuch "Das kleine Wir in der Schule" von Daniela Kunkel beschrieben und das Ergebnis anhand der benötigten Materialien und Requisiten sowie der zu-gehörigen Regieanleitung dargestellt. Mithilfe des aufgestellten Kriterienkatalogs und der Entwicklung der mehr sinnlichen Geschichte im vorangegangenen Kapitel wird anschließend eine Auswertung des praxiserprobten Einsatzes im Unterricht vorgenommen. Hierbei sollen vor allem mögliche Chancen aber auch Herausforderungen für die unterrichtliche Umsetzung heraus-gearbeitet werden. Zum Abschluss dieser Arbeit wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was sind mehr-Sinn Geschichten?
- 2.1 Entstehung und Entwicklung
- 2.2 Zielgruppe
- 3 Wie werden mehr-Sinn Geschichten erzählt?
- 3.1 Vorbereitung
- 3.2 Durchführung
- 4 Unterrichtsprinzipien im Schulkontext
- 4.1 Allgemeingültigkeit der Unterrichtsprinzipien für verschiedene Schulformen
- 4.2 Konstitutive Unterrichtsprinzipien
- 4.2.1 Schülerorientierung
- 4.2.2 Sachorientierung
- 4.2.3 Handlungsorientierung
- 4.3 Regulierende Unterrichtsprinzipien
- 4.3.1 Selbsttätigkeit
- 4.3.2 Differenzierung
- 4.3.3 Veranschaulichung
- 4.3.4 Motivierung
- 4.3.5 Ganzheit
- 4.3.6 Zielorientierung
- 4.3.7 Strukturierung
- 4.3.8 Ergebnissicherung
- 5 Kriterienkatalog für die Bewertung von mehrsinnlichen Geschichten im Unterricht
- 6 Entwicklung der mehrsinnlichen Geschichte Das kleine WIR in der Schule von Daniela Kunkel
- 6.1 Benötigte Materialien und Requisiten
- 6.2 Regieanleitung
- 7 Auswertung der Umsetzung der selbstentwickelten mehrsinnlichen Geschichte im Unterricht
- 7.1 Chancen
- 7.2 Herausforderungen
- 8 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit des Konzepts der „mehr-Sinn Geschichten“ im allgemeinen Schulkontext. Ziel ist es, herauszufinden, ob diese Methode, ursprünglich für Einzelpersonen mit komplexen Beeinträchtigungen entwickelt, auch für den Unterricht mit mehreren Schülern und unabhängig von individuellen Beeinträchtigungen geeignet ist. Die Forschungsfrage lautet: Inwieweit lässt sich das Konzept der mehr-Sinn Geschichten im Unterricht umsetzen?
- Definition und Entstehung von mehr-Sinn Geschichten
- Anpassung des Konzepts für den Unterricht
- Relevanz von Unterrichtsprinzipien für die Umsetzung
- Entwicklung und Auswertung einer mehrsinnlichen Geschichte im Unterricht
- Chancen und Herausforderungen der Methode im Schulkontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Forschungsfragen vor: Wie können Geschichten zum Verständnis der Welt beitragen? Wie können Geschichten über die Sprache hinaus vermittelt werden? Und eignet sich der Einsatz von Geschichten zur Wissensvermittlung im Unterricht? Besonders wird die Bedeutung von mehr-Sinn Geschichten für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen hervorgehoben, wobei der Fokus auf kultureller Teilhabe und Bildung ohne Grenzen liegt. Die Arbeit untersucht, ob dieses Konzept auch im regulären Schulunterricht umsetzbar ist.
2 Was sind mehr-Sinn Geschichten?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „mehr-Sinn Geschichten“ und beleuchtet deren Entstehung und Entwicklung. Es beschreibt die Zielgruppe, also Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, für die diese Erzählmethode ursprünglich konzipiert wurde. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung sinnlicher Wahrnehmung und die Erweiterung der Möglichkeiten der inhaltlichen Erfassung für die Zuhörer durch den Einsatz verschiedener Sinne (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten).
3 Wie werden mehr-Sinn Geschichten erzählt?: Hier werden die Vorbereitung und Durchführung von mehr-Sinn Geschichten detailliert beschrieben. Es geht um die praktische Umsetzung des Konzepts, die Auswahl und den Einsatz von Materialien und Methoden, um die Geschichte für die Zielgruppe erlebbar zu machen. Der Fokus liegt auf der sinnlichen Erfahrung und der Interaktion mit den Erzählmaterialien.
4 Unterrichtsprinzipien im Schulkontext: Dieses Kapitel befasst sich mit den relevanten Unterrichtsprinzipien, die für eine erfolgreiche Umsetzung von mehr-Sinn Geschichten im Unterricht unerlässlich sind. Es unterscheidet zwischen konstitutiven (Schülerorientierung, Sachorientierung, Handlungsorientierung) und regulierenden Prinzipien (Selbsttätigkeit, Differenzierung, Veranschaulichung, Motivierung, Ganzheit, Zielorientierung, Strukturierung, Ergebnissicherung). Die Anwendung dieser Prinzipien im Kontext mehr-Sinn Geschichten wird erläutert.
5 Kriterienkatalog für die Bewertung von mehrsinnlichen Geschichten im Unterricht: Dieses Kapitel präsentiert einen Kriterienkatalog, der zur Bewertung der Wirksamkeit und Qualität der mehrsinnlichen Geschichten im Unterricht dient. Es liefert konkrete Messgrößen und Beurteilungskriterien, um die Effektivität der Methode zu evaluieren.
6 Entwicklung der mehrsinnlichen Geschichte Das kleine WIR in der Schule von Daniela Kunkel: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Entwicklung einer mehrsinnlichen Geschichte basierend auf dem Bilderbuch "Das kleine WIR". Es werden die benötigten Materialien und Requisiten sowie die Regieanweisungen detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung des Konzepts in einem konkreten Beispiel.
Schlüsselwörter
Mehr-Sinn Geschichten, inklusive Bildung, Unterrichtsmethoden, Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, sinnliche Wahrnehmung, kulturelle Teilhabe, Unterrichtsprinzipien, inklusive Pädagogik, Geschichte erzählen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Mehr-Sinn Geschichten im Unterricht"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit des Konzepts „Mehr-Sinn Geschichten“ im regulären Schulunterricht. Sie prüft, ob diese Methode, ursprünglich für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen entwickelt, auch für den Unterricht mit mehreren Schülern ohne spezifische Beeinträchtigungen geeignet ist.
Was sind „Mehr-Sinn Geschichten“?
„Mehr-Sinn Geschichten“ sind Geschichten, die über den auditiven Kanal (Hören) hinausgehen und verschiedene Sinne (Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten) einbeziehen, um ein umfassenderes und intensiveres Erlebnis zu schaffen. Sie wurden ursprünglich für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen entwickelt, um deren Teilhabe und Bildung zu fördern.
Für wen ist die Methode ursprünglich entwickelt worden?
Die Methode der „Mehr-Sinn Geschichten“ wurde ursprünglich für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen konzipiert, um ihnen den Zugang zu Geschichten und Bildung zu ermöglichen, trotz ihrer individuellen Einschränkungen.
Wie werden „Mehr-Sinn Geschichten“ erzählt?
Das Erzählen von „Mehr-Sinn Geschichten“ beinhaltet eine sorgfältige Vorbereitung, die Auswahl geeigneter Materialien und eine durchdachte Durchführung. Es geht darum, die Geschichte durch den Einsatz verschiedener Sinne erlebbar zu machen und die Zuhörer aktiv einzubeziehen.
Welche Unterrichtsprinzipien sind relevant?
Die Arbeit identifiziert konstitutive Unterrichtsprinzipien (Schülerorientierung, Sachorientierung, Handlungsorientierung) und regulierende Prinzipien (Selbsttätigkeit, Differenzierung, Veranschaulichung, Motivierung, Ganzheit, Zielorientierung, Strukturierung, Ergebnissicherung) als wichtig für die erfolgreiche Umsetzung von „Mehr-Sinn Geschichten“ im Unterricht.
Wie wird die Wirksamkeit der Methode bewertet?
Die Arbeit entwickelt einen Kriterienkatalog zur Bewertung der Wirksamkeit und Qualität von „Mehr-Sinn Geschichten“ im Unterricht. Dieser liefert konkrete Messgrößen und Beurteilungskriterien zur Evaluierung der Methode.
Gibt es ein praktisches Beispiel?
Ja, die Arbeit beschreibt die Entwicklung einer konkreten „Mehr-Sinn Geschichte“ basierend auf dem Bilderbuch „Das kleine WIR“, inklusive benötigter Materialien, Requisiten und Regieanweisungen.
Welche Chancen und Herausforderungen bietet die Methode im Schulkontext?
Die Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen der Umsetzung von „Mehr-Sinn Geschichten“ im Schulkontext. Es werden sowohl positive Aspekte als auch potentielle Schwierigkeiten bei der Implementierung beleuchtet.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit lässt sich das Konzept der Mehr-Sinn Geschichten im Unterricht umsetzen?
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mehr-Sinn Geschichten, inklusive Bildung, Unterrichtsmethoden, Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, sinnliche Wahrnehmung, kulturelle Teilhabe, Unterrichtsprinzipien, inklusive Pädagogik, Geschichte erzählen.
- Quote paper
- Nadine Grahlmann (Author), 2020, mehr¬Sinn® Geschichten im Unterricht. Lern- und Bildungsprozesse in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027111