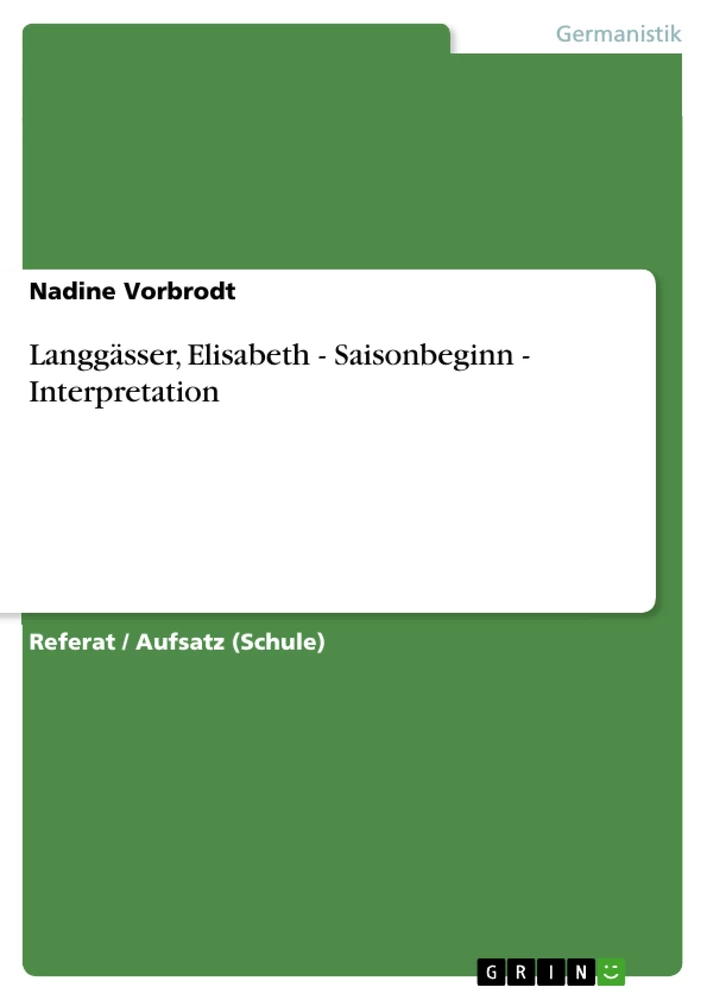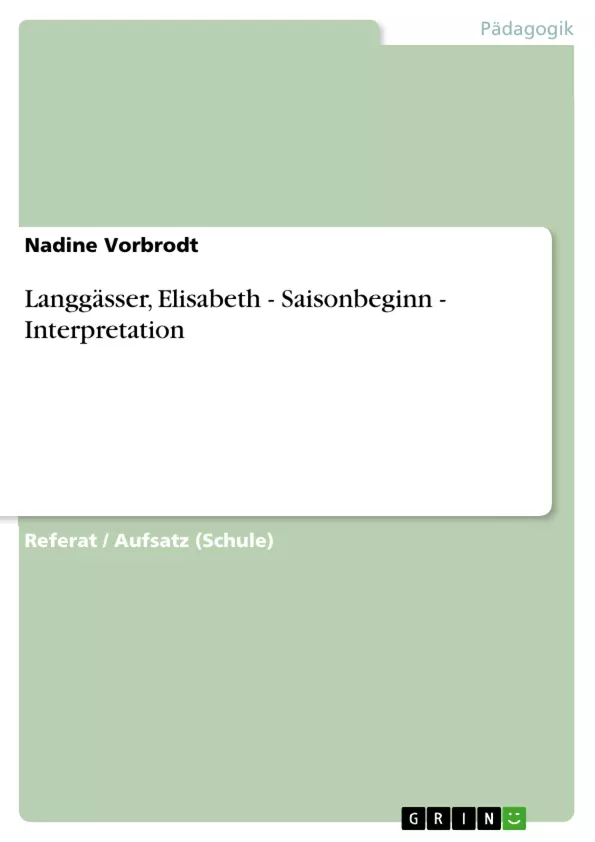Elisabeth Langgässer, die von 1899 bis 1950 lebte gilt als wohl eine der bedeutendsten der deutschen Autorinnen der Nachkriegszeit. Romane, Kurzgeschichten, wie „Saisonbeginn“, Erzählungen und Lyrik gehören zu ihrem Repertoire. Sie wurde 1950 nach ihrem Tod mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Die Kurzgeschichte „Saisonbeginn“ von Elisabeth Langgässer handelt von drei Arbeitern, die ein Schild zur Urlaubssaison anbringen sollen.
Am Eingang einer Ortschaft, hoch in den Bergen machen sich drei Arbeiter mit dem Schild, Pfosten und Schaufel auf die Suche nach einer geeigneten Stelle um den Pfosten aufzustellen. Dabei treffen sie auf einige Schwierigkeiten, zum Beispiel auf einen Pflasterbelag, eine Stelle war wiederum zu weit vom Ortseingang entfernt und eine andere Stelle wurde von einer Buche durch ihre Äste überragt. Die geeignete Stelle fanden sie gegenüber dem Holzkreuz mit dem gekreuzigten Jesus. Als die Männer den Pfosten mit dem Schild eingraben, kommen einige Bewohner des Dorfes vorbei und geben ihre Meinungen durch verschiedene Gesten, wie zum Beispiel lachen, Kopf schütteln oder Gleichgültigkeit kund. Das Haupt des sterbenden Jesus neigt nach rechts, wo ihm dauerhaft das Schild mit der Inschrift „In diesem Kurort sind Juden unerwünscht“ gegenüber steht.
Bei diesem Text handelt es sich um eine Kurzgeschichte. Der geringe Umfang, der unvermittelte Beginn ohne Einleitung „Die Arbeiter kamen mit ihrem Schild und einem hölzernen Pfosten, auf den es genagelt werden sollte, „zu dem Eingang einer Ortschaft, ...“ (Zeile 1/2) und der offene Schluss, der noch Fragen offen lässt, z.B. was die Urlauber von diesem Schild halten werden oder ob jemand etwas wegen dem Schild sagen wird, deuten darauf hin. Auch die Thematik ist typisch für eine Kurzgeschichte. Der Text behandelt nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben der Dorfbewohner nämlich die Suche nach einer geeigneten Stelle für das Kreuz.
Wendet man sich dem äußeren Aufbau zu, so fällt auf, dass die Geschichte in mehrere Absätze gegliedert ist, die die Arbeit der drei Männer hervorheben. E. Langgässer verwendet keine wörtliche Rede.
Was den inneren Aufbau anbelangt, so könnte man die einzelnen Sinnabschnitte folgendermaßen zusammenfassen: Der 1. Teil beinhaltet die Beschreibung der Natur. Im 2. Teil geht es um die Suche der Arbeiter nach einem geeigneten Platz für ihr Schild. Der 3. Teil handelt von der Reaktionen der Dorfbewohner. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Autorin zielstrebig auf einen Schluss zusteuert.