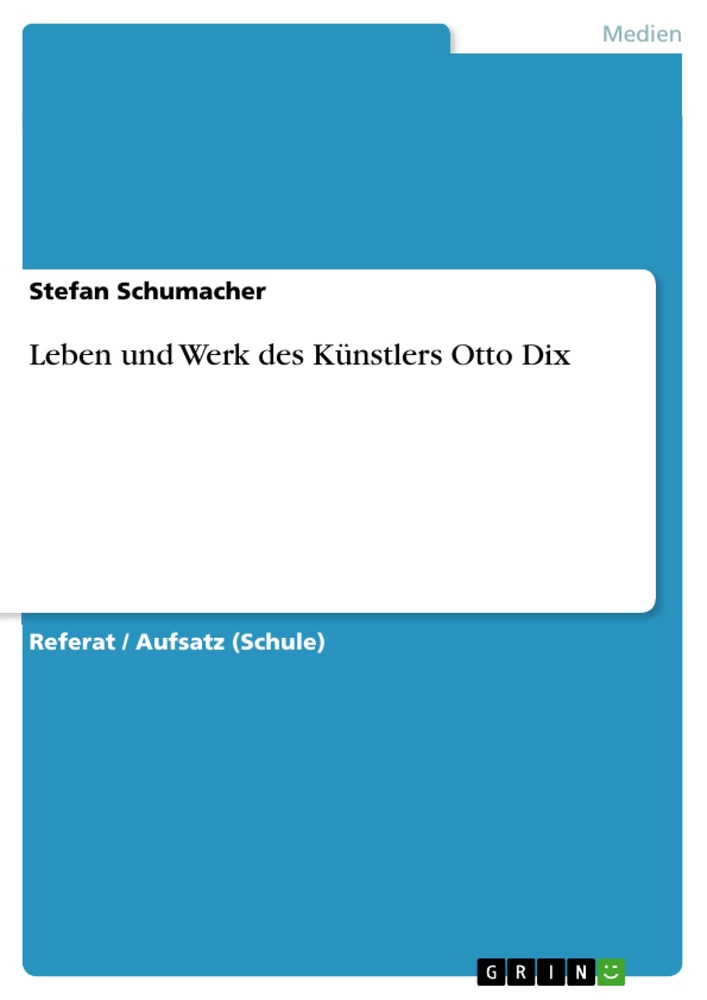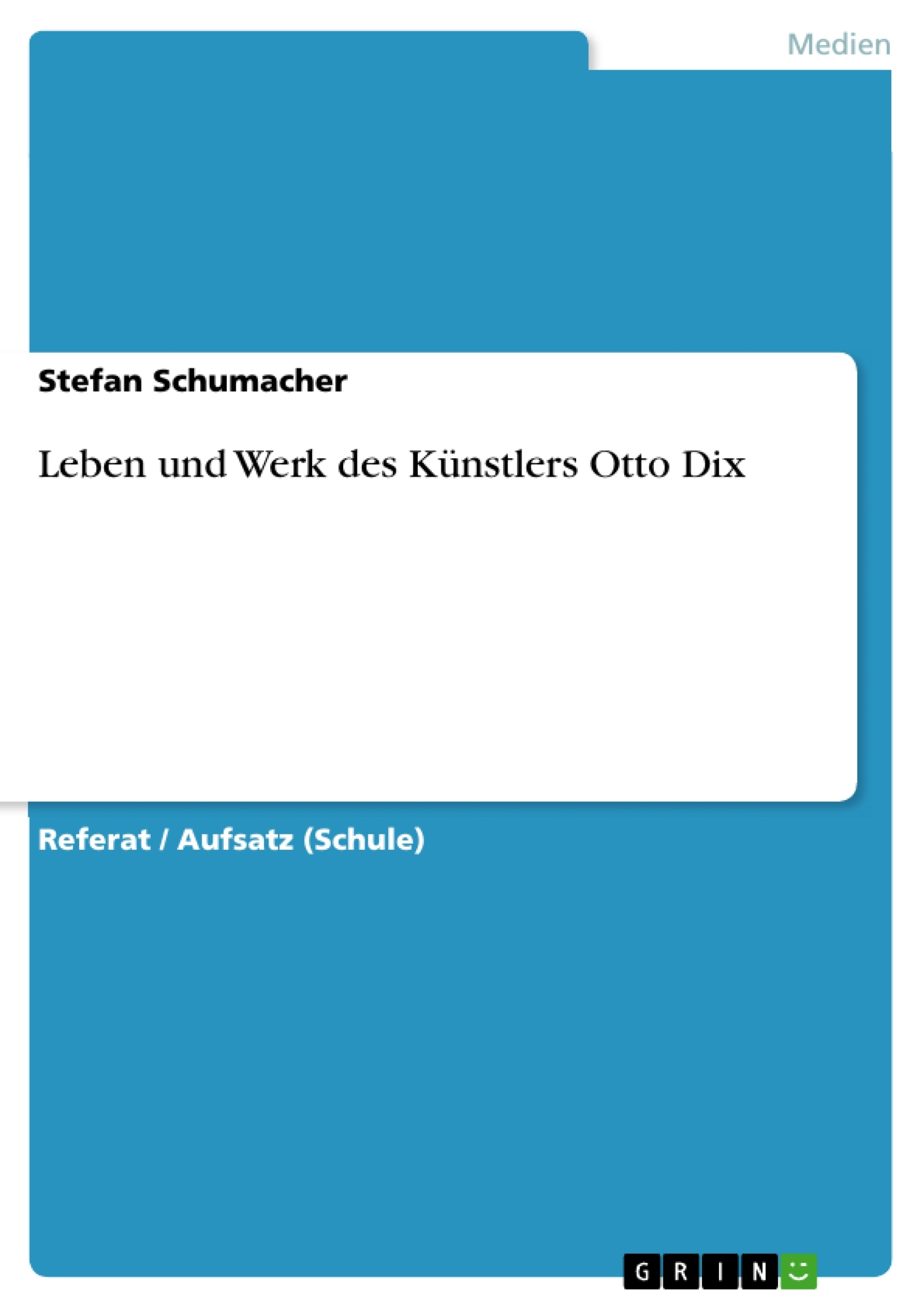Entdecken Sie die schonungslose und faszinierende Welt des Otto Dix, einem Künstler, der sich den gängigen Kategorien des Expressionismus entzog und mit seiner Neuen Sachlichkeit eine Epoche prägte. Diese umfassende Monographie beleuchtet Dix' Weg von den frühen expressionistischen Experimenten über eine kurze dadaistische Phase bis hin zum unverwechselbaren, altmeisterlichen Stil, der sein Werk dominierte. Tauchen Sie ein in seine schonungslosen Darstellungen des Krieges, des Leids und der Verzweiflung, die ihn von politischen Agitatoren wie Grosz unterschieden und ihn als Chronisten seiner Zeit etablierten. Erfahren Sie, wie prägende Einflüsse wie van Gogh und die Futuristen seine Kunst formten, von dynamischen Farbaufträgen bis hin zu kubistischen Formensplitterungen. Verfolgen Sie Dix' Entwicklung vom Freiwilligen im Ersten Weltkrieg zum unerbittlichen Beobachter der Schützengräben, dessen Skizzen und Gemälde die Schrecken des Krieges in archetypischen Szenen festhielten. Analysieren Sie seine Collagetechnik und die Verwendung von Realitätsfragmenten, die seinen Darstellungen von Kriegsopfern eine verstörende Authentizität verliehen. Dieses Buch enthüllt die Kontroversen um Dix' Werk, die ihn sowohl für seine politische Wirkung als auch für seine vermeintliche "Faszination des Schreckens" kritisierten. Von den frühen Radierungen bis zu den monumentalen Triptychen wie "Der Krieg" zeichnet diese Publikation ein umfassendes Bild eines Künstlers, der sich seiner Chronistenpflicht verschrieben hatte und dessen Werke bis heute nichts von ihrer verstörenden Kraft verloren haben. Erleben Sie die Kunst eines Chronisten, der mit schonungsloser Ehrlichkeit die Realität seiner Zeit festhielt, ein unverzichtbares Werk für Kunstliebhaber und Historiker gleichermaßen, das die deutsche Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts in einem neuen Licht erscheinen lässt.
Otto Dix
Auch der 1891 in Gera geborene Otto Dix lässt sich in das Charakterbild expressionistischer Malerei nur schwer einordnen. Zu ihren herausragenden Vertretern, der „Brücke“ in Dresden, dem „Blauen Reiter“ in München oder Macke in Bonn, hatte er keinerlei Kontakte. Zwar sah er in Dresden die Werke der „Brücke“-Künstler, doch haben diese ihn nicht sonderlich beeindruckt und schon gar nicht seine eigene Malerei künstlerisch beeinflusst. Die expressionistische Formensprache blieb in seiner Entwicklung auf das Frühwerk bis 1915 beschränkt. Danach gab es in seinem Werk eine kurzfristige dadaistische Phase, bevor er sich er sich einem veristischen, altmeisterlichen Stil verschrieb, der sein gesamtes Werk seitdem bestimmte und Dix zu einem Hauptvertreter der Neuen Sachlichkeit machte. Vor allem in seinen Bildsujets steht Dix den Expressionisten fern und ist wohl nur mit Grosz vergleichbar. Doch auch ihre Kunst unterscheidet sich in der Ikonographie wesentlich voneinander.
Grosz verstand sich als einen politisch handelnden Menschen und seine Malerei als ein Medium der politischen Agitation. Wenn er sein Augenmerk auf die Opfer dieser Gesellschaft richtet, so zeigt er immer auch die Täter, die Militärs, die Großindustrie, die Vertreter der nationalistischen Parteien und Presse. Grosz’ Bilder sind politische Anklagen. Dix dagegen zeigt uns die Opfer, ihr Leid und ihre Verzweiflung. Sein künstlerischer Anspruch ist ein humanistischer, von der Tagespolitik hielt er sich fern: „Nein, Künstler sollen nicht bessern oder bekehren. Sie sind viel zu gering. Nur bezeugen müssen sie.“ Dix sah sein gesamtes künstlerisches Werk als ein solches Zeugnis und sich selbst- und darin mit Beckmann vergleichbar -in der Rolle des Chronisten, der teilhat an den Ereignissen und seine Erfahrungen mitteilt. Doch eine solche Haltung ließ sich nie praktisch umsetzen. Abgesehen von allen anderen in seine Kunst einfließenden Momenten war bereits seine Motivauswahl nie eine wertfreie Entscheidung, sondern immer auch eine politische Stellungnahme.
Dix entwickelte schon früh ein zeichnerisches Talent, das seine Lehrer förderten. Trotzdem folgte er dem Rat seines Vaters und ging als 14jähriger bei einem Dekorationsmaler in die Lehre. 1909 wechselte er auf die Kunstgewerbeschule nach Dresden. Die Kameradschaft mit Meidner führte ihn zu eigenen expressionistischen Formenexperimenten. Doch erst zwei andere Vorbilder während dieser Zeit brachten seinem Werk die entscheidenden künstlerischen Impulse. 1912 sah er in der Dresdener Galerie Arnold eine Ausstellung mit Arbeiten van Goghs. Im Sommer des folgenden Jahres reiste er nach Italien und begegnete dort den Werken der Futuristen. Einflüsse von van Gogh dynamisierten Farbauftrag, vor allem aber die für den Futurismus typischen kubischen Formensplitterungen finden sich in der Folge auch im Werk von Dix wieder. Dabei bestimmt bis zum Ende des Dezenniums noch das Bildsujet die formale Gestaltung. So entstehen in dieser Zeit, ohne dass darin eine homogene Werkentwicklung erkennbar wäre, neben den expressionistisch und futuristisch geprägten Bildern Motive mit kubistischen Formenelementen („Krieger mit Pfeife“, 1918) oder Bilder in einem naiven Realismus („Selbstbildnis als Schießscheibe“, 1915). Und bereits 1912 malte Dix ein Selbstbildnis in jenem altmeisterlichen Verismus, der erst ein Jahrzehntspäter für seine Kunst charakteristisch werden sollte.
1914 zog auch Dix als Freiwilliger in den Krieg, den er bis zum bitteren Ende als Frontsoldat miterlebte. Zwar gibt es von ihm Äußerungen, in denen er den Krieg als ein „Naturereignis“ schildert, das gewissermaßen unverschuldet und unbeeinflussbar über die Menschheit hereinbricht, doch verklärte er- anders als viele unter den Expressionisten und vor allem den italienischen Futuristen -den Krieg nie zu dem großartigen, die alte Gesellschaft reinigenden und erneuernden Akt. Dix sah sich eher in der Position des Reporters, der die Pflicht habe, bei einem solchen Ereignis nicht abseits zu stehen, sondern teilzunehmen und zu berichten. „Ich habe den Krieg genau studiert. Man muss ihn realistisch darstellen, damit er auch verstanden wird. Der Künstler will arbeiten, damit die anderen sehen, wie so etwas gewesen ist... Ich habe die wahrhaftige Reportage des Krieges gewählt“, erläuterte er Jahre später seine damalige künstlerische Position. Konsequent entstehen Hunderte kleiner Skizzen, Zeichnungen und Gouachen, von denen er einige auch in Ölmalereien umsetzt. Dabei bleibt Dix jedoch- gerade anders als der Reporter -nicht der einzelnen, individuellen Szene verhaftet, sondern sucht in den Schützengräben und Figurendarstellungen immer das Allgemeine, die archetypische Situation.
Belegen Malduktus und Farbgebung bei einigen Werken gerade Dix’ künstlerische Verarbeitung der expressionistischen Formensprache, so wird für andere Gemälde vor allem der Futurismus wichtig. Der nach dem Vorbild der Italiener in kubische Formen und Kraftlinien aufgebrochene einheitliche Bildraum bot das ideale formale Äquivalent zu den Motiven laut detonierender Granaten, zerrissener Soldatenleiber und der von Bombentrichtern aufgewühlten, zerstörten Landschaft. Diese Arbeiten, als Zeichnungen und Gouachen vor Ort und unter dem unmittelbaren Eindruck des Gesehenen entstandenen, beziehen die Betrachter- ganz anders als dies später geschieht -in die dargestellte Szene mit ein. Die nach dem Krieg aus der Erinnerung und in altmeisterlicher Lasurtechnik gemalten Szenen hingegen schildern in getreuer naturalistischer Manier meist den Moment, nachdem die Schlacht bereits geschlagen ist. Über der zerstörten Landschaft liegt eine widernatürliche, apokalyptische Ruhe, und Dix zeigt in akribischer Manier die geschundenen Leiber der verletzten und gefallenen Soldaten. Nicht als propagandistisches Mittel, so hat Dix wiederholt geäußert, sondern- gemäß seiner Chronistenpflicht -als reine Zustandsbeschreibungen. Aber nicht nur die politische Wirkung dieser Kunst ist heftig und kontrovers diskutiert worden, dem Künstler wurde auch immer wieder vorgeworfen, er sei letztlich mit diesen Bildern vor allem der „Faszination des Schreckens“ erlegen.
Häufig gestellte Fragen zu Otto Dix
Wer war Otto Dix und wann wurde er geboren?
Otto Dix wurde 1891 in Gera geboren. Er war ein deutscher Maler und Grafiker.
Wie lässt sich Dix künstlerisch einordnen?
Dix lässt sich nur schwer in die expressionistische Malerei einordnen. Er hatte keine Kontakte zu den herausragenden Vertretern wie der "Brücke" oder dem "Blauen Reiter". Seine expressionistische Phase war auf sein Frühwerk beschränkt. Später wandte er sich einem veristischen Stil zu und wurde ein Hauptvertreter der Neuen Sachlichkeit.
Worin unterschied sich Dix von anderen Künstlern wie George Grosz?
Grosz verstand sich als politischer Agitator, während Dix sich als Chronist sah, der die Ereignisse seiner Zeit bezeugt. Grosz’ Bilder sind politische Anklagen, während Dix’ Bilder eher das Leid und die Verzweiflung der Opfer zeigen.
Welche künstlerischen Einflüsse prägten Dix' Frühwerk?
Dix wurde von den Werken van Goghs und den Futuristen beeinflusst. Van Gogh beeinflusste seinen Farbauftrag, während die Futuristen ihn zu kubischen Formensplitterungen inspirierten.
Wie erlebte Dix den Ersten Weltkrieg?
Dix zog 1914 als Freiwilliger in den Krieg und erlebte ihn als Frontsoldat. Er sah sich in der Position eines Reporters, der die Pflicht hatte, teilzunehmen und zu berichten. Er schilderte den Krieg als ein "Naturereignis", verklärte ihn aber nicht.
Wie verarbeitete Dix seine Kriegserlebnisse künstlerisch?
Dix schuf Hunderte von Skizzen, Zeichnungen und Gouachen, in denen er seine Kriegserlebnisse verarbeitete. Er suchte in seinen Darstellungen das Allgemeine, die archetypische Situation. Nach dem Krieg malte er Szenen in altmeisterlicher Lasurtechnik, die den Zustand nach der Schlacht schilderten.
Wie veränderte sich Dix' Stil nach dem Krieg?
Nach dem Krieg gab Dix seine ausdrucksbetonte Formensprache auf und bezog unter dem Einfluss des Dadaismus die Collagetechnik in seine Gestaltungen mit ein.
Welche Themen waren für Dix nach dem Krieg wichtig?
Das Thema des Krieges und seiner Folgen blieb im Werk von Dix virulent. Krieg und Tod durchziehen fast leitmotivisch sein gesamtes Werk.
Welche bedeutenden Werke zum Thema Krieg schuf Dix?
Zu seinen bedeutenden Werken zum Thema Krieg gehören die Radierfolge "Der Krieg" von 1924, das Gemälde "Der Schützengraben" (1918-1923, zerstört) und das Triptychon "Der Krieg" (1929-1932).
Wie wurde Dix' Kunst rezipiert und kritisiert?
Dix' Kunst wurde heftig und kontrovers diskutiert. Ihm wurde vorgeworfen, er sei der "Faszination des Schreckens" erlegen.
- Quote paper
- Stefan Schumacher (Author), 2001, Leben und Werk des Künstlers Otto Dix, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102444