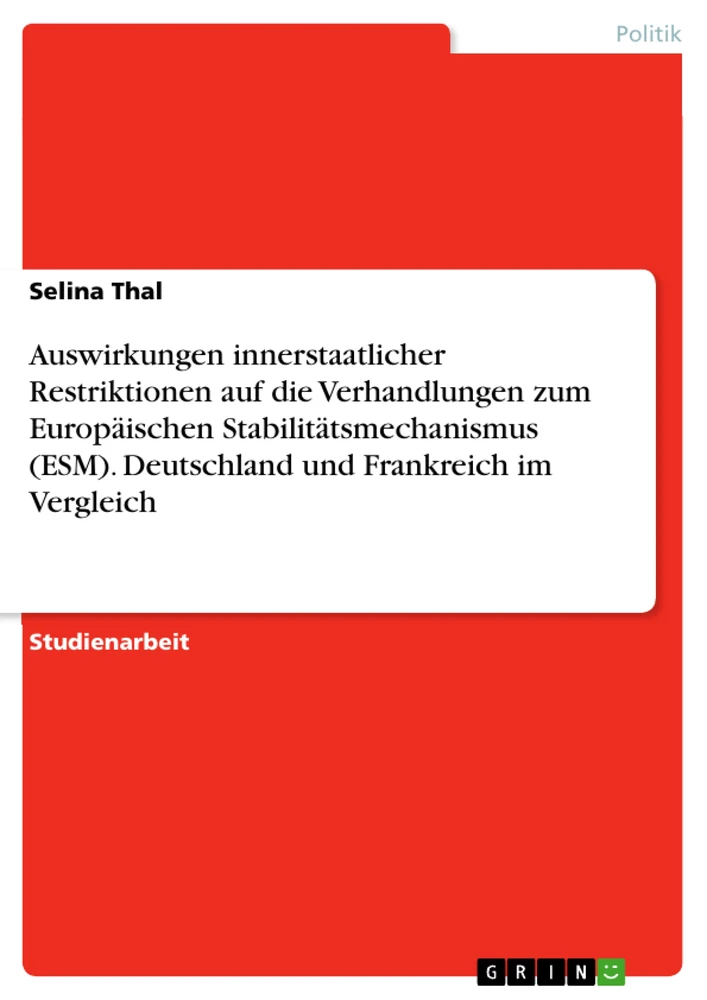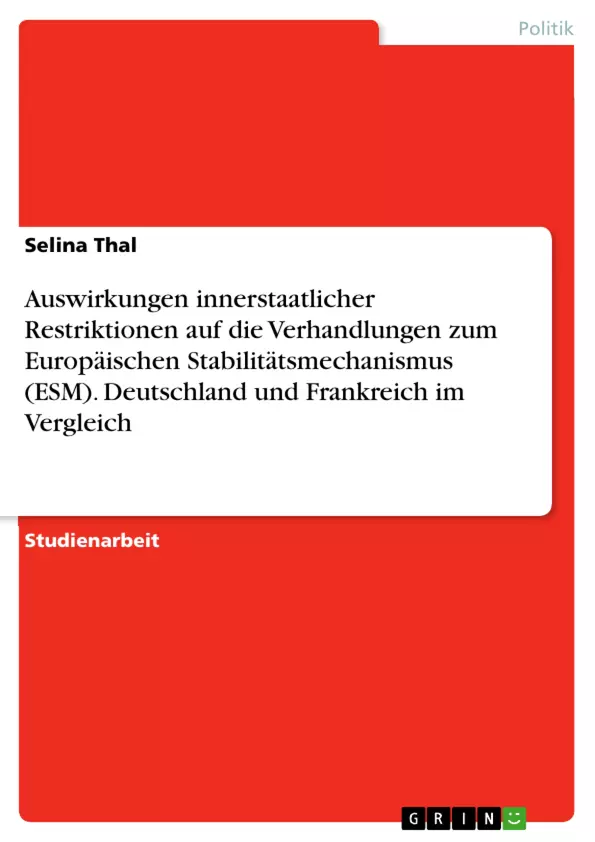Die vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die deutschen und französischen Verhandlungspositionen und ihre Durchsetzungsfähigkeit zu analysieren. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich der Erfolg bzw. Misserfolg der jeweiligen Verhandlungspositionen erklären lässt. Zwar konnte Frankreich Deutschland von der Notwendigkeit eines permanenten Stabilitätsmechanismus überzeugen, jedoch herrschten hinsichtlich der genauen Ausgestaltung große Differenzen. Welche Verhandlungspositionen sich im Endeffekt erfolgreicher durchsetzen ist von den formellen und informellen Handlungsrestriktionen auf innerstaatlicher Ebene abhängig. Das sogenannte innerstaatliche win-set dient in diesem Zusammenhang als erklärende Variable. Dass sich die deutschen Positionen erfolgreicher durchsetzen konnten, ist durch ein kleines innerstaatliches win-set zu erklären. Das größere französische win-set zog hingegen Zugeständnisse auf europäischer Ebene nach sich.
Um den außenpolitischen Handlungsspielraum beider Regierungen und somit den (Miss-)Erfolg der Verhandlungspositionen zu erklären, soll im zweiten Kapitel – dem theoretischen Abschnitt der Arbeit – auf den Zwei-Ebenen-Ansatz von Robert Putnam und seiner Erweiterung durch den Prinzipal-Agenten-Ansatz (PA-Ansatz) eingegangen werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Operationalisierung. Der Fokus des Hauptteils wird sowohl auf die Verhandlungsergebnisse des ESM als auch auf die Verhandlungspositionen beider Länder gelegt, um danach anhand einer vergleichenden Fallanalyse die Determinanten der innerstaatlichen win-sets zu analysieren. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1 Der Zwei-Ebenen-Ansatz und der Prinzipal-Agenten-Ansatz
- 3. Operationalisierung
- 3.1 Methodisches Vorgehen und Fallauswahl
- 3.2 Definition und Messung der Variablen
- 3.3 Quellen
- 4. Der Europäische Stabilitätsmechanismus
- 4.1 Verhandlungsverlauf und Ergebnisse
- 4.2 Positionen der französischen und deutschen Regierung
- 4.3 Der Erfolg der Positionen im Vergleich
- 5. Frankreich: Determinanten des innerstaatlichen win-sets
- 5.1 Die institutionellen Regeln der formalen Ratifikation
- 5.2 Salienz
- 5.3 Glaubhaftigkeit kostenträchtiger Sanktionsdrohungen
- 6. Deutschland: Determinanten des innerstaatlichen win-sets
- 6.1 Die institutionellen Regeln der formalen Ratifikation
- 6.2 Salienz
- 6.3 Glaubhaftigkeit kostenträchtiger Sanktionsdrohungen
- 7. Die innerstaatlichen win-sets im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Verhandlungspositionen Deutschlands und Frankreichs zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und untersucht, wie sich der Erfolg oder Misserfolg dieser Positionen durch die jeweiligen innerstaatlichen Handlungsrestriktionen erklären lässt.
- Der Zwei-Ebenen-Ansatz und der Prinzipal-Agenten-Ansatz
- Die Verhandlungsergebnisse des ESM
- Die Verhandlungspositionen Deutschlands und Frankreichs
- Die Determinanten der innerstaatlichen win-sets in Frankreich und Deutschland
- Der Vergleich der innerstaatlichen win-sets beider Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beschreibt die Zielsetzung, welche darin besteht, die Verhandlungspositionen Deutschlands und Frankreichs zum ESM zu analysieren und deren Erfolg oder Misserfolg anhand der jeweiligen innerstaatlichen Handlungsrestriktionen zu erklären.
Kapitel 2 behandelt den theoretischen Hintergrund der Arbeit und beleuchtet den Zwei-Ebenen-Ansatz von Robert Putnam sowie dessen Erweiterung durch den Prinzipal-Agenten-Ansatz.
Kapitel 3 widmet sich der Operationalisierung der Forschungsfrage. Es werden die methodischen Vorgehensweisen und die Fallauswahl erläutert, sowie die Definition und Messung der Variablen und die verwendeten Quellen vorgestellt.
Kapitel 4 beschreibt den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Es werden der Verhandlungsverlauf und die Ergebnisse dargestellt, sowie die Positionen der französischen und deutschen Regierung erläutert und deren Erfolg im Vergleich betrachtet.
Kapitel 5 analysiert die Determinanten des innerstaatlichen win-sets in Frankreich. Es werden die institutionellen Regeln der formalen Ratifikation, die Salienz des Themas und die Glaubhaftigkeit von kostenträchtigen Sanktionsdrohungen untersucht.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit den Determinanten des innerstaatlichen win-sets in Deutschland. Es werden ebenfalls die institutionellen Regeln der formalen Ratifikation, die Salienz des Themas und die Glaubhaftigkeit von kostenträchtigen Sanktionsdrohungen analysiert.
Kapitel 7 vergleicht die innerstaatlichen win-sets von Frankreich und Deutschland.
Schlüsselwörter
Europäischer Stabilitätsmechanismus, Zwei-Ebenen-Ansatz, Prinzipal-Agenten-Ansatz, innerstaatliches win-set, Verhandlungsposition, Ratifikation, Salienz, Sanktionsdrohungen, Deutschland, Frankreich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM)?
Der ESM ist ein permanenter Rettungsschirm für Euro-Länder, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, um die Stabilität der Währungsunion zu sichern.
Warum konnte Deutschland seine Positionen beim ESM besser durchsetzen als Frankreich?
Die Arbeit erklärt dies durch ein kleineres „innerstaatliches win-set“ Deutschlands: Aufgrund strenger verfassungsrechtlicher Hürden (Bundesverfassungsgericht) und parlamentarischer Kontrolle hatte die Regierung weniger Spielraum für Zugeständnisse.
Was bedeutet der „Zwei-Ebenen-Ansatz“ von Robert Putnam?
Er besagt, dass internationale Verhandlungen gleichzeitig auf zwei Ebenen stattfinden: der internationalen (zwischen Regierungen) und der nationalen (Ratifikation durch das Parlament oder Volk).
Welche Rolle spielt die „Salienz“ in den Verhandlungen?
Salienz beschreibt die Wichtigkeit eines Themas für die Öffentlichkeit. Eine hohe Salienz schränkt den Verhandlungsspielraum einer Regierung ein, da sie stärker unter Beobachtung steht.
Was ist ein „win-set“?
Ein win-set umfasst alle möglichen Verhandlungsergebnisse auf internationaler Ebene, die auf nationaler Ebene noch eine Mehrheit zur Ratifikation finden würden.
- Citar trabajo
- Selina Thal (Autor), 2014, Auswirkungen innerstaatlicher Restriktionen auf die Verhandlungen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Deutschland und Frankreich im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022425