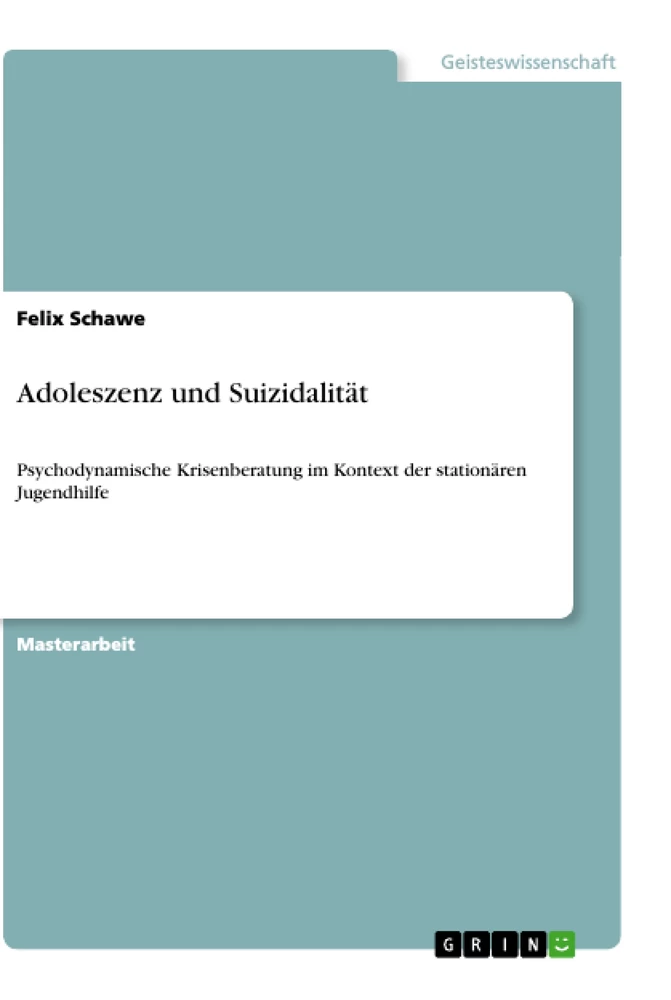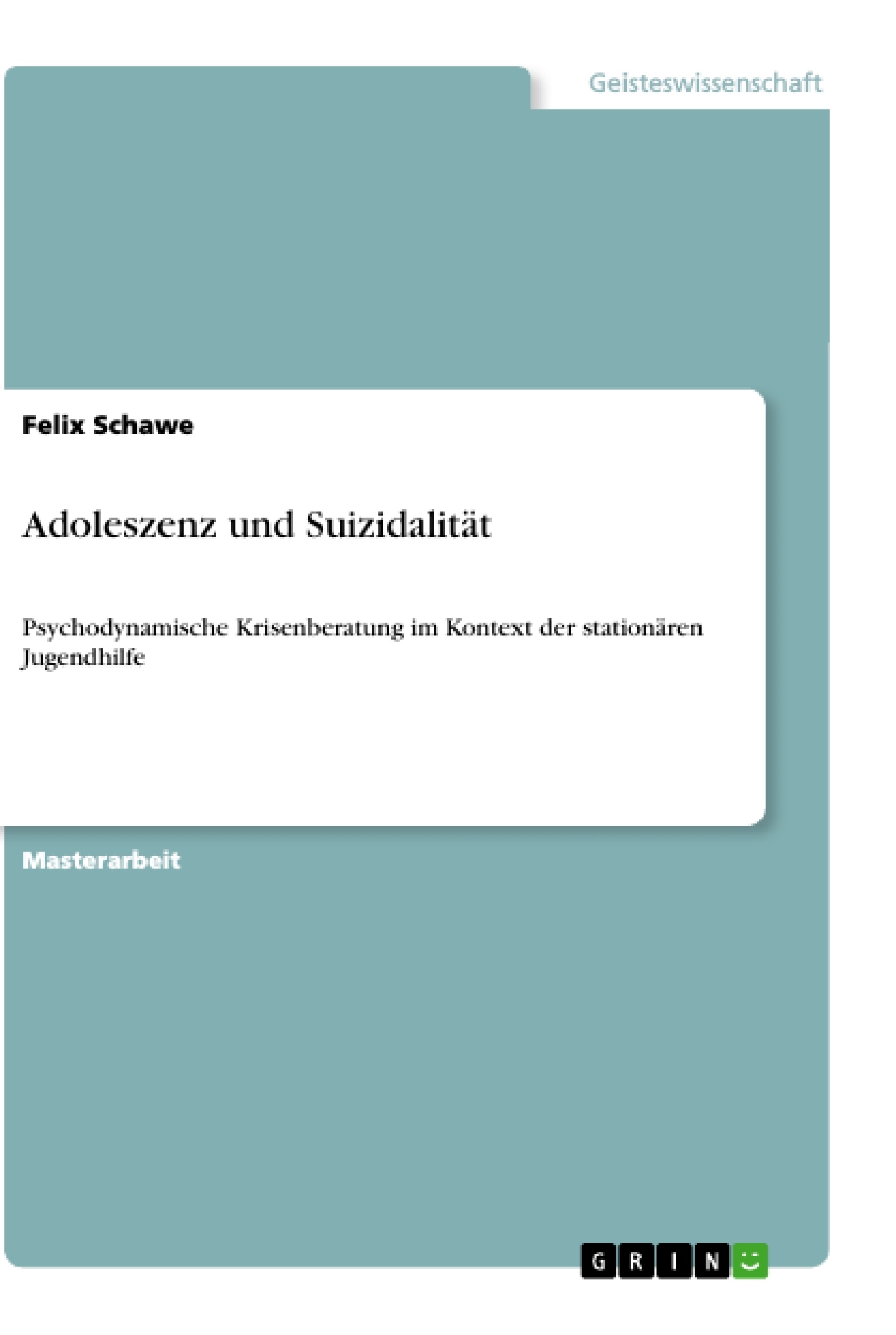Diese Arbeit gibt Einblicke in die Epidemiologie, psychoanalytische Theorie und Praxis adoleszenter Suizidaliät und formuliert am Fallbeispiel praxisgeleitet Handlungsoptionen zum Umgang mit dem Phänomen. Ziel der Arbeit ist die Selbstbemächtigung von Pädagog*innen zum selbstreflexiven und kritischen Umgang mit suizidalen Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe.
Suizide sind in jeder Form verstörend, lösen heftige Affekte aus und scheinen aufgrund ihrer psychosozialen Bedeutungen bis heute noch ein Tabuthema zu sein. Fachkräfte in der psychosozialen Arbeit werden immer häufiger mit Suizidalität konfrontiert. Eine besondere Klientel sind dabei Jugendliche, denn „die Pubertät und Adoleszenz z.B. sind für die meisten Menschen krisenhafte Zeiten. (…) Suizidgedanken sind in dieser Zeit nicht ungewöhnlich“.
Oftmals lösen Äußerungen von Jugendlichen hinsichtlich jener Thematik Angst und Panik aus, verleiten die Professionellen zu Aktionismus, der nicht immer hilfreich ist.
In vielen Fällen sind es die eigenen Gefühle der Fachkräfte, die im Kontakt mit suizidalen Jugendlichen quälend erscheinen und dazu verleiten können, Jugendliche „schnell psychiatrisch unterzubringen“, „institutionell wegzuschieben“, oder durch eine regelrechte Flut von Hilfsangeboten und Sonderabsprachen zu schützen, die auf Dauer nicht eingehalten werden können. Schnell entstehen Verstrickungen und schwierige Situationen.
Inhaltsverzeichnis
- Suizidalität und stationäre Jugendhilfe
- Zur Bedeutung der Terminologie
- Epidemiologie und Statistik
- Grundprinzipien der suizidalen Krise
- Traumatische Krise vs. (Lebens-) Veränderungskrise
- Gemeinsamkeiten / Psychodynamische Besonderheiten der Krise
- Suizidale Krise bei Jugendlichen
- Individualisierungstheorem und Bildungslaufbahn
- Identitätsentwicklung
- Entwicklungsaufgaben
- Exkurs: Adoleszente Suizidalität durch Medieneinfluss?
- Psychoanalytische Suizidtheorien
- Das Suizidkonzept von Freud und Abraham
- Das Narzissmus Konzept von Henseler
- Der objektbeziehungstheoretische Ansatz von Kind
- Das präsuizidale Syndrom von Ringel
- Plödinger's Modell der präsuizidalen Entwicklung
- Ein methodischer Zugang: Psychodynamische Beratung
- Suizidalität im Kontext der stationären Jugendhilfe
- Verdacht auf Suizidalität / Gesprächsbeginn
- Suizidrisikoabschätzung
- Omnipräsenz versus Ablehnung: Die Bedeutung der Gegenübertragung
- Zur Frage der beraterischen und pädagogischen Haltung
- Containing
- Affektregulation zu zweit
- Projektive Identifizierung
- Szenisches Verstehen
- Suizidprophylaxe im pädagogischen Alltag?
- Primäre Suizidprävention durch Stärkung von Resilienzfaktoren
- Sekundäre und tertiäre Prävention bei Suizidalität
- Die Selbstbemächtigung der Pädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Master-Thesis befasst sich mit der Thematik der Suizidalität im Kontext der stationären Jugendhilfe. Sie beleuchtet psychoanalytische Konzepte und deren Bedeutung für die beraterische und pädagogische Arbeit mit suizidalen Jugendlichen. Die Arbeit zielt darauf ab, das komplexe Thema Suizidalität bei Jugendlichen facettenhaft zu beleuchten und ein reflexives Verständnis für die Interaktion mit suizidalen Jugendlichen zu entwickeln.
- Psychodynamische Besonderheiten im Kontakt mit suizidalen Jugendlichen
- Psychoanalytische Suizidtheorien und deren Relevanz für die Praxis
- Die Bedeutung der Gegenübertragung in der Arbeit mit suizidalen Jugendlichen
- Beraterische und pädagogische Haltungen im Umgang mit Suizidalität
- Suizidprävention durch Stärkung von Resilienzfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der Suizidalität in der stationären Jugendhilfe. Die Bedeutung der Terminologie wird geklärt und ein Einblick in die Epidemiologie und Statistik gegeben.
Das zweite Kapitel behandelt den Krisenbegriff und beleuchtet die psychodynamischen Besonderheiten traumatischer und Veränderungskrisen. Anschließend wird die suizidale Krise bei Jugendlichen im Detail untersucht, inklusive der Themen Individualisierungstheorem, Identitätsentwicklung und Entwicklungsaufgaben.
Im dritten Kapitel werden gängige psychoanalytische Theorien und Entwicklungsmodelle zum Suizid vorgestellt, wie z.B. das Suizidkonzept von Freud und Abraham, das Narzissmus Konzept von Henseler und der objektbeziehungstheoretische Ansatz von Kind.
Das vierte Kapitel widmet sich der psychodynamischen Beratung als methodischen Zugang zur Arbeit mit suizidalen Jugendlichen.
Das fünfte Kapitel analysiert anhand eines Fallbeispiels die Interaktion mit einem suizidalen Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe. Die Interaktion wird theoriegeleitet betrachtet und verschiedene Problemfelder, die daraus erwachsen, werden im Detail erläutert.
Das sechste Kapitel leitet aus den gewonnenen Erkenntnissen ein Haltungs- und Handlungsprofil für die Arbeit mit suizidalen Jugendlichen ab.
Schlüsselwörter
Suizidalität, stationäre Jugendhilfe, psychodynamische Beratung, Gegenübertragung, Psychoanalytische Suizidtheorien, Adoleszenz, Krisenintervention, Resilienzfaktoren, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Suizidalität in der Adoleszenz ein wichtiges Thema?
Die Pubertät ist eine krisenhafte Zeit der Identitätsentwicklung; Suizidgedanken sind in dieser Phase leider nicht ungewöhnlich und erfordern professionelle Aufmerksamkeit.
Welche psychoanalytischen Theorien zum Suizid gibt es?
Die Thesis behandelt Konzepte von Freud, Henseler (Narzissmus) und Kind (Objektbeziehungstheorie) sowie das präsuizidale Syndrom nach Ringel.
Was bedeutet „Gegenübertragung“ im Kontakt mit suizidalen Jugendlichen?
Es bezeichnet die Gefühle der Fachkräfte (wie Angst oder Ohnmacht), die durch den Jugendlichen ausgelöst werden und die pädagogische Arbeit massiv beeinflussen können.
Wie kann Suizidprophylaxe im pädagogischen Alltag aussehen?
Durch die Stärkung von Resilienzfaktoren, eine tragfähige pädagogische Haltung („Containing“) und eine frühzeitige Risikoabschätzung.
Was ist das Ziel der „Selbstbemächtigung der Pädagogik“?
Pädagogen sollen befähigt werden, reflexiv und kritisch mit dem Phänomen umzugehen, anstatt suizidale Jugendliche aus Angst sofort institutionell „wegzuschieben“.
- Arbeit zitieren
- Felix Schawe (Autor:in), 2020, Adoleszenz und Suizidalität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021330