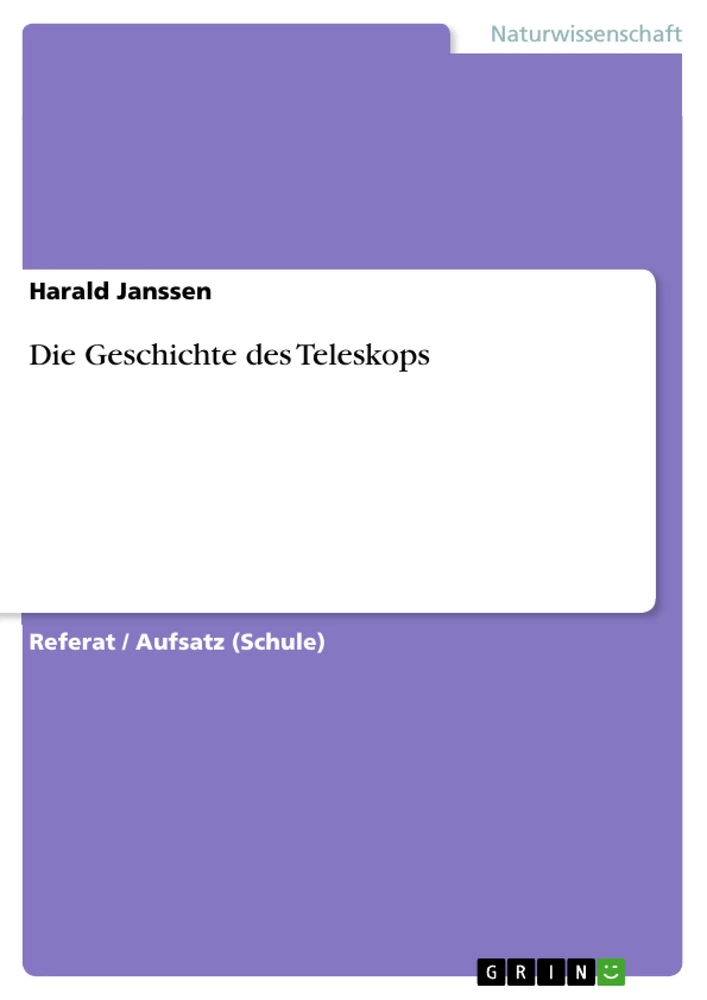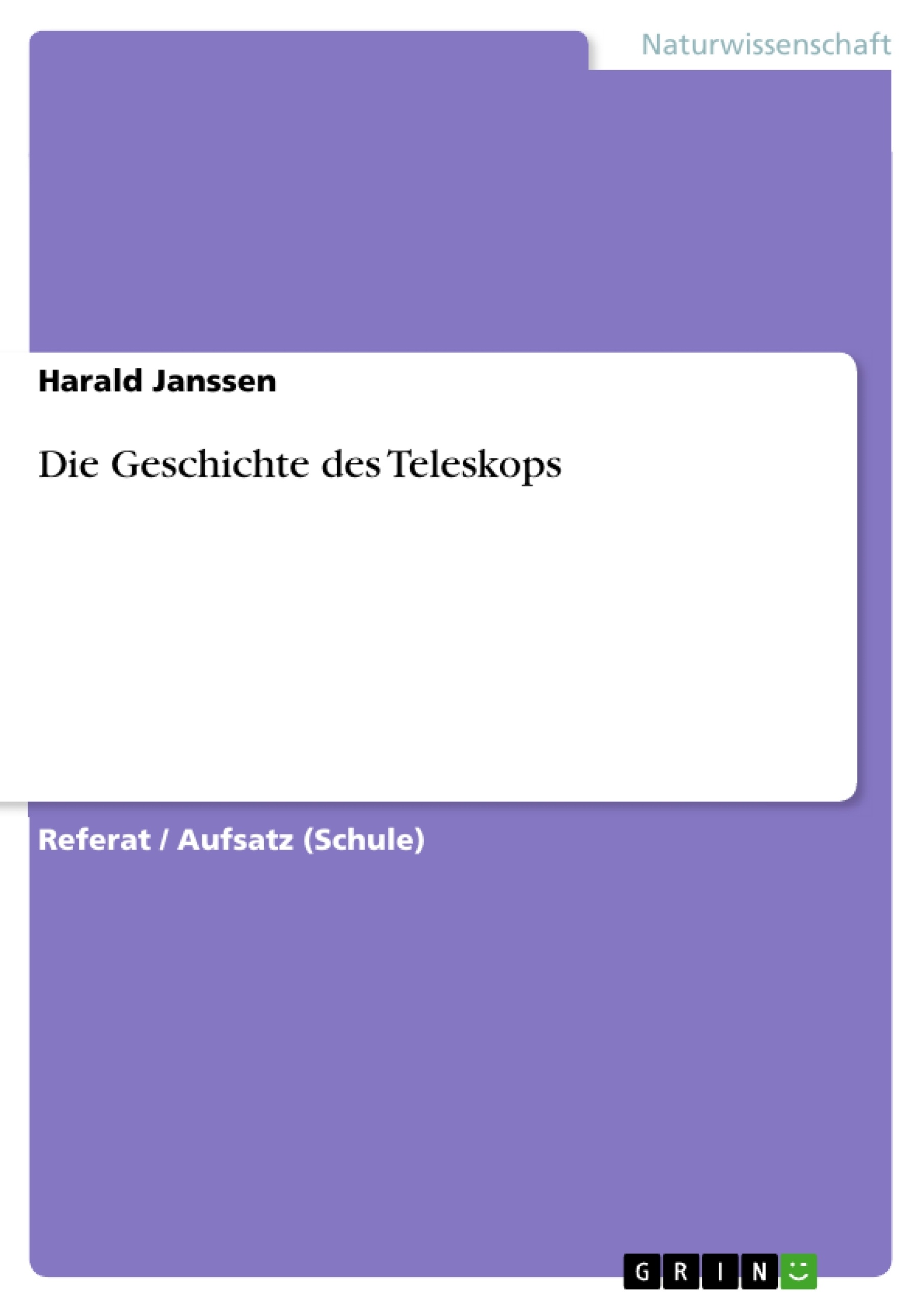Die Geschichte des Teleskops
Verschiedene Quellen besagen, dass das erste Teleskop von dem holländischen Brillenmacher Hans Lippershey 1608 entdeckt wurde. In Fachkreisen wird dies allerdings diskutiert, da die erste Ausstellung eines Teleskops Galileo Galilei im Jahre 1609 stattfand. Das Prinzip des astronomischen Fernrohrs mit zwei konvexen Linsen wurde von Johannes Kepler entdeckt und 1930 von Christoph Scheiner, Problem dabei war die Größe von bis zu 61 Meter das lag an der Art der Vergrößerung f1/f2 = Vergrößerung Erst als der britische Optiker John Dolland und Josehph von Fraunhofer dies weiterentwickelten wurden die Linsen kleiner so etwa 7,5cm - 25 cm.
Im frühen 17. Jahrhundert nutzte der Ital. Jesuit Niccolo Zuchi ein Okular für die Betrachtung, der Abbildung die ein konkaver Spiegel erzeugte. Die Theorie des Spiegelteleskops beschrieb James Gregory 1663 zum ersten mal und wurde 1668 von Isaac Newton gebaut
1. Einleitung
Die Aufgabe in unserem Experiment besteht darin, zwei funktionstüchtige Fernrohre (Teleskope) zu bauen, die mit Hilfe von einfachen, zum größten Teil schon vorhandenen Komponenten aus dem Schulinventar, wie Linsen, Spiegeln, Schrauben etc. zusammengesetzt werden sollen. Unser Hauptaugenmerk liegt hier beim Zusammenbau des Spiegelteleskops, wie es Isaac Newton um 1671 erfand. Welche Aufgabe ein Fernrohr hat, ist eigentlich jedem klar: Das Bild eines weitentfernten Gegenstandes soll dem Betrachter vergrößert dargestellt werden.
2. Theorie
Funktion und Aufbau: Beispiel: Das Linsenteleskop
Es besteht, einfach gesagt, aus zwei konvexen Linsen, dem Objektiv und dem Okular in einem Rohr. Der Gegenstand, der betrachtet werden soll, befindet sich sehr weit vor dem Objektiv. Um den weitentfernten Gegenstand mit dem Auge nachher größer zu sehen, ist es wichtig die beiden Linsen (Objektiv und Okular) in der richtigen Entfernung zueinander zu positionieren. Optimal ist der Abstand, wenn die inneren Brennpunkte von Objektiv und Okular (F1 und F2) praktisch zusammenfallen. Bei dieser Positionierung der beiden Linsen entsteht zunächst ein Zwischen- bild unmittelbar hinter dem Brennpunkt des Objektivs und gleich- zeitig innerhalb der Brennweite des Okulars. Das eigentliche
Endbild entsteht vor dem Okular. Es ist ein vergrößertes virtuelles Bild, das auf den Gegenstand bezogen verkehrt herum steht.
V = Vergrößerung des Fernrohrs = f1 : f2 (in diesem Fall: 30cm : 6cm = 5fache Vergrößerung)
f1 = Brennweite des Objektivs F1 = Brennpunkt des Objektivs f2 = Brennweite des Okulars F2 = Brennpunkt des Okulars
Bz = Zwischenbild B = Endbild G = Gegenstand
L = Länge des Fernrohrs (Abstand Objektiv - Okular = f1 + f2) (in diesem Fall: 30cm + 6cm = 36
Beispiel: Das Spiegelteleskop
Das Spiegelteleskop besteht aus einem Hohlspiegel (dem Spiegel-objektiv), aus einem kleinen diagonal in den Strahlengang gestellten Planspiegel und aus einer Linse im Okular. In unserem Aufbau haben wir als Okular zwei konvexe Linsen mit je einer Brennweite von 10cm kombiniert um eine kleinere Gesamt-brennweite zu erzielen und so die Bildvergrößerung etwas zu erhöhen.
Die Formel dazu lautet: 1 : fa+ 1 : fb = 1 : f gesamt
fa= 10cm 1 : 10cm 1 : 10cm = 0,2 à 1 : 0,2 = 5cm Brennweite fb= 10cm
Der Strahlengang verläuft folgendermaßen: Das vom Beobachtungsobjekt ausgehende Licht wird im Teleskop vom Spiegelobjektiv (Hohlspiegel) reflektiert, gebündelt und über einen diagonal in den Strahlengang gestellten Planspiegel (also im Winkel von 45°), der sich möglichst genau im Brennpunkt des Objektivs und des Okulars befindet um 90° nach oben zu den beiden Linsen (Okular) gelenkt. Es entsteht zunächst wieder ein Zwischenbild vom Spiegel-objektiv, das vom Okular, nach dem Prinzip der Lupe, vergrößert wird. Wie beim einfachen Linsenfernrohr steht das Endbild ebenfalls verkehrt herum.
V = Vergrößerung des Spiegelteleskops = f1 : f2 (in diesem Fall: 20cm : 5cm = 4fache Vergrößerung)
f1 = Brennweite des Objektivs F1 = Brennpunkt des Objektivs f2 = Brennweite des Okulars F2 = Brennpunkt des Okulars
3. Durchführung/Aufbau Spiegelteleskop
Bei der praktischen Umsetzung des Spiegelteleskops sind wir wie folgt vorgegangen: Wir haben uns ein Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 10 cm und einer Länge von ca. 80cm gekauft. Danach haben wir überlegt, wie wir den Oberflächenspiegel im 45° Winkel in der Mitte des Kunststoffrohrs platzieren können, so das er genau im Strahlengang liegt. Wir haben dann den Spiegel am einen Ende einer Schraube mit Heißkleber befestigt und durch ein Loch im 45° Winkel in der Mitte des Kunststoffrohrs platziert und mit Muttern und Unterlegscheiben befestigt. Weiter haben wir das Okular, zwei Sammellinsen mit einer Brennweite von je 10 cm, in einem Papprohr senkrecht über dem Oberflächenspiegel durch ein Loch im Kunststoffrohr, das durch eine Stichsäge grob ausgesägt und anschließend auf die richtige Größe gefeilt wurde, angebracht. Den Hohlspiegel, mit einer Brennweite von 20 cm, haben wir an einem Ende des Rohrs befestigt. Der Hohlspiegel reflektiert das einfallende Licht vom Beobachtungsobjekt zum Diagonalspiegel, der es zum Okular weiterleitet. Desweiteren haben wir den Diagonalspiegel ausgerichtet um die 4fache Vergrößerung, die man mit den eingebauten Linsen erreichen kann, zu nutzen. Als letzten Schritt haben wir das Kunststoffrohr auf ca. 47 cm verkürzt, um den Lichteinfall zu verbessern.
Linsenteleskop
Zum Aufbau des Linsenfernrohrs haben wir folgende Komponenten verwendet:
Wir haben ein Papprohr mit einer Länge von 36 cm gewählt, weil die Länge des Fernrohrs gleich der Abstand von Objektiv und Okular ist. Als Formel geschrieben: L= f1 +f2 Die beiden Sammellinsen, das Okular mit einer Bennweite von 6 cm und das Objektiv mit einer Brennweite von 30 cm, haben wir wie folgt befestigt. Das Okular haben wir an ein Tonpapierrohr geklebt und an den Durchmesser des Papprohrs angepasst. Das Objektiv passte von der Größe genau in das andere Ende des Papprohrs. Somit haben wir ein voll funktionierendes Linsenfernrohr, mit einer 5fachen Vergrößerung.
Material: Spiegelteleskop
- Kunststoffrohr: Durchmesser 10 cm, Länge 80 cm - Hohlspiegel: Brennweite 20 cm - 1
Oberflächenspiegel - 2 Sammellinsen: Brennweite je 10 cm - Schraube: M2 - 3 Muttern: M8 -
2 Unterlegscheiben - kleines Papprohr
Material: Linsenfernrohr
- 2 Sammellinsen: Brennweite 6 cm und 30 cm - 1 Papprohr - Tonpapier Arbeitsmittel zur Durchführung:
- Glasschneider - Pucksäge - Cutter - Feile - Messschieber - Stichsäge - Heißkleber - Teserfilm
4. Ergebnis
Als Ergebnis haben wir ein Spiegelteleskop und ein Fernrohr erhalten. Beide vergrößern unterschiedlich gut entfernte Objekt. Da die Justierung bei dem Spiegelteleskop wesentlich schwerer war, ist es auch nicht so gut (nicht so scharfe Vergrößerung).
V = f 1/f2
V = Vergrößerung f1 und f2 = Brennweite Linsen: V = 5 Hohlspiegel: V = 4
5. Problematik
Die Problematik bei der Justierung des Spiegels im Spiegelteleskop lag hauptsächlich bei der Ausrichtung und der Wahl der Größe des Spiegels. Ist der Spiegel zu groß, fällt zu wenig Licht auf den Hohlspiegel. Ist er zu klein, ist es schwer ihn im Strahlengang zu positionieren. Außerdem musste der Spiegel genau in der Mitte des Rohres montiert werden. Er muss zusätzlich schräg in das Rohr montiert werden um den Strahlengang rechtwinklig zur Linse zu lenken. Der Spiegel muss auch in bestimmter Entfernung zum Hohlspiegel und zur Linse sein. Der Spiegel sollte in der Brennweite des Hohlspiegels und zur Linse angebracht werden. Außerdem haben wir in einer Linsenhalterung zwei Linsen montiert. So haben wir eine Verkürzung der Brennweite erreicht.
6. Anwendungsgebiete
Teleskope sind optische Instrumente mit denen man weit entfernte Objekte beobachten kann. Dies wird z. B. in der Astronomie angewandt um Sterne, Galaxien, Nebel, Planeten oder auch Sonnensysteme zu beobachten. Selbstverständlich muss das Licht, das von diesem Objekt ausgeht, in sichtbarem Bereich des Spektrums liegen.
Quellen: Nachschlagebücher für Grundlagenfächer : Physik Internet ,,Teleskop" Encarta Enzyklopädie