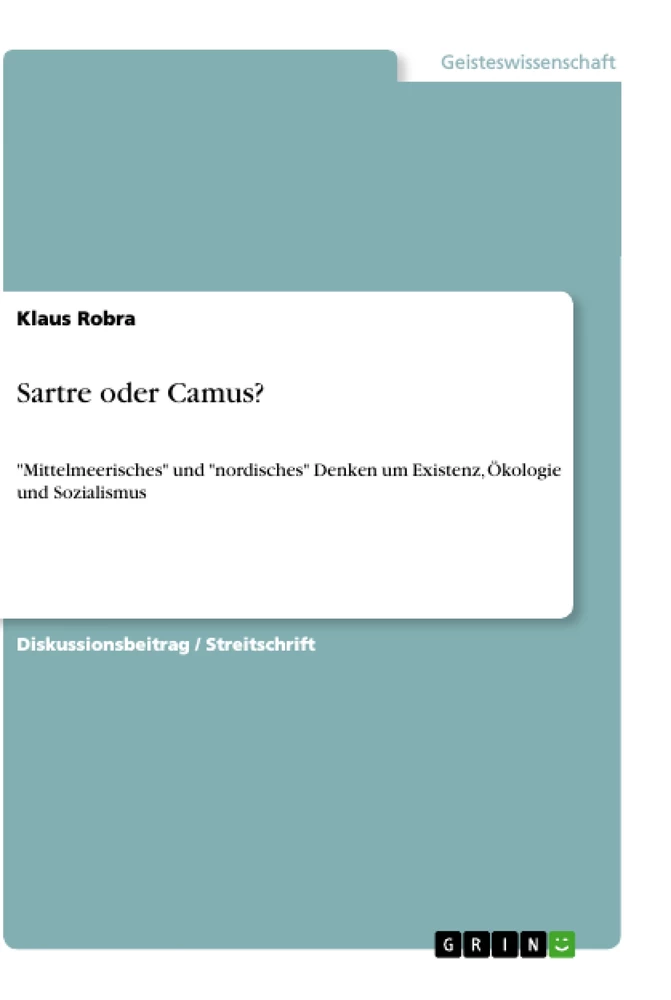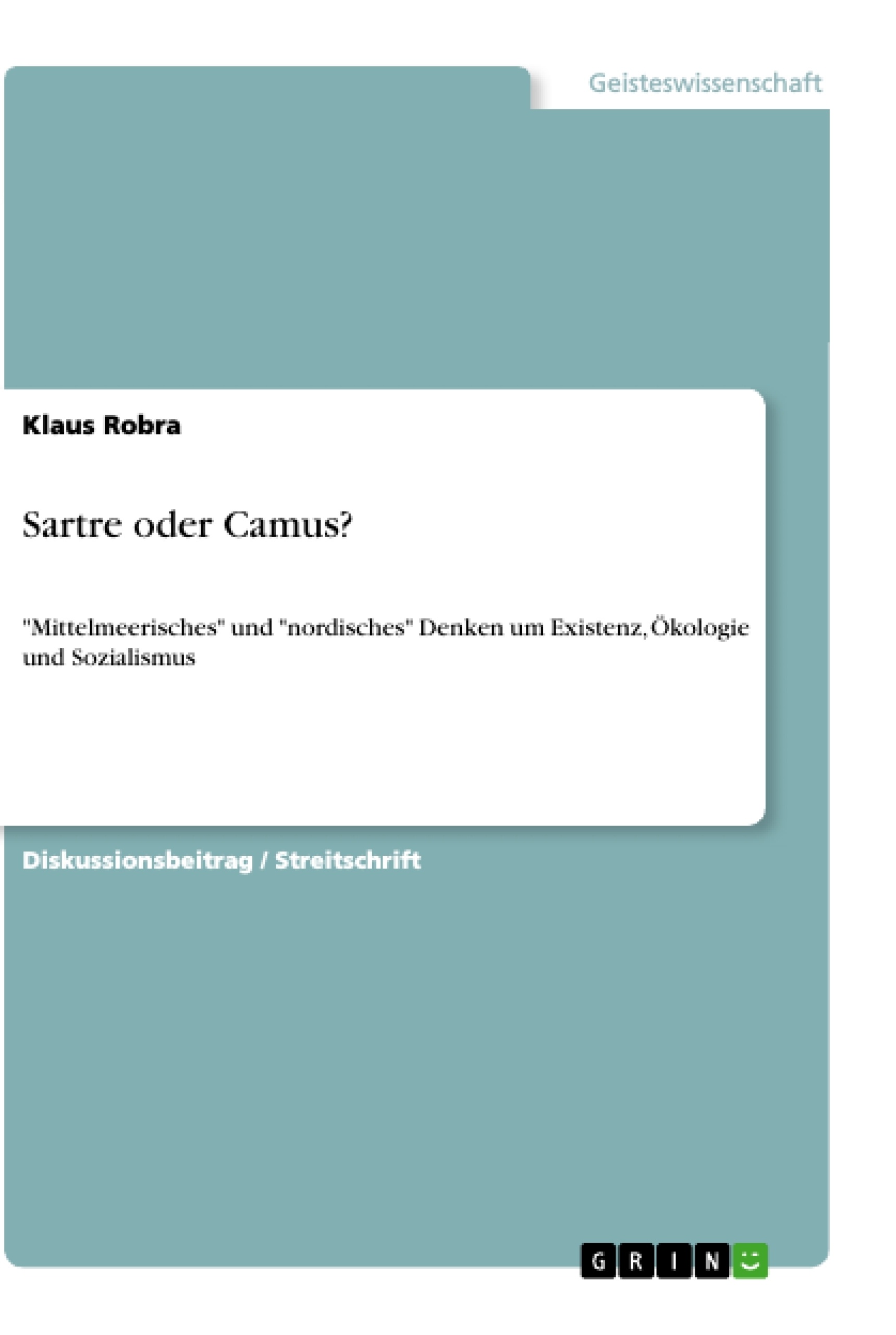"Am Ende hat die Geschichte Sartre unrecht gegeben. Und Camus in allem bestätigt." (I. Radisch). Aber diese holzschnittartige Vereinfachung enthält allenfalls die halbe Wahrheit. Camus bietet mit seiner 'Pensée de Midi' Grundlagen für eine - auch und gerade heutzutage noch zeitgemäße - Öko-Ethik, versäumt es aber, diese durch die notwendige Kapitalismus-Kritik zu stützen. Sartre hingegen kommt das Verdienst zu, in seiner 'Kritik der dialektischen Vernunft' (1960) den Marxismus und damit die erforderliche Kapitalismus-Kritik teilweise neu begründet zu haben, ohne dies jedoch mit dem zu verbinden, was Camus in seiner 'Pensée de Midi' geleistet hat.
Inhaltsverzeichnis
- Sartres Existenzialismus und Marxismus: Wert-Theorien der besonderen Art
- Das An-sich (,En-soi')
- Das Für-sich (,Pour-soi')
- Das Für-Andere-Sein (,l'Etre-Pour-Autrui')
- Liebe und Sexualität
- ,En-soi-pour-soi‘: Synthese im „An-und-für-sich“?
- Wert (,la valeur‘): ein Schlüssel zum Ganzen!?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit den Philosophien von Jean-Paul Sartre und Albert Camus, insbesondere mit Sartres Existenzialismus und dessen Verbindung zu marxistischen Ideen. Der Autor analysiert Sartres Konzept von Sein und Nichts und dessen Einfluss auf die Theorie von Wert und Bedeutung.
- Sartres Existenzialismus und seine Abgrenzung vom Denken Heideggers
- Die Konzepte des An-sich und Für-sich im Werk Sartres
- Die Rolle des Anderen im Leben des Individuums nach Sartre
- Die Bedeutung von Freiheit und Negation in Sartres Philosophie
- Der Einfluss von Wert und Bedeutung auf das menschliche Sein
Zusammenfassung der Kapitel
Sartres Existenzialismus und Marxismus: Wert-Theorien der besonderen Art
Das Kapitel erläutert Sartres Existenzialismus und seine Abgrenzung vom Denken Heideggers. Es stellt Sartres atheistische Position heraus und führt seine zentralen Begriffe „An-sich“ und „Für-sich“ ein.
Das An-sich (,En-soi')
Sartre betrachtet das Sein als allgegenwärtig. Er unterscheidet zwischen dem „An-sich“, das außerhalb des Bewusstseins liegt, und dem „Für-sich“, dem Bewusstsein selbst. Das „An-sich“ ist identisch mit sich selbst und für das Bewusstsein undurchsichtig.
Das Für-sich (,Pour-soi')
Das „Für-sich“ ist nicht identisch mit sich selbst, sondern befindet sich in einer ständigen Dialektik von Sein und Nichts. Es ist zeitgebunden und kontingent und negiert jeden Augenblicks-Inhalt durch den nächsten.
Das Für-Andere-Sein (,l'Etre-Pour-Autrui')
Sartre analysiert die Begegnung des Menschen mit dem Anderen, die sowohl durch Körperlichkeit als auch durch Subjektivität geprägt ist. Der Blick des Anderen stellt eine Gefahr für die eigene Freiheit dar.
Liebe und Sexualität
Sartre untersucht die Phänomene der Abgrenzung und Distanzierung in Liebes- und Sexualbeziehungen. Er sieht in der Liebe und Sexualität vor allem Konflikt und Scheitern.
,En-soi-pour-soi‘: Synthese im „An-und-für-sich“?
Sartre kritisiert Hegels Versuch, die Differenz zwischen An-sich und Für-sich im „An-und-für-sich“ zu überwinden. Er hält an der Kantischen Unterscheidung fest und sieht eine Verbindung zwischen beiden nur als gedankliche Möglichkeit.
Schlüsselwörter
Der Text dreht sich um zentrale Themen des Existenzialismus, insbesondere um die Konzepte von Sein und Nichts, Freiheit und Negation sowie die Rolle des Anderen. Wesentliche Schlüsselbegriffe sind „An-sich“, „Für-sich“, „Wert“, „Bedeutung“, „Existenz“ und „Atheismus“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Sartres und Camus' Denken?
Sartre verbindet Existenzialismus mit Marxismus und Kapitalismuskritik, während Camus mit seiner "Pensée de Midi" eher Grundlagen für eine Öko-Ethik ohne tiefe Kapitalismuskritik bietet.
Was bedeutet "An-sich" (En-soi) bei Sartre?
Das "An-sich" bezeichnet das Sein, das außerhalb des Bewusstseins liegt, mit sich selbst identisch und undurchsichtig ist.
Was ist das "Für-sich" (Pour-soi)?
Das "Für-sich" ist das menschliche Bewusstsein, das nicht mit sich selbst identisch ist, sondern sich in einer ständigen Dialektik von Sein und Nichts befindet.
Wie sieht Sartre die Beziehung zum Anderen?
Sartre beschreibt die Begegnung mit dem Anderen oft als Konflikt; der Blick des Anderen kann die eigene Freiheit gefährden ("Der Blick").
Welche Rolle spielt der Atheismus in Sartres Philosophie?
Sartre vertritt eine atheistische Position, in der der Mensch ohne göttliche Vorgabe zur Freiheit verdammt ist und seinem Leben selbst Sinn geben muss.
- Citation du texte
- Dr. Klaus Robra (Auteur), Sartre oder Camus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014596