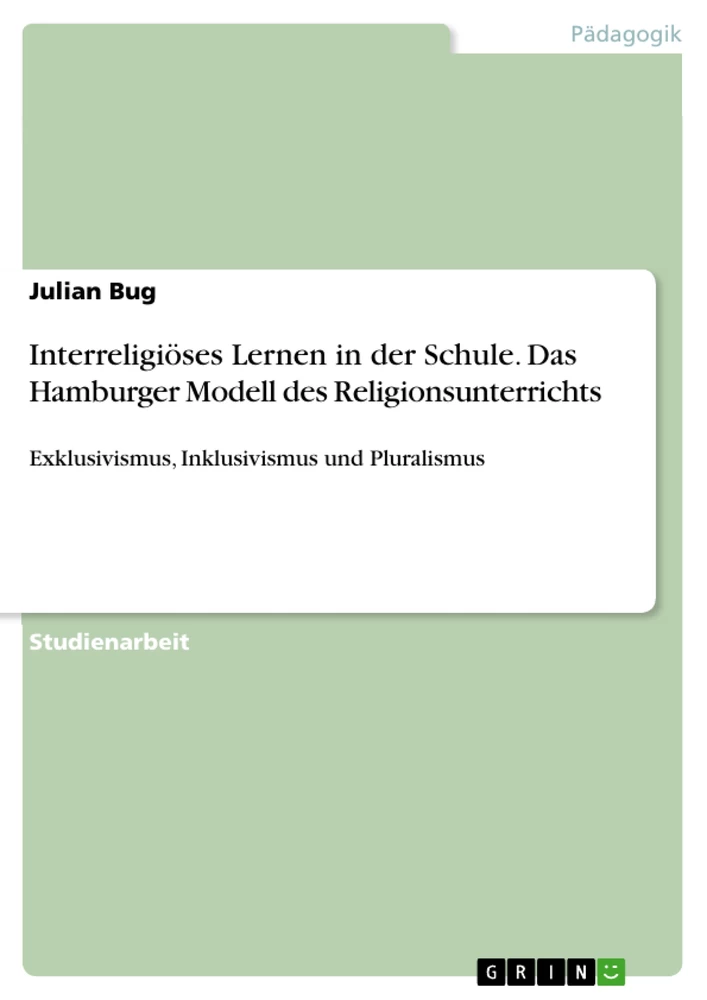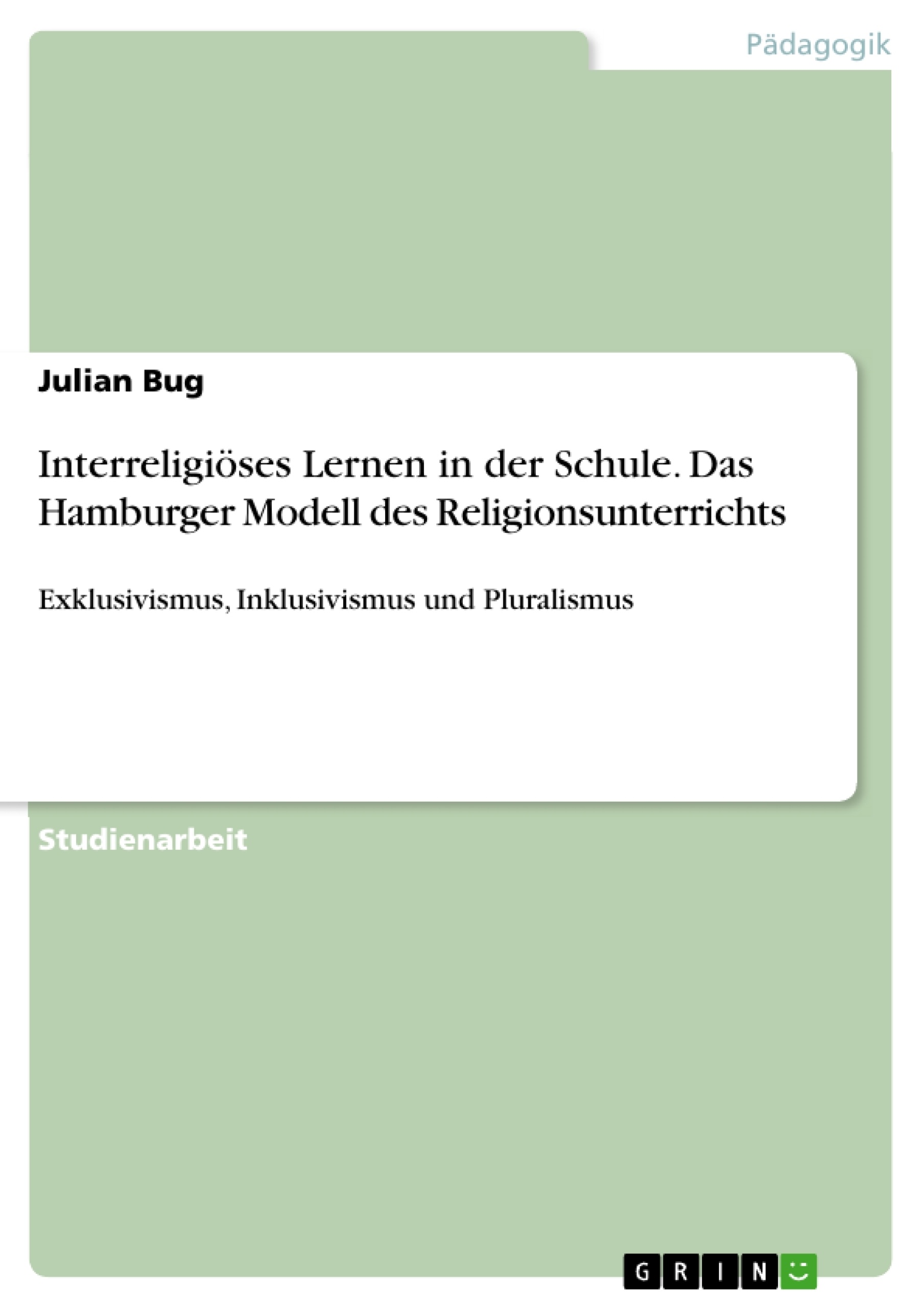Lehrer und Lehrerinnen stehen täglich vor der Herausforderung religiöser Pluralität. In dieser Arbeit soll diese Herausforderung aus der Sicht des Religionsunterrichts näher betrachtet werden, da es sich hierbei um ein Thema handelt, das hauptsächlich alltäglich gelernt wird, nicht aber den flächendeckenden Weg in den Schulunterricht gefunden hat.
Interreligiöses Lernen ist insbesondere heutzutage in unserer multikulturellen und polyreligiösen Gesellschaft essenziell, damit Schüler und Schülerinnen sich in diese Gesellschaft integrieren und an dieser partizipieren können. Wichtig ist es darzulegen, dass Schüler und Schülerinnen im Alltag stetig mit der Tatsache des interreligiösen Lernens konfrontiert werden.
Sei es in der Klasse mit andersgläubigen Mitschülern, wenn ihnen auf dem Schulweg Frauen mit Hijab (islamisches Kopftuch) entgegen kommen, oder in den Medien wirksame Diskussionen über ein Kopftuchverbot und die Veröffentlichung von Publikationen wie beispielsweise „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religiös-kulturell pluralistisches Deutschland
- Religionstheologische Positionen/Modelle zum interreligiösen Dialog
- Wie findet interreligiöses Lernen bereits statt? - das Hamburger Modell des Religionsunterrichts für alle im Blick
- Chancen, Perspektiven und Herausforderungen des interreligiösen Lernens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, insbesondere vor dem Hintergrund der religiös-kulturellen Pluralität Deutschlands. Sie beleuchtet verschiedene religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog und analysiert bestehende Konzepte, mit besonderem Fokus auf das Hamburger Modell. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Betrachtung der Chancen und Herausforderungen interreligiösen Lernens im schulischen Kontext.
- Religiöse und kulturelle Pluralität in Deutschland
- Religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog (Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus)
- Das Hamburger Modell des Religionsunterrichts für alle
- Chancen und Herausforderungen interreligiösen Lernens
- Theologische Zentrierung vs. Religionskunde im interreligiösen Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema interreligiöses Lernen ein und betont dessen Bedeutung in einer multikulturellen Gesellschaft. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die religiös-kulturelle Pluralität Deutschlands, verschiedene religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog und das Hamburger Modell des Religionsunterrichts für alle umfasst. Die Arbeit wird die Chancen und Grenzen der aufgezeigten Modelle kritisch analysieren und die Frage klären, ob interreligiöser Religionsunterricht theologisch zentriert bleibt oder sich zu Religionskunde entwickelt.
Religiös-kulturell pluralistisches Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die religiöse und kulturelle Vielfalt Deutschlands. Es thematisiert die Schwierigkeit, eine eindeutige Definition von „Multi-Kulti-Gesellschaft“ zu finden und stellt die gegensätzlichen Positionen von universalistischer und kulturalistischer Definition gegenüber. Es betont die Bedeutung eines konfliktfähigen und werteorientierten Zusammenlebens verschiedener Religionsgruppen in einem säkularen Staat, wobei die Religionsfreiheit eine zentrale Rolle spielt. Die Notwendigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen und gemeinsame Werte zu stärken, wird hervorgehoben.
Religionstheologische Positionen/Modelle zum interreligiösen Dialog: Dieses Kapitel stellt drei religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog vor: Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus. Der Exklusivismus, vertreten beispielsweise von Karl Barth, verneint den Wahrheitsanspruch anderer Religionen. Der Inklusivismus, mit Vertretern wie Karl Rahner, räumt anderen Religionen eine gewisse Heilswahrheit ein, betrachtet die eigene Religion aber als überlegen. Der Pluralismus nach John Hick hingegen betrachtet alle Religionen als gleichwertig und betont den gemeinsamen Heilswillen Gottes. Die Kapitel analysiert die Eignung der jeweiligen Modelle für einen Dialog auf Augenhöhe und thematisiert die jeweiligen Chancen und Risiken.
Schlüsselwörter
Interreligiöses Lernen, Religionsunterricht, religiöse Pluralität, multikulturelle Gesellschaft, interreligiöser Dialog, Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus, Hamburger Modell, Theologie, Religionskunde, Konfliktfähigkeit, Werteorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, insbesondere in Anbetracht der religiös-kulturellen Pluralität Deutschlands. Sie beleuchtet verschiedene religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog und analysiert bestehende Konzepte, mit besonderem Fokus auf das Hamburger Modell. Die Arbeit analysiert kritisch die Chancen und Herausforderungen interreligiösen Lernens im schulischen Kontext und fragt nach der theologischen Zentrierung vs. Religionskunde im interreligiösen Religionsunterricht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die religiöse und kulturelle Pluralität in Deutschland, verschiedene religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog (Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus), das Hamburger Modell des Religionsunterrichts für alle, Chancen und Herausforderungen interreligiösen Lernens sowie die Frage nach der theologischen Zentrierung oder einer Ausrichtung auf Religionskunde im interreligiösen Religionsunterricht.
Welche religionstheologischen Positionen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert drei religionstheologische Positionen zum interreligiösen Dialog: Exklusivismus (z.B. Karl Barth), Inklusivismus (z.B. Karl Rahner) und Pluralismus (z.B. John Hick). Es werden die jeweiligen Ansätze im Hinblick auf ihre Eignung für einen Dialog auf Augenhöhe und die damit verbundenen Chancen und Risiken untersucht.
Was ist das Hamburger Modell und welche Rolle spielt es in dieser Arbeit?
Das Hamburger Modell des Religionsunterrichts für alle dient als Beispiel für ein bestehendes Konzept interreligiösen Lernens. Die Arbeit analysiert dieses Modell im Detail und untersucht dessen Stärken und Schwächen im Kontext der religiösen und kulturellen Pluralität Deutschlands.
Welche Chancen und Herausforderungen des interreligiösen Lernens werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die Chancen und Herausforderungen, die mit interreligiösem Lernen im schulischen Kontext verbunden sind. Dies beinhaltet die Berücksichtigung der religiösen und kulturellen Vielfalt Deutschlands, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theologischen Positionen und die Entwicklung von geeigneten didaktischen Konzepten für den Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur religiös-kulturellen Pluralität Deutschlands, zu religionstheologischen Positionen im interreligiösen Dialog, zum Hamburger Modell, zu Chancen und Herausforderungen interreligiösen Lernens und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und trägt zur Gesamtargumentation bei.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interreligiöses Lernen, Religionsunterricht, religiöse Pluralität, multikulturelle Gesellschaft, interreligiöser Dialog, Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus, Hamburger Modell, Theologie, Religionskunde, Konfliktfähigkeit, Werteorientierung.
- Quote paper
- Julian Bug (Author), 2021, Interreligiöses Lernen in der Schule. Das Hamburger Modell des Religionsunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014492