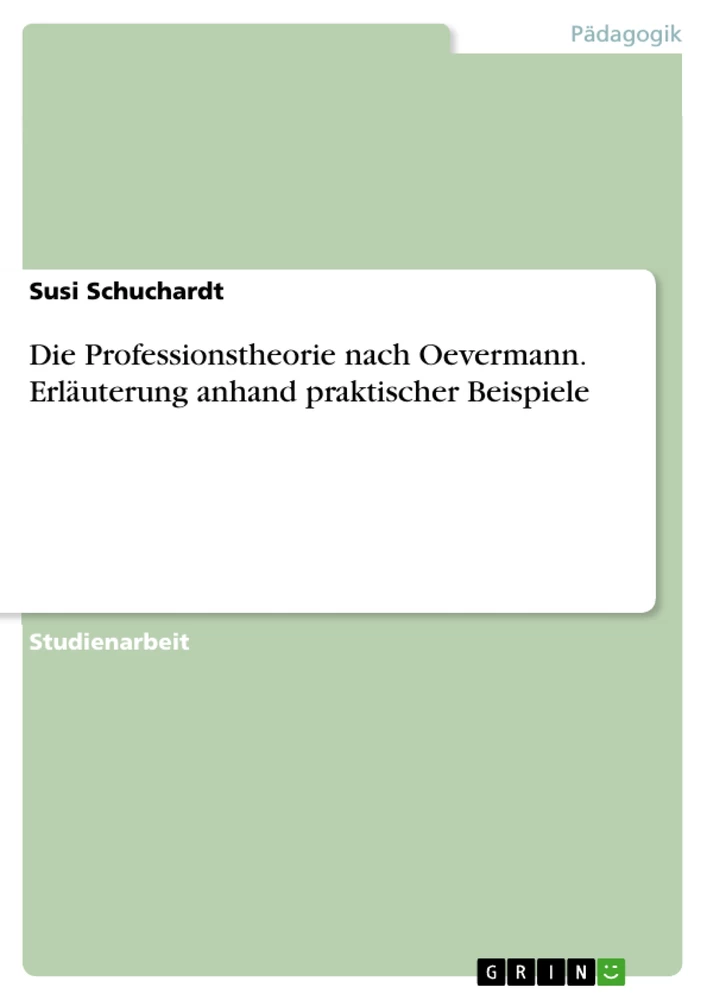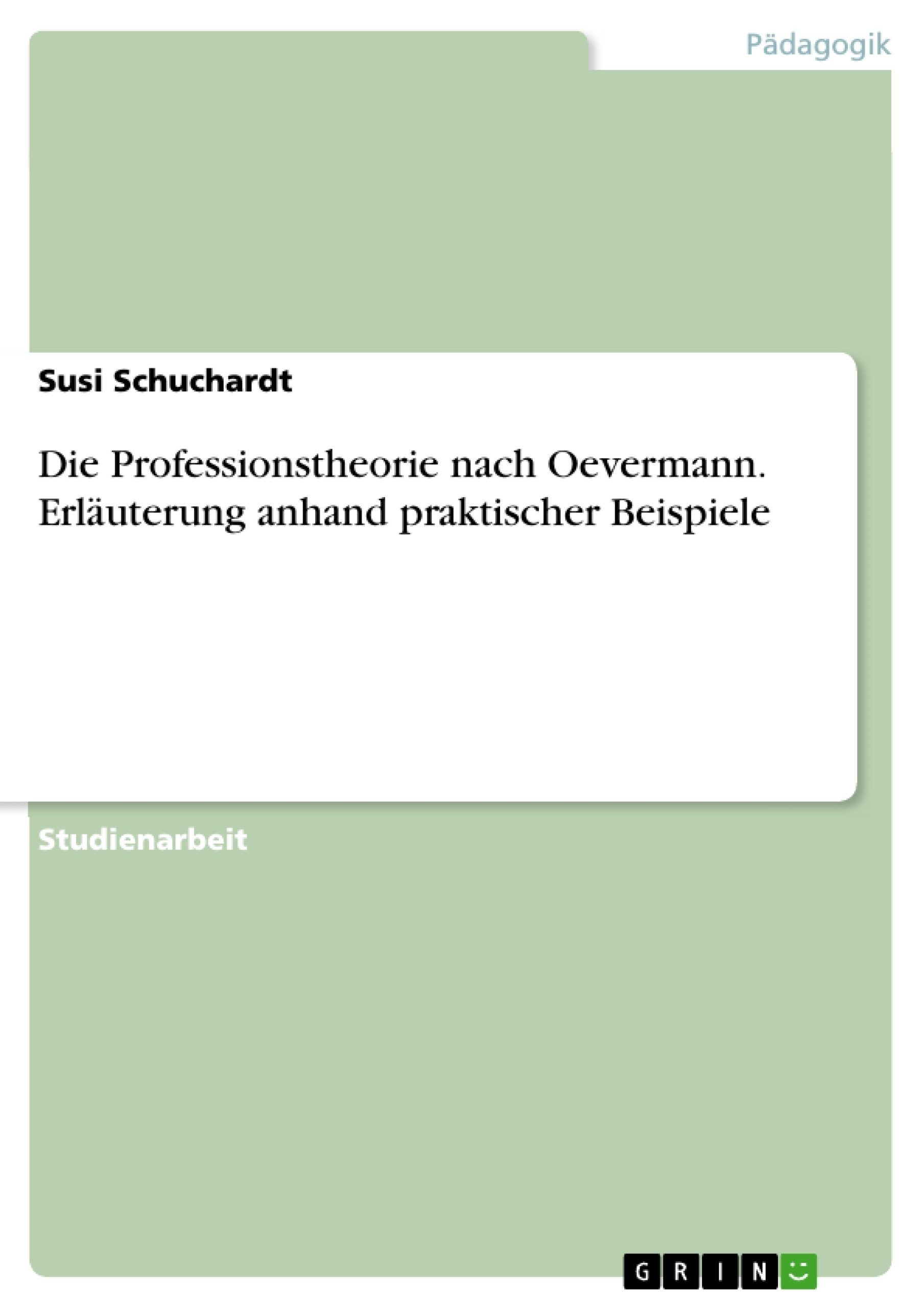Um "Professionstheorien" soll es in dieser Hausarbeit gehen. Verglichen werden soll die Professionstheorie Ulrich Oevermann mit eigener beruflicher Praxis. Dies spiegelt sich in den folgenden Punkten wieder. Zuerst wird der Inhalt Oevermanns Theorie erläutert, danach geht es um die Professionalisierungsbedürftigkeit im pädagogischen Alltag. Im dritten Punkt wird Oevermanns Theorie an alltäglichen Beispielen der Arbeit im Kindergarten und anderen Institutionen verglichen. Aussicht und Schlussfolgerungen finden in Punkt vier Anklang. Zu guter Letzt werden die verwendeten Quellen dieser Hausarbeit aufgezeigt.
Im Studiengang "Bildung und Erziehung von Kindern" wird fundiertes Fachwissen in unterschiedlichen Bereichen der Kindheitspädagogik vermittelt. Zukünftig sollen hiermit ErzieherInnen auf die stetig ansteigenden beruflichen Anforderungen vorbereitet werden. Erlernte Fähigkeiten, die sich in der Arbeit mit Kindern ergeben, entwickeln sich immer weiter und werden stetig komplexer. Um für eine hohe Qualität pädagogischer Praxis in den verschiedenen Einrichtungen zu sorgen, ist es wichtig, dass es eine solche Möglichkeit des Studiums als Weiterentwicklung und Professionalisierung, gibt. Einblicke in alltägliche Problematiken dieses Berufsfeldes werden hierbei genauer beleuchtet und es werden Theorie und Praxis stetig verknüpft. Themen wie Biografie, Forschungsfragen, Diversity Education, wissenschaftliche Denken, Heterogenität und soziale Vielfalt, Sozialtheorien und Professionstheorien sind nur ein kleiner Auszug der Komplexität des berufsbegleitenden Studiengangs.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Professionalisierungsbedürftigkeit
- Professionalisierungsbedürftigkeit der pädagogischen Praxis
- Kriterien für eine Profession
- pädagogischer Alltag im Vergleich zu Oevermann
- Aussicht und Schlussfolgerung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept der Professionalisierung in der pädagogischen Praxis, insbesondere im Kontext der Theorie von Ulrich Oevermann. Sie untersucht, wie Oevermanns Theorie die professionelle Praxis in Bereichen wie Kindergarten und anderen Bildungseinrichtungen beleuchtet.
- Die Professionalisierungsbedürftigkeit in der pädagogischen Praxis
- Die Kriterien und Anforderungen einer professionellen pädagogischen Tätigkeit
- Die Anwendung der Theorie von Ulrich Oevermann auf den pädagogischen Alltag
- Die Rolle der Krisenbewältigung in der Professionalisierung
- Die Verknüpfung von Theorie und Praxis in der pädagogischen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert die Bedeutung der Professionalisierung in der pädagogischen Praxis. Das zweite Kapitel befasst sich mit der allgemeinen Professionalisierungsbedürftigkeit und stellt die Theorie von Ulrich Oevermann vor. Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Kriterien, die einen Beruf zu einer Profession machen und analysiert, wie Oevermann die Rolle der Krisenbewältigung in diesem Prozess betrachtet.
Im dritten Kapitel wird die Professionalisierungsbedürftigkeit der pädagogischen Praxis im Detail betrachtet. Es werden die zentralen Elemente der Theorie von Oevermann auf die spezifischen Herausforderungen des pädagogischen Alltags angewendet. Hierbei werden die Bedeutung der somato-psycho-sozialen Integrität und die Rolle des Pädagogen im Bildungsprozess beleuchtet.
Schlüsselwörter
Professionalisierung, Pädagogische Praxis, Theorie von Ulrich Oevermann, Krisenbewältigung, Somato-psycho-soziale Integrität, Bildungsprozess, Stellvertretende Krisenbewältigung, Kindergarten, Bildungseinrichtungen, Professionsethos, Expertise, Interaktionssysteme, Nicht-Standardisierbarkeit.
- Quote paper
- Susi Schuchardt (Author), 2019, Die Professionstheorie nach Oevermann. Erläuterung anhand praktischer Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006986