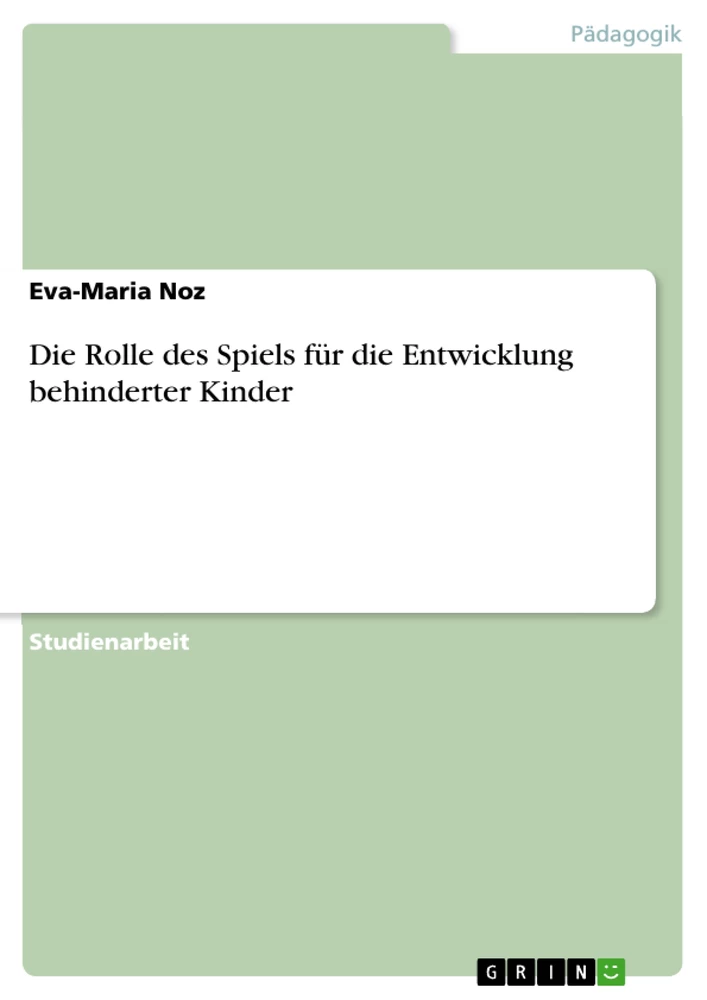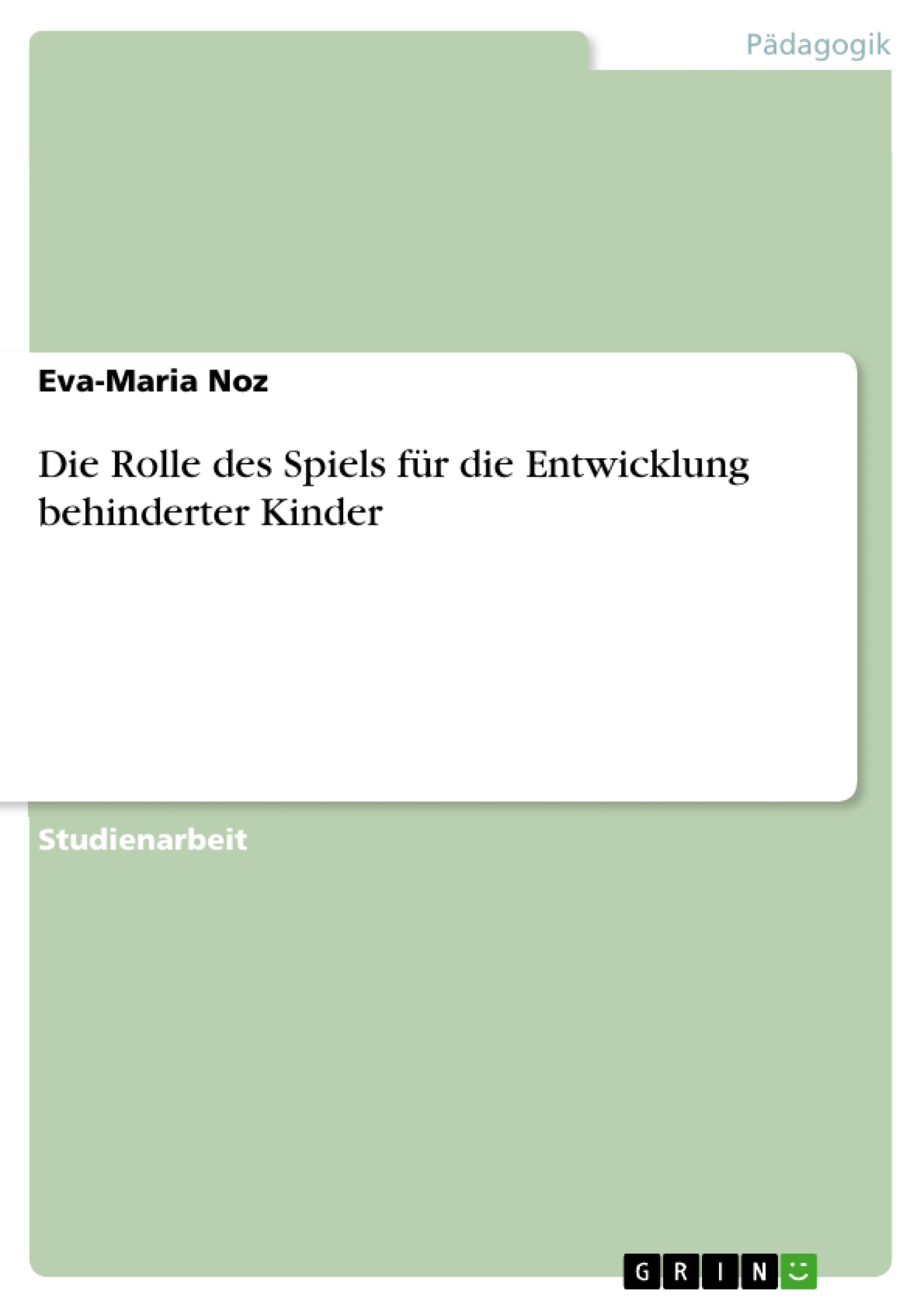Vergessen Sie alles, was Sie über das Spielen zu wissen glaubten! Dieses Buch enthüllt eine faszinierende Welt, in der das Spiel weit mehr ist als blosser Zeitvertreib – es ist ein fundamentaler Baustein der Entwicklung, insbesondere für Kinder und Erwachsene mit Lernschwierigkeiten oder geistiger Behinderung. Tauchen Sie ein in eine umfassende Analyse der verschiedenen Spielformen, vom Funktionsspiel über das Konstruktions- und Rollenspiel bis hin zum Regelspiel, und entdecken Sie, wie diese scheinbar einfachen Aktivitäten kognitive Fähigkeiten fördern, soziale Kompetenzen stärken und emotionale Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen. Anhand konkreter Beispiele und fundierter Erkenntnisse wird aufgezeigt, wie das Spiel als Brücke zur Welt dienen kann, indem es Menschen mit besonderen Bedürfnissen ermöglicht, ihre Umwelt zu erforschen, Beziehungen aufzubauen und ihre eigene Identität zu entwickeln. Erfahren Sie, wie Rollenspiele Ängste mildern, Konstruktionsspiele die Handgeschicklichkeit verbessern und Regelspiele die soziale Anpassungsfähigkeit schulen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Pädagogen, Therapeuten, Eltern und alle, die verstehen möchten, wie das Spiel als kraftvolles Instrument zur Förderung von Inklusion, Selbstbestimmung und Lebensqualität eingesetzt werden kann. Es beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die sich im Spiel mit lernbehinderten und geistig behinderten Menschen ergeben, und bietet praktische Anleitungen zur Gestaltung von Spielräumen und zur Auswahl geeigneter Spielmaterialien. Lassen Sie sich inspirieren von der transformativen Kraft des Spiels und entdecken Sie neue Wege, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihnen ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Ein Augenöffner, der die Bedeutung des Spielens neu definiert und das Potential jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Dieses Werk ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich für Sonderpädagogik, inklusive Bildung und die Förderung von Menschen mit Behinderungen interessieren. Es vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern bietet auch zahlreiche praktische Anregungen für die Gestaltung von Spielsituationen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Spielenden abgestimmt sind. Die Diskussion um die Effektivität von Rollenspielen sowie die kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des Spiels in der Therapie und Pädagogik machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fachkräfte und Angehörige. Es ermutigt dazu, das Spiel als Chance zu begreifen, Vorurteile abzubauen, Inklusion zu fördern und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu verbessern. Die detaillierte Analyse der verschiedenen Spielformen und ihre Bedeutung für die Entwicklung sowie die praktischen Tipps zur Spielraumgestaltung und Materialauswahl machen dieses Buch zu einem umfassenden und praxisorientierten Ratgeber.
Inhaltsverzeichnis
1. Begriffsbestimmungen
1.1 Das Spiel als Phänomen
1.2 Das Funktionsspiel
1.3 Das Konstruktionsspiel
1.4 Das Symbol- oder Rollenspiel
1.5 Das Regelspiel
2. Zum Verhältnis von Spielen und Lernen
3. Das Spiel bei lernbehinderten Kindern (am Beispiel Rollenspiel)
3.1 Die zentrale Funktion des Rollenspiels im Sozialisationsprozess lernbehinderter Kinder
3.2 Kompensatorische und emanzipatorische Funktion des Rollenspiels
3.3 Kritische Diskussion der Effektivität von Rollenspielen
4. Das Spiel bei Menschen mit geistiger Behinderung
4.1 Das Funktionsspiel
4.2 Das Konstruktionsspiel
4.3 Das Rollenspiel
4.4 Das Regelspiel
4.5 Der pädagogisch-therapeutische Einsatz des Spiels
5. Angebot der Spiele und Spielmittel
6. Spielraumgestaltung
7. Literaturhinweise und Quellen
1. Begriffsbestimmungen
1.1 Das Spiel als Phänomen
Das Spiel an sich ist als Phänomen so bedeutend, dass bereits die Philosophen des Altertums darüber nachsinnten. Hinter der Erkenntnis, dass Menschen aller Zeitalter und Kulturen spielten, verbirgt sich die Frage: Was veranlasst sie zu dieser Art des Tätigseins? Längst weiß man, dass Spielen kein sinnloser Zeitvertreib ist, sondern es gilt heute als nützliche Beschäftigung für Jung und Alt, denn es fördert Lernprozesse, es trägt zur Entspannung und zur Unterhaltung bei und dient außerdem auch noch der Geselligkeit. Damit nicht genug: Charakteristisch scheint beim Spiel zunächst eine spezifische Freiheit zu sein. Spielt der Mensch, so ist er frei von Notwendigkeiten und frei von existentiellen Bedrohungen. Das Spiel als freiwillige Tätigkeit ist seinerseits zweckfrei in dem Sinne, als es nicht zur Lebenssicherung oder einem Lernziel dienen muss. Mag der spielende Mensch mit seiner Tätigkeit auch ein bestimmtes Ziel verfolgen oder mag sich dieses Spiel als sehr nützlich erweisen, so ist es dennoch nicht möglich, den Sinn des Spielens von diesen Ergebnissen her zu bestimmen.
Das Spiel bleibt wesentlich frei und wird zerstört, wenn man versucht, es zu funktionalisieren. Im Spiel können sowohl vitale als auch schöpferische Kräfte des Menschen ihren lustvollen Ausdruck finden. Gerade das bereits erwähnte zweckfreie Tätigsein erfüllt den Menschen mit Spannung und Freude.
Zweckfreiheit bedeutet aber auch, dass der Mensch offen ist für die Gestaltungsmöglichkeiten, die ihm das jeweilige Material und die jeweilige Situation bieten; er erlegt ihnen keinen äußeren Zweck auf, sondern überlässt sich dem augenblicklichen Prozess, welcher durchaus auch formulierten Regeln gehorchen kann.
Diesem Geschehen widmet der Mensch während des Spiels seine ganze Aufmerksamkeit, sein Denken, Wollen und Handeln, sein Fühlen und seinen Ernst.
Das Spiel erfüllt den ganzen Menschen, da er dabei alle seine Kräfte einsetzt.
1.2 Das Funktionsspiel
Als Funktionsspiel bezeichnet man die erste Art, in der das Kind spielt. Es ist eng mit der sensumotorischen Entwicklung verbunden.
Das Funktionsspiel beinhaltet lustvolle Erprobungen der eigenen körperlichen Fähigkeiten und das Erforschen von Gegenständen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Das Kind vollzieht solche Spielvorgänge, um die Freude zu erleben, wie etwas „funktioniert“ und um der zweckfreien, spielerischen Aneignung dieser „Funktion“ willen.
Lustbetonte Bewegungen kann man beim Säugling schon ab dem dritten Lebensmonat beobachten, er wiederholt diese stets langsam und mehrfach. Die Bewegungen beschränken sich zunächst auf die Finger und Hände, nach und nach beziehen sie dann aber den ganzen Körper mit ein.
Mit der Entwicklung des Greifens werden Gegenstände zu Auslösern der Bewegungslust: Das Kleinkind greift nach der Rassel, schüttelt und rüttelt sie, schlägt sie auf eine Unterlage, führt sie zum Mund und leckt an ihr. Hierauf folgt bald auch das Stoßen, Ziehen, Werfen und Aneinanderschlagen.
Im zweiten Lebensjahr schließlich erweitert das Kind seine Fähigkeiten: Es räumt Gegenstände aus und ein, hält sie aneinander, steckt sie ineinander und stellt sie auch aufeinander. Das Kind übt so Bewegungsfunktionen, sammelt aber auch gleichzeitig Gegenstandserfahrung.
Im ersten Lebensjahr werden Bewegungsmöglichkeiten erprobt, ganz unabhängig von der Art des Spielzeuges und die verschiedenen Eigenschaften der Materialien erfahren. Ab der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres benutzt das Kind nun Materialien in spezifischer Weise: Im Sand schaufelt es, mit Klötzen baut es und mit Stiften kritzelt es. Das Kind lernt so die Beschaffenheit der es umgebenden Dinge besser kennen und lernt gleichzeitig, sie funktionsgerecht zu benutzen.
Seine motorischen Fähigkeiten übt es ebenfalls weiterhin im Funktionsspiel: Angetrieben durch die Funktionslust und nicht etwa nur durch ungesteuerten Bewegungsdrang oder die Notwendigkeit der Übung dreht es sich um die eigene Achse, läuft und springt es und versucht, Dreirad zu fahren. Entsprechendes gilt für viele gesellige Bewegungsspiele wie etwa das Fangenspiel, Wettrennen, Völker- und Fußball.
Im Schulalter verliert das Funktionsspiel mehr und mehr an Bedeutung, ganz aufgegeben wird es aber nie. Selbst bei Erwachsenen findet man es, wenn auch oft verborgen, in sportlichen Aktivitäten. In Reinform erscheint es aber auch, insbesondere, wenn sie versuchen, sich neue motorische Fähigkeiten anzueignen oder plötzlich völlig unbekannte Gegenstände handhaben sollen.
1.3 Das Konstruktionsspiel
Gegen Ende des zweiten Lebensjahres gewinnt das kindliche Spiel allmählich eine neue Dimension: Hantierte das Kind zunächst mit den Gegenständen aus reiner Funktionslust, so beginnt es nun, aufgrund seines wachsenden Vorstellungsvermögens und Symbol- verständnisses, planvoll zu handeln. Das Ziel des Kindes ist, nicht mehr nur funktionale Wirkung (Sand aufhäufen, Klötze aneinanderlegen) zu erzielen, sondern handelnd etwas Bestimmtes herzustellen, beispielsweise, einen Turm oder eine Sandburg. Das Ergebnis soll einem vorgestellten Modell ähneln. In diesem Stadium erweitert sich die Freude an der Betätigung durch die Freude am Produkt. Nun ist die Stufe des Konstruktionsspiels erreicht. Das Charakteristische am Konstruktionsspiel ist, dass das Kind vor dem Spiel äußern kann, was es herstellen möchte, dass es sein Vorgehen plant, entsprechend durchführt und ein Produkt anfertigt, das dem Modell ähnlich ist, indem es einige wesentliche Merkmale des Modells aufweist. Je einfacher das Spielmaterial ist, desto eher erfüllen die Produkte alle Bedingungen des Konstruktionsspiels.
Im dritten Lebensjahr backt das Kind dann Sandkuchen oder baut einfache Türme aus wenig Elementen. Diese anfänglichen „Erzeugnisse“ stellen eine Übergangsstufe zwischen Funktions- und Konstruktionsspiel dar. Das Kind übt aus reiner Funktionslust den Umgang mit den Materialien. Mehr oder weniger zufällig gelingt es ihm, beispielsweise dem Sand eine bestimmt Form zu verleihen oder mehrere Bauklötze aufeinander zu schichten. Im nachhinein, vielleicht auf die Frage der Eltern hin oder als Wiederholung deren Deutung, bezeichnet das Kind ein Produkt dann als „Kuchen“ oder „Turm“. Oder es wird aufgefordert: „Bau doch einen Turm“, und das Kind setzt einige Steine aufeinander. Auf diese Weise lernt es nach und nach, seine Vorstellungen mit in die Handlung einzubeziehen und zu planen. Im vierten Lebensjahr schließlich baut das Kind dann größere Gebilde und beginnt, mit Knetmasse einfache, aber geplante Objekte zu formen.
Im fünften Lebensjahr entstehen erste erkennbare Zeichnungen (oft Menschen oder Häuser), das Kind fängt an, eine Schere zu benutzen und seine Bauvorhaben werden komplizierter. Das Kind plant Projekte, deren Durchführung sich über mehrere Tage erstreckt.
Es beginnt, mit Gleichaltrigen an einem gemeinsamen Vorhaben zu arbeiten.
Die weitere Ausdifferenzierung aller Konstruktionsspielformen findet im sechsten und siebten Lebensjahr statt. Das Kind baut im Freien mit Vorliebe Hütten, es verwendet Spielsachen, die mehr und mehr technisches Verständnis erfordern und oftmals kombiniert es Bauvorhaben mit Rollenspielen.
Auch das Konstruktionsspiel wird nie ganz aufgegeben. Mit Beginn der Pubertät nimmt es mehr und mehr ab, viele Freizeitbeschäftigungen von Erwachsenen aber haben den Charakter von Konstruktionsspielen: Technische Basteleien oder das Entwerfen und Anfertigen von Handarbeiten.
Das Konstruktionsspiel leistet zwei wichtige Dinge für die kindliche Entwicklung: Zum einen den Zuwachs an Handgeschicklichkeit und Materialerfahrung (physikalisches Erfahrungswissen), zum anderen lernt das Kind, planvoll und im Hinblick auf das Produkt zu handeln, dadurch nehmen seine Konzentrationsfähigkeit und seine Ausdauer zu. Ist das Kind bereit, eine selbstgestellte Aufgabe über einen längeren Zeitraum hinweg durchzuführen, so hat es die nötige Arbeitshaltung erworben, die für die Schulfähigkeit vorausgesetzt wird.
1.4 Das Symbol- oder Rollenspiel
Ebenfalls gegen Ende des zweiten Lebensjahres entwickelt das Kind noch eine dritte Art zu spielen: Das Symbolspiel. Bei dieser Art des Spieles symbolisiert ein Gegenstand einen anderen: Blätter sind die „Speisen“, der Teddybär ist das „Kind“. Durch das Spiel versucht das Kind, die mütterliche Tätigkeit nachzuahmen und den Teddy zu füttern. Es schlüpft also in eine andere Rolle und weist anderen Gegenständen oder Personen ebenfalls Rollen zu. Die wachsende Vorstellungskraft ermöglicht dem knapp zweijährigen Kinde, die dem Symbolspiel charakteristische Haltung des „So-tun-als-ob“ einzunehmen. Es legt sich beispielsweise auf das Sofa und „tut so, als ob es schliefe“. Im Sandkasten rührt es den Sand im Eimer um wie die Mutter das Essen im Kochtopf. In dieser Übergangsform zum Symbolspiel schlüpft das Kind noch nicht in die fremde Rolle, es „ist“ beim „Kochen“ noch nicht die Mutter. Doch schon wenig später nimmt es den Teddy und „füttert“ ihn; dabei fühlt es sich als Mutter, der Teddy ist das Kind. Dabei spricht das Kind mit dem Teddy, während es die einfachen, ihm bekannten Handlungen des täglichen Lebens nachahmt. Mit drei bis vier Jahren erreicht das kindliche Rollenspiel seinen Höhepunkt. Nun setzt das Kind alles, was ihm in den Sinn kommt, in Rollenspiele um. Dabei braucht es die Nachahmung der Alltagssituationen immer weniger, diese benutzt es nur noch, um daraus die phantastischsten Geschichten zu entwickeln.
Das Kind kann in dieser Stufe zumindest im Nachhinein Vorstellungswelt und Realität unterscheiden, auch wenn es ganz und gar in seiner Rolle aufzugehen scheint. Bei fünf- bis siebenjährigen Kindern stehen gemeinschaftliche Rollenspiele mit traditionellen sozialen Inhalten wie Familie, Kaufladen, Schule und Einkaufen hoch im Kurs. Dabei entnehmen sie ihre Ideen gehörten und gesehenen Geschichten, die in der Phantasie beliebig weiterentwickelt werden.
Eine Theatervorführung bildet den krönenden Abschluss des Rollenspiels im Grundschulalter. Dabei spielt der äußere Rahmen mit Entrittskarten, Verkleidung und Zuschauern für die Darbietung an sich eine bedeutende Rolle.
Hat ein Erwachsener das Rollenspiel nicht aufgrund einer besonderen Vorliebe zum Inhalt seines Berufes oder einer Freizeitbeschäftigung gemacht, so hat für ihn das Rollenspiel seine Bedeutung verloren.
Das Rollenspiel hilft dem Kind bereits in seiner einfachen, mehr aber noch in seiner komplexeren Form, seine Erlebnisse und Erwartungen, seine Wünsche und Ängste auszudrücken und seine Erfahrungen zu verarbeiten. Es wiederholt bereits Geschehenes und prägt es sich dadurch ein. Das Kind erhält im Rollenspiel die Chance, Ängste durch die Übernahme der überlegeneren Position zu mildern. Indem das Kind in fremde Rollen schlüpft, erlebt es durch die Identifikation mit der Rolle die mit ihr verbundenen Gefühle. Es lernt gleichzeitig, sich in andere Personen hineinzuversetzen und überwindet so allmählich seine egozentrische Perspektive. Mit der Übernahme verschiedener Rollen übt es sogleich sein Sozialverhalten, es erlebt sich dabei ja zum Beispiel als Mutter, Vater, Geschwister, Freund, Lehrer. Damit leistet das Rollenspiel auch einen wichtiges Beitrag zur Gemeinschaftsfähigkeit des Kindes.
1.5 Das Regelspiel
Die Entwicklung des anschaulichen Denkens und die beginnende Gruppenfähigkeit sind Voraussetzungen für die vierte Grundform des Spiels: Das sogenannte Regelspiel. Diese Art des Spielens ist gekennzeichnet durch selbst erdachte oder bereits vorgegebene Regeln, denen sich das Kind um des Spielens willen freiwillig unterwirft. Die Regeln begrenzen zunächst den Handlungsspielraum, das heißt, sie legen fest, welches Verhalten in welcher Reihenfolge unter welchen Bedingungen erfolgen soll. Sie definieren außerdem ein von den Spielteilnehmern zu erreichendes Ziel und ernennen den erfolgreichsten Mitstreiter zum Sieger. Kennzeichnender Weise enthält das Regelspiel Wettbewerbselemente.
Die Aufgabe der Spielregeln besteht darin, das Spielverhalten zu strukturieren, werden sie gebrochen, so ist der Spielverlauf gestört. Im Gegensatz zu der immanenten Spielordnung der bisher besprochenen Grundformen des Spiels werden die Regeln des Regelspiels klar formuliert. Sie untersagen geradezu die für andere Spielsarten typische Spontaneität und schränken das Verhalten auf wenige Handlungselemente ein. Die Regeln ermöglichen so zwar das Erleben von Gemeinsamkeit und Gleichheit, die jedoch wird durch den Wettbewerbscharakter zugleich wieder aufgehoben, denn es gibt ja Sieger und Verlierer. Im dritten Lebensjahr beginnt das Kind, für sich beim Spielen eigene Regeln aufzustellen, die es für eine gewisse Zeit befolgt. Es vermeidet beispielsweise das Betreten der Fugen zwischen zwei Platten auf der Strasse. In diesem Stadium spielen weder der Gemeinschafts- noch der Leistungsaspekt eine Rolle. Etwa mit dreieinhalb Jahren erwacht beim Kind die Leistungsmotivation. Es erkennt nun etwa beim Memory-Spiel den Wettbewerbscharakter und möchte gewinnen. Misserfolge verkraftet es nicht; um sie zu vermeiden, bricht es gegebenenfalls das Spiel ab, leugnet sein Versagen oder schiebt die Schuld auf äußere Umstände (es attribuiert external). Es kommt vor, dass es auf andere, „ausgleichende“ Fähigkeiten hinweist.
Im fünften Lebensjahr spielt das Kind gerne in kleinen Gruppen und fängt an, sich vorgegebenen Spielregeln unterzuordnen. Es rechnet zwar mit der Möglichkeit zu verlieren, aber nach wie vor bedeutet dies eine große emotionale Belastung. Im sechsten Lebensjahr dann gewinnt das Regelspiel immer mehr an Bedeutung und im Schulalter übertrifft dessen Beliebtheit dann alle anderen Spielarten. Wenden sich Erwachsene in ihrer Freizeit einem Spiel zu, so handelt es sich dabei zumeist um Regelspiele.
Zu den einfacheren Regelspielen gehören die organisierten Bewegungsspiele (z.B. das Versteckspiel) und leichte Gesellschaftsspiele wie Memory, Domino und erste Brettspiele. Sie werden bereits im Vorschulalter beherrscht. Diese einfachen Regelspiele lassen zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass ihr Ausgang weitgehend vom Glück des einzelnen Mitspielers abhängt, der individuellen Initiative wenig Spielraum.
In den ersten Grundschuljahren lernt das Kind dann die anspruchsvolleren Varianten dieser Art des Spielens. Mit etwa acht bis zehn Jahren erobert es sich auch die komplexeren Formen der Regelspiele: Mannschaftsspiele (wie Fußball) und die komplizierten Brett-, Karten- und Kombinationsspiele (z.B. Canasta, Schach, Scrabble). Diese komplexeren Formen ermöglichen dem Kind, innerhalb des vorgegebenen Rahmens seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten vielfältig zu schulen und gegebenenfalls diese in den Dienst einer Mannschaft zu stellen. Zusammenfassend betrachtet übt das Kind im Regelspiel seine soziale Anpassungsfähigkeit. Es stellt eigene Impulse zugunsten der Gemeinschaft zurück, es erreicht mit Hilfe seiner Fähigkeiten unter Umständen einen guten Rangplatz, etwa durch Konzentrations-, Kombinations- oder Entscheidungsfähigkeit. Dabei übt es Rücksicht und Loyalität und lernt schließlich auch zu verlieren.
2. Zum Verhältnis von Spielen und Lernen
Nach A. Flitner ist es zwar nicht möglich, einen direkten Zusammenhang zwischen Lernen und Spiel herzustellen, er nennt aber folgende Teilqualifikationen, die durch das Spiel gefördert werden können und die Konsequenzen für das Kind haben:
1. Durch das Spiel erfährt das Kind einen Zuwachs an sensumotorischem Können, an Auffassung und Geschicklichkeit. Dieser lässt sich als Erleben von Persönlichkeitszuwachs interpretieren.
2. Die Beherrschung von Spielen und ihrer Regeln kann Kindern ermöglichen, wesentlich leichter Anschluss an andere Kinder zu finden.
3. Kreative Fähigkeiten wie Ausdrucksfähigkeit und Erfindungsgabe können durch bestimmte Spiele (z.B. Rollenspiele) gefördert werden. So ist es auch wichtig, dass im Unterricht Spiele eingesetzt werden, um den Einschränkungen und Verarmungen, die der Schulalltag mit sich bringen kann, entgegenzuwirken.
4. M. Almy betont, dass das freie Spiel eine unentbehrliche Funktion für die Kognitive Entwicklung habe, da Kinder diejenige Erfahrungen machen können, die ihren Interessen und Realitätserfahrungen entsprechen.
5. Aufgrund diverser Untersuchungen von S. Smilansky, von P.V. Gump und anderen ist anzunehmen, dass sich im Spiel häufig Gelegenheiten für soziales Lernen bieten. Dabei ist aber nicht davon auszugehen, dass sich Probleme sozialer Integration von selbst lösen. Es ist die Aufgabe des Erziehenden, ein soziales Klima zu schaffen, in dem Kinder gerne spielen, in dem sie lernen, Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.
Der Zusammenhang von Spielen und Lernen lässt sich nicht nur anhand von eventuell erreichbaren Teilfähigkeiten belegen, er gibt vor allem Anstoß für didaktische Überlegungen.
H. Retter sieht die didaktische Funktionen des Spiels in „der Erreichung relativ eng umgrenzter operationalisierbarer Lernziele; der Entlastung von Affektstauen und einseitig beanspruchenden Arbeits- bzw. Lernsituationen; dem experimentierenden, bewusstseinserweiternden Handelns, soweit dies in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt wird“.
Benutzt ein Lehrer Spiele in der Absicht, Schülern bestimmte Lerninhalte zu vermitteln, so beschränkt er sich auf die erste der oben genannten Funktionen. Die dritte Funktion aber ist eine Art emanzipatorische Bestrebung: Schüler können sich so von ihrer „Adressaten-Rolle“ distanzieren und relativ autonom handeln.
Spiel ist in dieser Funktion kein Instrument zur Vermittlung von Lerninhalten; der Unterricht selbst stützt sich auf spielerische Momente, wie zum Beispiel experimentierendes Handeln, Rollenfunktion und spannungsreiche Situationen.
Eine solche Vorgehensweise würde die Chance enthalten, die anthropologische Unterscheidung zwischen Arbeit und Spiel zu überwinden, die teilweise bis heute für die Sozialisation in manchen Gesellschaften kennzeichnend ist.
3. Das Spiel bei lernbehinderten Kindern (am Beispiel Rollenspiel)
3.1 Die zentrale Funktion des Rollenspiels im Sozialisationsprozess lernbehinderter Kinder
Lernbehinderte Kinder und Jugendliche zeigen neben anderen charakteristischen Merkmalen oft eine Art der Auffälligkeit, die als „das Erkennungsmerkmal“ für die Lernbehinderung gilt: Ein auffälliges Sozialverhalten. Diese Kinder zeigen verzögerte soziale Reife, verminderte Kooperation, sie haben eine erhöhte Neigung zu Regressivität wie Aggressivität, vermehrte Gehemmtheit wie auch Hemmungslosigkeit, geringe Distanziertheit, die Bewältigung sozialer Situationen und die Rollenübernahme- und Bewältigung fällt ihnen sehr schwer. In allen Bereichen sind diese genannten Unzulänglichkeiten vielfach anzutreffen, jedoch bestehen erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten bei entsprechender sonderpädagogischer Zuwendung und durch geeignete Trainingsverfahren. Zum Teil lassen sich so auch Entstehung oder Ausweitung dieser Mangelzustände vorbeugend verhüten. An diesem Punkt zeigt nun das Rollenspiel entscheidende Wirkung:
Die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes geht stets mit der zunehmenden Beweglichkeit der kindlichen Spiele einher. Die Persönlichkeitsentwicklung lässt sich tiefenpsychologisch verstehen als eine - bei lernbehinderten Kindern oftmals gestörte - Ausbalancierung kindlicher Bedürfnisse mit sozialen Anforderungen. Indem Rollenspiele spannungsreiche Situationen reproduzieren, bewirken sie nicht selten eine Spannungsabfuhr, schaffen Aggressionen freien Lauf, lassen unerfüllte Wünsche im Spiel ausbrechen und neue Lösungen für unbewältigte Probleme spielerisch vorwegnehmen.
Aus der Fülle der Funktionen, die den kindlichen Spieltätigkeiten zukommen, sind vor allem zu nennen:
- Die spielerische Vorwegnahme sozialer Rollen und deren Veränderungsmöglichkeit im Rollenspiel (Rollenrepertoire, Rollenveränderung)
- Eine Harmonisierung und Ausformung der Persönlichkeit (Verhaltenstherapie, -korrektur)
Das Rollenspiel als wesentlicher Mechanismus der Entwicklung zum Sozialverhalten - natürlich vor allem bei behinderten Kindern, die Auffälligkeiten im Sozialverhalten zeigen - findet seine instrumentelle Verwendung als „intentionales Spiel“ in der Pädagogik als „Unterrichtsspiel“, in der Therapie als „Heilspiel“ und „Psycho- und Soziodrama“, und in der Diagnostik als „Spieltest“. Dabei übernimmt das intentionale Spiel die Funktionen der Integration in gesellschaftliche Gegebenheiten sowie die Kompensation für Vermissungserlebnisse im Sozialisationsprozess.
Die therapeutische und diagnostische Verwendung des (Rollen-)Spiels basieren auf psychoanalytischen Erkenntnissen. So sollen im (Rollen-)Spiel, ähnlich wie im Traum, verdrängte Konflikte in Form von Verdichtung, Verschmelzung und Symbolbildung zu Tage treten.
Im Sceno-Test beispielsweise wird vom Therapeuten der spielerische Umgang des Kindes mit Figuren und Gegenständen beobachtet. Er zieht daraus mögliche Rückschlüsse über konfliktgeladene Ergebnisse des spielenden Kindes, die eventuell als Ursache für dessen Verhaltensstörungen gesehen werden können.
Beim therapeutischen, heilpädagogischen Spiel steht die Kompensationsfunktion des Spiels im Vordergrund. Auch hier soll im Spiel eine Konfliktfreilegung, zusätzlich aber eine „Befreiung, Lösung oder Heilung“ durch Aggressionsentladung und Kompensation für erlittene Repressionen stattfinden.
Es ist zu erkennen, dass durch das Rollenspiel dem Entstehen von Störungen vorzubeugen ist, dass bereits vorhandene Störungen durch das Rollenspiel verglimpflicht werden können und dass Versäumnisse in früheren Phasen des Sozialisationsprozesses durch Rollenspiele kompensiert werden können.
Definiert man nach Nickel, so würde das bedeuten:
Rollenspiel bezeichnet die spontane oder angeleitete szenische Darstellung realer Interaktionssituationen mit dem didaktischen Ziel, die in Interaktionen vorhandenen Strukturen zu erkennen und in „dialektischen Rollenspiel“ kommunikativ zu verändern.
Interaktive Kompetenz als Voraussetzung sozialen Rollenhandelns herausgestellt, müsste demnach durch Spielen fiktiver Rollen anzustreben sein. So sieht die Interaktionspädagogik im Rollenspiel einen Lernmechanismus zur Erlangung von Grundqualifikationen sozialen Handelns.
Lernbehinderung unter dem Aspekt einer unzulänglichen Interaktionsfähigkeit ließe sich demnach durch Rollenspiel positiv beeinflussen.
3.2 Kompensatorische und emanzipatorische Funktionen des Rollenspiels
Zunächst ist zu erwähnen, dass das Rollenspiel in hohen Maße einen Beitrag zu kognitivem Lernen leisten kann; Voraussetzung ist dabei allerdings, dass Lernen nicht allein als Vermittlung von fertigem Wissen oder Fertigkeiten verstanden wird. Kognitives Lernen meint hier vielmehr den Erwerb von Fähig- und Fertigkeiten in der Form von Wissen und Begriffen, den Erwerb von Strategien der Auseinandersetzung mit Problemen, die Förderung von logischem, schlussfolgerndem und kausalerklärendem Denken und nicht zuletzt den Gebrauch der Sprache als Mittel zu Problemlösung und Kommunikation.
Denn kognitive Prozesse laufen nicht nur in Auseinandersetzung mit sachlichen Gegebenheiten, sondern ebenso bei der Bewältigung von Interaktionsproblemen ab.
Möglichkeiten der Förderung und Übung kognitiver Prozesse bieten Formen des Rollenspiels in Fülle. Interaktionsübungen - gedacht zur Vorbereitung und Begleitung von Rollenspielen - trainieren unter anderem Wahrnehmungsfähigkeit, Konzentration und Kreativität. Die konzentrierte Beobachtung des Verhaltens anderer, ihrer Gesten, Gebärden und Bewegungen finden sowohl in Ausdrucks- und Wahrnehmungsspielen als auch in Sensibilisierungsübungen statt. Musikalische Klangexperimente, die eine Rollenspielszene begleiten, erfordern eine auditive und rhythmische Wahrnehmungsfähigkeit und Konzentration.
Kreatives, reflexives und problemlösendes Denken wird vor allem bei kooperativen Übungen sowohl gefordert als auch gefördert. Das Gelingen einer Kooperation verlangt ferner Einfühlungsvermögen und Reflexivität des Sprachverhaltens.
Grundsätzlich kompensatorisch wirkt das Rollenspiel, insofern es Grundqualifikationen flexiblen Rollenhandelns vermittelt wie Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz.
Dies meint konkret, dass Kinder:
1. eine Rolle spielen können (Rollenübernahme):
- verstehen, was eine Rolle überhaupt meint (Verhaltenserwartungen der anderen)
- eine Rolle verbal und non-verbal darstellen können (das heißt sprachlich, gestisch, mimisch)
2. über ein großes Rollenrepertoire verfügen (möglichst viele Rollen spielen können):
- informiert sind über die mit einer Vielzahl von Rollen verbundenen Verhaltenserwartungen und Bedürfnisse
- eine Vielzahl von Rollen verbal und non-verbal spielen können
3. vorher übernommene Rollen in Frage stellen, kritisieren und zugrungeliegende Normen reflektieren und deren Veränderbarkeit erkennen können (Rollendistanz):
- eigene Rollen entwerfen, verändern, sie in verfremdeter Mimik, Sprache, Gestik darstellen.
4. in Rollenspielen sowohl eigene Ziele verfolgen als auch sich in anderer Spieler einfühlen können, ihre möglichen Reaktionen vorwegnehmen und entsprechend reagieren können (Empathie):
- die symbolisch vermittelte Kommunikation der Mitspieler wahrnehmen, interpretieren und angemessen reagieren können Kompensatorisch und zugleich emanzipatorisch wirkt das Rollenspiel als Experimentierfeld des Handelns, in dem neue Verhaltensweisen und neue Problemlösungsstile erprobt werden und in dem die interaktive Kompetenz zur Anwendung kommt.
Konkret bedeutet die, dass Kinder:
1. in Konfliktspielen aus ihrem eigenen Erfahrungsbereich verschiedene Lösungsstrategien erproben und fähig sind, unterschiedliche Lösungen und von eigenen Vorstellungen abweichende Entwürfe zu ertragen (Ambiguitätstoleranz)
- einen reflexiven Sprachgebrauch zeigen, fähig sind zur Metakommunikation („mit Sprache über Sprache reden können“) und fähig sind, Interaktionsstörungen, d.h. Diskrepanzen zwischen verbaler und non-verbaler Kommunikation, thematisieren zu können
2. die erworbenen interaktiven Fähigkeiten in realen Konfliktsituationen anwenden können (Bereiche: Schule, Spielplatz ...)
- mit Eltern und Mitschülern über Probleme reden können; undemokratische Situationen (beispielsweise in der Klasse) analysieren und verändern können (Voraussetzung ist hierbei jedoch die intensive Miteinbeziehung der Eltern)
- Diskrepanzen zwischen verbaler und non-verbaler Kommunikation (sogenannte „Beziehungsfallen“) wahrnehmen, deren Ursache und Wirkung ergründen und Offenheit der Kommunikation fordern und zeigen
3.3 Kritische Diskussion der Effektivität von Rollenspielen
Es wurden Versuche gemacht, mit Kindern einer Sonderschule F (einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder) über eineinhalb Jahre Trainingsdauer die interaktive Kompetenz der Schüler über Rollenspiele zu stärken. Die Rollenspiele beeinflussten die interaktive Kompetenz der Kinder der Spielgruppe tatsächlich positiv und waren auch von günstigem Effekt auf lernabweichende Verhaltensmuster in der Klasse.
Dennoch müssen einige, den Erfolg relativierende Einwände gemacht werden:
Das Rollenspiel wird im Schulalltag (einer Sonderschule) - wenn überhaupt - oft nur als Randangebot an den vorhandenen Wochenplan angehängt. Insofern kommt dem Rollenspiel nur eine Entlastungsfunktion eines auf Leistung ausgerichteten Unterrichts, nicht aber eine interaktionspädagogische Lernfunktion zu; daher können auch Ziele komplementären, emanzipatorischen Rollenhandelns nicht konsequent verfolgt werden. Weiterhin scheitern solche Programme zur Förderung von behinderten Kindern durch Rollenspiele oft am mangelnden Interesse der Lehrkräfte, sich zu informieren beziehungsweise sich einschlägig fortzubilden.
Es wurden auch Versuche gestartet, die im gleichen Gebäude untergebrachte Grundschule in das Spielprojekt einzubeziehen. Denn im Hinblick auf die oft diskutierte Problematik von „Lernbehinderten“ als „Abweichler“ von der Norm müsste eine Einbeziehung von Grundschulkindern und -lehrern gerade ein wichtiges Ziel sein. Es bestände doch so eine nahezu ideale Gelegenheit, reale Interaktionssituationen zwischen Normal- und Sonderschülern im Spiel aufzugreifen und ihnen zugrundeliegende Konflikte in Rollenspiel und Reflexion konkret anzugehen, Vorurteile abzubauen und Möglichkeiten einer eventuell gelingenden Kommunikation bereitzustellen. Doch dies erweist sich in der Praxis als geradezu aussichtslos: Schüler beider Schultypen pflegen, sich gegeneinander abzugrenzen, sobald es um gemeinsame Aktivitäten geht.
Rollenspiele sind auch hervorragend geeignet, um Sprachtrainingsprogramme in Form einer „kompensatorischen Spracherziehung“ durchzuführen. Im Deutschunterricht zum Beispiel lassen Rollenspiele eine akzentuierte Berücksichtigung sprachlicher Fähigkeiten zu, insofern die im Rollenspiel erarbeiteten Inhalte und Situationen sprachlich analysiert und weiterbehandelt werden können. Wortschatzerweiterungen, grammatikalische Übungen, Lese- und Rechtschreibübungen könnten so ein stärker auf soziale Komponenten ausgerichtetes Rollenspiel sinnvoll ergänzen.
4. Das Spiel bei Menschen mit geistiger Behinderung
Grundsätzlich hat das Spiel für Menschen mit einer geistigen Behinderung dieselbe Bedeutung wie für die nicht behinderten Menschen. Allerdings wirken sich die behinderungsbedingten Einschränkungen deutlich aus.
4.1 Das Funktionsspiel
Beim Funktionsspiel zeigt sich - je nach Behinderungsgrad mehr oder weniger stark - die Beeinträchtigung darin, dass der Säugling die Bewegungsmöglichkeiten seines Körpers wenig erprobt und mit bereitgestelltem Spielzeug wenig anzufangen weiß. Er tendiert aus diesem Grund dazu, sich entweder deutlich weniger oder aber unruhig und ziellos zu bewegen. Hat er erst einmal eine bestimmte Umgangsweise mit einem Spielzeug für sich entdeckt, so bleibt er in der Regel bei dieser Betätigung und führt sie immer wieder durch. Der Säugling klopft beispielsweise die Rassel immer wieder auf den Boden; neue Handlungsmöglichkeiten findet er nur schwer. Die Assimilations- und Akkomodationsschwäche führt zu wiederholendem, stereotypen Spielverhalten. Auch im späteren Alter tendiert der geistig behinderte Mensch dazu, oft bei bereits erworbenen Handlungsmustern zu verharren, er probiert von sich aus vergleichsweise selten neue Funktionen aus, um diese dann ohne Anregung von außen in sein Fähigkeitsrepertoire aufzunehmen. Eine Spielförderung auf dem Niveau des Funktionsspiels gleich weitgehend der sensumotorischen Förderung.
Die bei schwer geistig behinderten Kindern und Jugendlichen (oft auch bei Erwachsenen) häufig anzutreffenden Bewegungsstereotypien sind - als eine Art des Spiels betrachtet - einfache Funktionsspiele, die auf dem Niveau der primären (= einfache Gewohnheiten) und sekundären (= aktive Wiederholungen) Kreisreaktionen anzusiedeln sind. Sie zeigen, dass der behinderte Mensch in seinen Möglichkeiten zur spontanen Selbstbeschäftigung entweder auf dieser Stufe stehen blieb oder in einer Situation emotionalen Missbehagens (wie Langeweile, Verlassenheitsgefühle) auf sie zurückfällt. Letztere Anmerkung setzt voraus, dass der Betreffende in ihm angenehmen Situationen durchaus in der Lage ist, auf eine differenziertere Weise zu spielen. Das stereotype Spiel, gleich in welchem Niveau durchgeführt, dient nicht mehr der emotionalen und geistigen Entwicklung. Es werden weder neue Sachen entdeckt, noch Erkenntnisse gesammelt, Erfahrungen verarbeitet oder Handlungsweisen ausprobiert. Da sich der Geist fortwährend mit der Wiederholung desselben beschäftigt, ist zusätzlich die Aufnahme neuer Reize gehemmt. Trotz dieser negativen Begleiterscheinungen erfüllt das erstarrte Spiel eine wichtige Funktion der Betätigung, in der sich der behinderte Mensch seiner selbst versichert: er bewegt sich und führt sich so Reize zu, so dass er sich selbst spüren kann, verleiht der leeren, langweiligen Zeit einen Inhalt und gibt sich selbst Sicherheit durch die vertraute Handlung. Auf diese Weise betrachtet muss das stereotype Spiel als Fähigkeit angesehen werden und nicht nur als Ausdruck eines Unvermögens. Man sollte daher nicht versuchen, es zu unterbinden; dies wäre wohl auch schwer möglich, ohne unerwünschte (z.B. aggressive) Verhaltensweisen zu provozieren. Stereotypen sind also entweder zu respektieren oder ist ein Weg zu suchen, der eine Überwindung der Fixierung des Betroffenen und somit eine Weiterentwicklung möglich macht.
Eine Möglichkeit, einem behinderten Menschen aus der Stereotypie zu helfen könnte sein, die immer gleichen Handlungen zu spiegeln: Die Bezugsperson lässt sich auf die festgelegten Muster ein, vollzieht die Bewegungen gemeinsam mit dem behinderten Gegenüber und benutzt sie auf diese Weise als Mittel, mit ihm in Kontakt zu treten. Allein schon das mit Freude erlebte gemeinsame Tun verändert den Charakter der stereotypen Handlung. Nach und nach kann nun die Bezugsperson dazu übergehen, kleine Teile des Handlungsmusters abzuändern. Nimmt der geistig behinderte Mensch diese Veränderungen auf, so ist der erste Schritt zur Loslösung aus der Fixierung geschafft. Häufige Wiederholungen der neuen Variante helfen bei der Integration in das bestehende Muster, weitere Abwandlungen können nun folgen. So verlebendigt sich das gemeinsame Spiel nach und nach.
4.2 Das Konstruktionsspiel
Ähnliches wie das oben zum Funktionsspiel erwähnte gilt auch für das Konstruktions- und das Symbolspiel: es besteht die Tendenz, bei einmal erworbenen Spielformen übermäßig lange zu verharren und diese auch nicht genügend auszudifferenzieren. Es werden immer die gleichen Häuser gebaut oder immer dieselben Symbolspiele durchgeführt. Allzu häufig überfordert sich das behinderte Kind selbst, da es die Grenzen seiner Fähigkeiten noch weniger als ein gesundes Kind abschätzen kann, nimmt es sich Unerreichbares vor. Dabei ist dann der Misserfolg schon vorprogrammiert und sowohl Leistungsmotivation als auch Ausdauer und Frustrationstoleranz werden sehr ungünstig beeinflusst. Deshalb braucht das behinderte Kind sehr viel einfühlsame Unterstützung bei seinem Konstruktionsspiel. Es ist die Aufgabe der betreuenden Person, mit dem behinderten Kind gemeinsam das Ziel zu bestimmen und zu hochgesteckte Erwartungen vorsichtig so zu korrigieren, dass das Selbstbewusstsein nicht zusätzlich leidet.
Hierbei lässt sich ein grundlegendes Problem erkennen: Geistig behinderte Menschen können viel schlechter als normal Begabte ihr Selbstwertgefühl über ihre Leistungen aufbauen. Sind sie in der Lage, Vorstellungen zu entwickeln, planvoll zu handeln und das Ergebnis ihrer Handlung mit einem Vorbild zu vergleichen, so bemerken sie schnell, dass sie immer schlecht abschneiden. Dazu kommt, dass sie bei ihrer Handlung selbst ständig ihre Grenzen erleben: Sie erreichen ihr Ziel nicht, sei es, weil sie den falschen Weg wählen, sei es, weil ihnen die notwendigen Fertigkeiten fehlen.
Als Konsequenz stellen sich Minderwertigkeitsgefühle, Versagensängste, eine allgemeine Misserfolgsorientierung und der Wunsch, diesen unangenehmen Gefühlen, etwa durch Leistungsverweigerung oder Größenphantasien, zu entrinnen, ein. Der Betreuer muss daher versuchen, im gemeinsamen Spiel dem behinderten Kind zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen, und zwar nicht nur durch die Suche nach einem erreichbaren Ziel, sondern auch durch gemeinsame, schrittweise Planung und durch Hilfestellung (sei es mit Handführung) bei der Durchführung. Die Erfahrungen, die ein gesundes Kind beim Konstruktionsspiel selbst sammelt, müssen beim geistig behinderten Kind oft von außen angeregt, begleitet und formuliert werden.
Es gibt durchaus geistig behinderte Menschen, die ihre Leistungsspitze im Konstruktionsspiel haben. Sie bauen beispielsweise wunderbare Häuser, manchmal gar ganze Burgen oder Städte oder „erfinden“ die erstaunlichsten mechanischen Apparate. Sehr oft ist mit dieser Stärke eine Schwäche im sozialen Verhalten verbunden, die sich bezüglich des Spiels beispielsweise in der Unfähigkeit zum Rollenspiel ausdrücken kann.
4.3 Das Rollenspiel
Auch beim Rollenspiel braucht das geistig behinderte Kind oft Hinführung. Da es oft Schwierigkeiten hat, Vorstellungen zu entwickeln, Zusammenhänge zu erkennen, Erfahrungen zu übertragen und einzuordnen, fällt ihm auch der kreative Ausdruck im Rollenspiel schwer. Eventuell muss die Nachahmung, die ja als Voraussetzung für das Rollenspiel notwendig ist, erst angeregt werden. Die betreuende Person kann dies versuchen, indem sie ihrerseits das behinderte Kind spiegelt und einfache Rollenspiele mit dessen Lieblingsspielzeug durchführt. Beispielsweise kann die Puppe immer abends ausgezogen werden oder der schmutzige Teddybär gemeinsam gebadet und geföhnt werden. Egal wie hoch der Grad der Spielfähigkeit ist, es ist immer wichtig, dass sich eine Bezugsperson als Spielpartner zur Verfügung stellt. Es ist günstig, zunächst Alltagsgeschehnisse in Rollenspiele umzuwandeln. Man wohnt zum Beispiel in einem „Schloss“ und lässt sich von „Pagen“ bedienen. Auch die Verwandlung in Tiere ist sehr beliebt: Als Hund darf man bellen, immer hinterherlaufen und sich streicheln lassen, man muss jedoch auch gehorchen. Es ist möglich, dass in der fremden Rolle Aufgaben übernommen und Anweisungen befolgt werden, die im normalen Alltagsgeschehen abgelehnt werden. Auch manche Fertigkeit lässt sich leichter im Schutz einer fremden Rolle erwerben, ganz zu schweigen von der Vielzahl der Gefühle, die in einer anderen Gestalt viel leichter zum Ausdruck kommen können.
Wie beim Konstruktionsspiel, so gibt es auch beim Rollenspiel wahre Meister ihres Faches unter den geistig behinderten Menschen. Sie sind meist feinfühlig, phantasiebegabt und haben ihre Stärken im Erfassen sozialer Situationen. Ihr konstruktives Vorstellungsvermögen ist im Gegensatz dazu jedoch meist schwach ausgebildet.
4.4 Das Regelspiel
Das Regelspiel an sich stellt hohe Anforderungen hinsichtlich von Regelbewusstsein, der Selbstkontrolle und der sozialen Einordnung. Der behinderte Mensch muss warten können, bis er an der Reihe ist, er muss sein Handeln in einen engen, vorgegeben Rahmen pressen, er muss ich innerhalb dieses Rahmens auf sein Ziel konzentrieren und Entscheidungen treffen. Gleichzeitig muss er aber auch seine geistigen Fähigkeiten einsetzen, er muss die Wettbewerbssituation erkennen und ertragen, Solidarität üben und Niederlagen einstecken können. Auch hierfür benötigt er wieder liebevolle Unterstützung von außen. Damit Regelspiele zum befriedigenden Alltagserlebnis werden können, müssen die Spielangebote nach dem kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsstand ausgewählt werden, die Spielsituation und gegebenenfalls auch die Spielregeln müssen den individuellen Bedingungen angepasst werden.
Leichte Regelspiele, beispielsweise Würfel- und Kartenspiele wie „Mensch-ärgere-dich- nicht“ oder „Schwarzer Peter“, deren Ausgang mehr vom Zufall als von Ausbilden einer sinnvollen Strategie abhängt, sind bei vielen leicht bis mittelgradig geistig Behinderten beliebt. Die wenigen Regeln beherrschen sie mit der Zeit, an gleichförmige Tätigkeiten, die ähnlich einem Ritus vollzogen werden, sind sie gewohnt und ebenso an die soziale Einordnung, vor allem wenn sie im Heim leben. Einzig das Verlieren bereitet vielen Schwierigkeiten, andere wiederum akzeptieren es als einen Teil des Rituals ohne weiteren Kommentar.
Anders steht es um Strategiespiele wie „Mühle“ oder „Schach“, die ein gutes gedankliches Kombinationsvermögen und die Fähigkeit, die entworfenen Strategien den individuellen Gegebenheiten anzupassen, voraussetzen. Geistig behinderte Menschen, die auf diese Weise Erfolgserlebnisse verbuchen können trifft man leider äußerst selten.
4.5 Das pädagogisch-therapeutische Einsatz des Spiels
Bekommt der geistig behinderte Mensch eine angemessene Hilfe, so erlebt auch er spielend die lustvollen Seiten seiner Körperfunktionen, übt spielerisch lebensnotwendige Tätigkeiten, bewältigt seine Ängste und verarbeitet sein Leid. Er ist somit in der Lage, seine Umwelt und die eigene Person spielerisch zu gestalten.
Die Unterstützung, die einem geistig behinderten Menschen zuteil werden kann, hilft ihm nicht nur beim Spielen, sondern bedient sich zugleich des Spiels als pädagogisches oder therapeutisches Medium. Zielt man auf den Erwerb bestimmter (fein)motorischer, kognitiver oder sozialer Fähigkeiten ab, so dient das Spiel der „heilpädagogischen Übungsbehandlung“. Bei ihr spielt der methodische Aufbau eine wichtige Rolle. So versucht man, zu gewährleisten, dass die Anforderungen sich genau an den vorhandenen Fähigkeiten orientieren und schrittweise gesteigert werden. Für den kognitiven Bereich verwendet man beispielsweise Montessorimaterial.
Anders wird vorgegangen, wenn das Spiel als psychotherapeutisches Mittel zur Überwindung von emotionalen Problemen eingesetzt wird. In diesem Fall ähnelt der Vorgang der Spieltherapie eines normal begabten Kindes. Hierbei leistet das Rollenspiel den wichtigsten Beitrag, aber auch das Konstruktions- und Regelspiel kann auf Wunsch hin miteinbezogen werden.
Auch als diagnostisches Mittel erweist sich das Spiel als nützlich. Vor allem das Rollenspiel kann einen direkten Einblick in die direkte emotionale Bedürftigkeit auch eines geistig Behinderten geben. Diese Tatsache führte zur Entwicklung von Spielmaterial, das zu szenischer Darstellung anregen soll und speziell für diagnostische Zwecke verwendet wird (z.B. Scenotest).
Der geistige und emotionale Entwicklungsstand eines geistig behinderten Kindes lässt sich hervorragend von seinem spontanen Spiel ablesen. Das „Spielalter“, das es erreicht, wenn es sich selbst überlassen spielt, verweist normalerweise auf die frühesten Defizite, die sich entweder im kognitiven oder im emotionalen Bereich befinden. Entwicklungsspitzen werden erkennbar, wenn das Kind in einer harmonischen Spielsituation in emotionaler Nähe zu einer Bezugsperson beobachtet wird.
5. Angebot der Spiele und Spielmittel
Im Fachhandel und in der einschlägigen Literatur wird heute eine Vielzahl von Spielmaterialien für Kinder mit Behinderungen aller Art angeboten bzw. darauf verwiesen.
Außerdem sind der eigenen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Will man mit Kindern im allgemeinen, mit behinderten Kindern aber im Speziellen arbeiten, so lohnt sich ein zu Anfang der Arbeit sehr aufwändiges Bauen und Basteln von geeigneten Materialien auf jeden Fall. Hierbei sei auch auf ein älteres, aber durchaus brauchbares Buch hingewiesen:
KRENZER, ROLF (1971). Spiele mit behinderten Kindern. Heidelberg: Kemper. Dieses Buch enthält Spiele aller Art und ist für alle Kinder mit jeglichen Arten von Behinderungen geeignet.
Im Folgenden sollen noch einige Spiele und Spielmaterialien erwähnt werden, die sich besonders für Kinder mit a) einer Lernbehinderung und b) einer Körperbehinderung eignen.
a) Spiele für Kinder mit Lernbehinderung
Hier eignen sich besonders Spielmittel (auch aus dem Handel), deren Funktion im psychischen, sozialen und Arbeits- und Leistungsbereich genutzt werden können. Außerdem eignen sich alle Arten von Rollenspielen, szenischen Darstellungen, Gesellschaftsspielen. Sinnvoll sind auch Kreis- und Tanzspiele in Verbindung mit rhythmischen Übungen („Häschen in der Grube“), Baukastenspiele, Schattenspiele und Handpuppenspiele. Sinnvoll wäre auch im schulischen Bereich eine Art Schulprojekt zum Thema „Theater“, z.B. ein Maskenspiel in Verbindung mit psychomotorischen und rhythmischen Übungen, Diskussionen und Werkarbeiten.
b) Spiele für körperbehinderte Kinder
Im Säuglings- und Kleinkindalter eignen sich Spielmaterialien zum Anschauen, Hören, Tasten, Begreifen; Spielzeuge aus Plüsch; Spielzeuge zum Experimentieren. Später sind Bau- und Konstruktionsspiele, Würfelspiele, Kartenspiele, Gedächtnis- und Denkspiele sinnvoll. Außerdem sind Sinnesspiele (BüCKEN, HAJO (1996).
Kimspiele. München: Hugendubel) von großem Wert für die Ausprägung der einzelnen Sinne. Hinzu kommen weiterhin Spiele mit musikalischem Erlebnisgehalt aller Art. Besonders wichtig für Kinder mit körperlichen Behinderungen ist natürlich Spezialspielzeug für funktionelle Übungen und behinderungsgerecht modifiziertes Spielzeug. Im schulischen Bereich sei das darstellende Spiel erwähnt, sowie auch Rollenspiele, Kreisspiele, Textspiele, Pantomime, Bastel- und Werkspiele. Die Empfehlungen und Untersuchungen in der sonderpädagogischen Literatur zeigen, dass zum großen Teil sogenanntes „Normalspielzeug“ in der Erziehung und Therapie Behinderter eingesetzt werden kann.
6. Spielraumgestaltung
Für die Spieltherapie wird im allgemeinen ein Spielraum gewünscht, der eine Bühne für dramatische Darbietungen, eine große Sandkiste und diverses, empfohlenes Spielmaterial enthält. Wenn möglich, sollte der Raum schalldicht sein und fließendes Wasser haben. Ein solcher Raum ist auf eine Therapiesituation zugeschnitten, in der ein Kind oder eine Gruppe von Kindern frei spielen und sich ausleben dürfen.
Ungeeignet scheint dieser Raum jedoch für pädagogische Situationen zu sein, in denen Kinder zu Gruppenaktivitäten, zu konzentriertem Lernen oder zu konstruktivem Experimentieren und zu individuellem Spiel angeregt werden können. Ein Raum, der von seiner Konstruktion her ideale Bedingungen für pädagogisches Wirken bietet, wäre der „Spiel-Aktions-Raum“, wie er ähnlich für Kindertagesstätten entwickelt wurde.
In der folgenden Tabelle werden die Gliederung und Ausstattung des Raumes sowie die möglichen Spielaktivitäten angegeben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sicher ist der „Spiel-Aktions-Raum“ dem Therapieraum vorzuziehen, da er dessen Funktionen aufgrund seiner Ausstattung übernehmen kann.
Der Raum kann von Kindern und Jugendlichen in der ihnen gemäßen Weise benutzt werden. Die Gliederung des Raumes ermöglicht zudem, dass Kinder in Gruppen arbeiten und spielen und jeweils die räumlichen Bedingungen für das sie interessierende Spiel vorfinden. Andererseits kann die Ausstattung des Raumes Kinder und Jugendliche zum Spielen, Basteln, Malen, aber auch zum Lernen anregen.
Die beschriebene Raumausstattung könnte auch in Sonderschulen und Heimen die Förderung behinderter Kinder durch Spielen wirksam unterstützen.
7. Literaturhinweise und Quellen
SENCKEL, BARBARA (1998). Mit geistig Behinderten leben und arbeiten. München: Beck KLUGE, KARL-JOSEF / PATSCHKE, URSULA (1976). Spielen, Spielmittel und Spiel- programme zur Förderung be- hinderter Kinder und Jugendlicher. Ravensburg: Maier
KLOSTERKÖTTER, BIRGIT-SUSANNE (1980). Spielendes Lernen und Rollenspiel zwischen Sinnlichkeit und Vernunft.
Rheinstetten: Schindele
Häufig gestellte Fragen
Was sind die verschiedenen Spielarten, die im Text besprochen werden?
Der Text behandelt fünf Hauptspielarten: Das Funktionsspiel, das Konstruktionsspiel, das Symbol- oder Rollenspiel und das Regelspiel.
Was ist das Funktionsspiel?
Das Funktionsspiel ist die erste Art des Spiels, die ein Kind ausübt. Es beinhaltet lustvolle Erprobungen der eigenen körperlichen Fähigkeiten und das Erforschen von Gegenständen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten.
Was ist das Konstruktionsspiel?
Das Konstruktionsspiel beginnt, wenn das Kind aufgrund seines wachsenden Vorstellungsvermögens und Symbolverständnisses planvoll handelt und handelnd etwas Bestimmtes herstellen möchte.
Was ist das Symbol- oder Rollenspiel?
Beim Rollenspiel symbolisiert ein Gegenstand einen anderen. Das Kind schlüpft in eine andere Rolle und ahmt Handlungen und Situationen nach.
Was ist das Regelspiel?
Das Regelspiel ist durch selbst erdachte oder bereits vorgegebene Regeln gekennzeichnet, denen sich das Kind um des Spielens willen freiwillig unterwirft. Es beinhaltet Wettbewerbselemente.
Welchen Bezug haben Spiele zum Lernen?
Spiele fördern Teilqualifikationen wie sensumotorisches Können, soziale Kompetenz, Kreativität und kognitive Entwicklung. Sie können im Unterricht eingesetzt werden, um Einschränkungen des Schulalltags entgegenzuwirken.
Welche Bedeutung hat das Rollenspiel für lernbehinderte Kinder?
Das Rollenspiel spielt eine zentrale Rolle im Sozialisationsprozess lernbehinderter Kinder, indem es zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Abbau von Spannungen und zur spielerischen Vorwegnahme sozialer Rollen beiträgt.
Welche kompensatorischen und emanzipatorischen Funktionen hat das Rollenspiel?
Das Rollenspiel vermittelt Grundqualifikationen flexiblen Rollenhandelns wie Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz. Es ermöglicht das Erproben neuer Verhaltensweisen und Problemlösungsstrategien.
Welche kritischen Einwände gibt es bezüglich der Effektivität von Rollenspielen?
Das Rollenspiel wird im Schulalltag oft nur als Randangebot betrachtet und scheitert am mangelnden Interesse der Lehrkräfte. Auch die Einbeziehung von nicht-behinderten Kindern gestaltet sich oft schwierig.
Welche Bedeutung hat das Spiel für Menschen mit geistiger Behinderung?
Das Spiel hat für Menschen mit geistiger Behinderung dieselbe Bedeutung wie für nicht-behinderte Menschen, wobei die behinderungsbedingten Einschränkungen eine Rolle spielen.
Wie wirkt sich das Funktionsspiel bei Menschen mit geistiger Behinderung aus?
Menschen mit geistiger Behinderung erproben Bewegungsmöglichkeiten oft wenig und bleiben in der Regel bei bereits erworbenen Handlungsmustern. Stereotype Bewegungen können auftreten.
Wie wirkt sich das Konstruktionsspiel bei Menschen mit geistiger Behinderung aus?
Menschen mit geistiger Behinderung harren oft lange bei erworbenen Spielformen und überschätzen ihre Fähigkeiten. Sie benötigen einfühlsame Unterstützung.
Wie wirkt sich das Rollenspiel bei Menschen mit geistiger Behinderung aus?
Menschen mit geistiger Behinderung brauchen Hinführung zum Rollenspiel und die Unterstützung einer Bezugsperson als Spielpartner.
Wie wirkt sich das Regelspiel bei Menschen mit geistiger Behinderung aus?
Das Regelspiel stellt hohe Anforderungen hinsichtlich Regelbewusstsein, Selbstkontrolle und sozialer Einordnung. Angepasste Spielangebote sind notwendig.
Wie wird das Spiel pädagogisch-therapeutisch bei Menschen mit geistiger Behinderung eingesetzt?
Das Spiel dient der heilpädagogischen Übungsbehandlung und kann als psychotherapeutisches Mittel zur Überwindung emotionaler Probleme eingesetzt werden. Es kann auch als diagnostisches Mittel dienen.
Welche Spielmaterialien sind für Kinder mit Lernbehinderung geeignet?
Besonders eignen sich Spielmittel, deren Funktion im psychischen, sozialen und Arbeits- und Leistungsbereich genutzt werden können, sowie Rollenspiele, szenische Darstellungen und Gesellschaftsspiele.
Welche Spielmaterialien sind für körperbehinderte Kinder geeignet?
Im Säuglings- und Kleinkindalter eignen sich Materialien zum Anschauen, Hören, Tasten, Begreifen; später Bau- und Konstruktionsspiele, Würfelspiele, Kartenspiele, Gedächtnis- und Denkspiele.
Wie sollte die Spielraumgestaltung aussehen?
Ein Spiel-Aktions-Raum, der verschiedene Bereiche für unterschiedliche Aktivitäten bietet, ist einem reinen Therapieraum vorzuziehen.
- Citar trabajo
- Eva-Maria Noz (Autor), 2001, Die Rolle des Spiels für die Entwicklung behinderter Kinder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100624