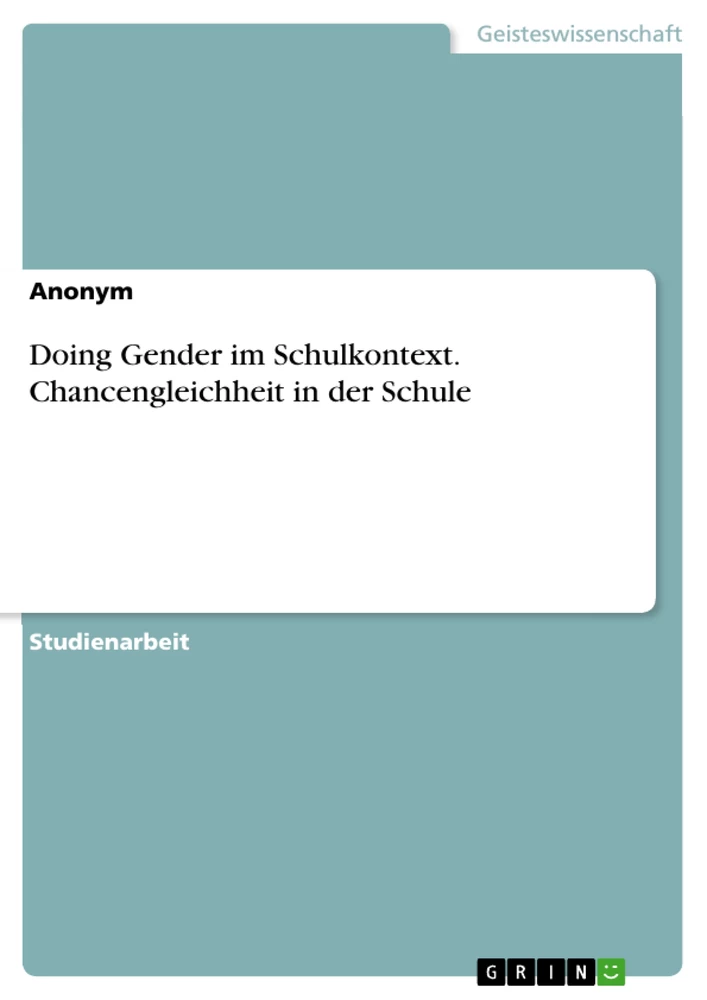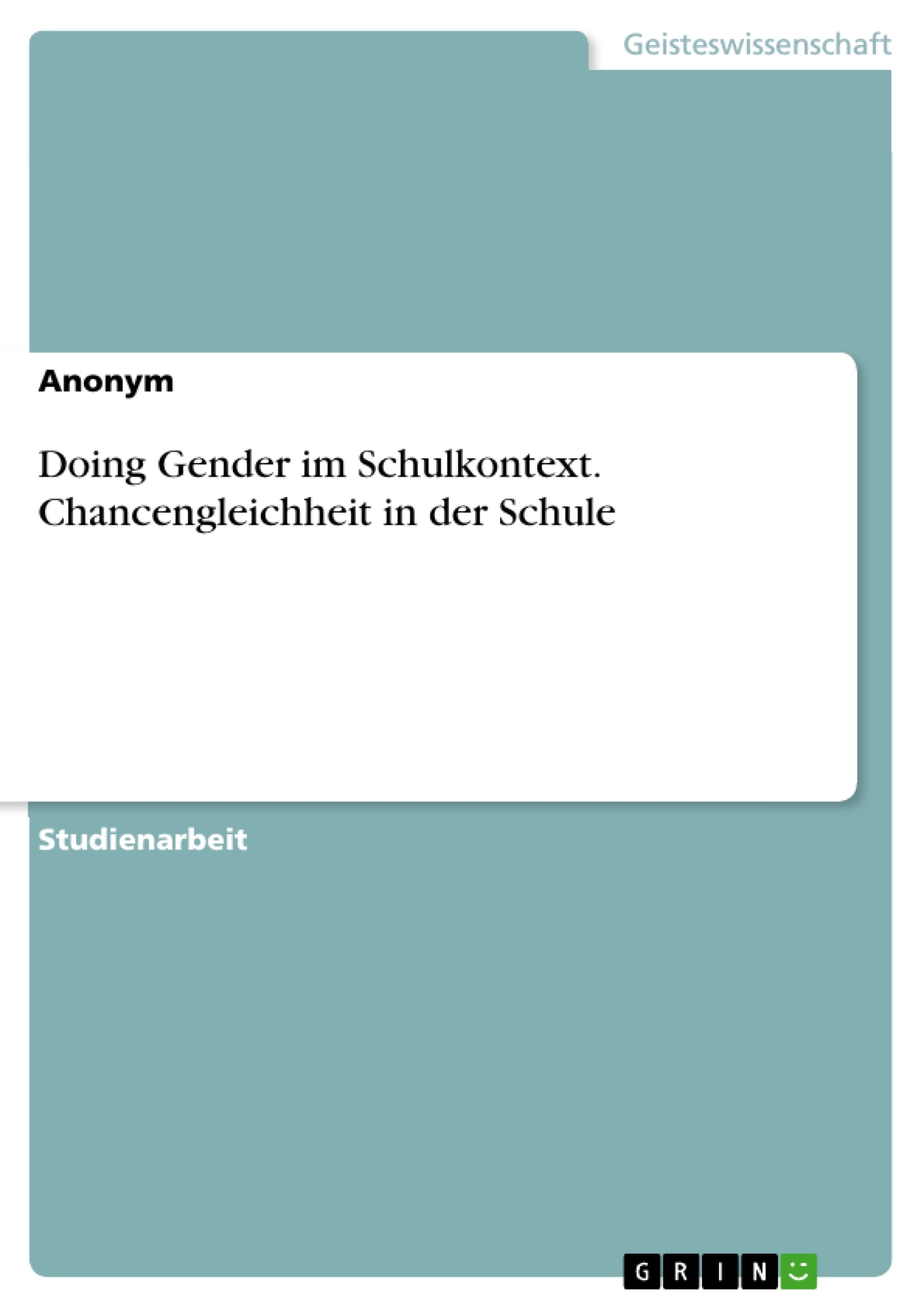Diese Arbeit beantwortet anhand eines Falles aus dem Schulkontext die Forschungsfrage, ob und wie die Selektionskategorie Geschlecht mit der Chancengleichheit verknüpft ist. Dafür wird zuerst Wesentliches des "Doing-Gender-Konzepts" dargelegt und zweitens der Fall "Frauen reden immer so viel" in Sequenzen aufgebrochen und rekonstruiert. Die Arbeit endet mit einem fusionierenden Kapitel von Theorie und Fallrekonstruktion, in welchem erneut auf die Forschungsfrage eingegangen wird.
"On ne naît pas femme, on le devient." Mit diesem Satz hinterfragte Simone de Beauvoir 1949 erstmals systematisch die Zuweisung zum einen oder anderen Geschlecht und verwies somit auf die Dichotomie zwischen den Geschlechtern. Die Genderforschung untersucht seither die Ausbildung, Wahrnehmung und Auswirkung von Geschlecht(ern) innerhalb und auf die Gesellschaft. Vor allem aus soziologischer Perspektive wird Geschlecht als wesentlicher Faktor für gesellschaftliche Interaktionen betrachtet, da Geschlecht die Möglichkeiten des Zugangs zu Ressourcen, Macht und Rechten beeinflusst.
Kinder wachsen in dem System der Zweigeschlechtlichkeit unbewusst auf und nehmen dieses als natürlich wahr. Daraus resultiert, dass sie versuchen, sich in den Geschlechterrollen einzufinden und diese auszubauen. Dafür praktizieren und erfahren sie dementsprechend 'doing gender'. Mit besonderen Anforderungen sind sie dabei spätestens in der Schule konfrontiert, wo sie auf eine große Anzahl von gleichaltrigen Vertretern beider Geschlechter treffen. Die Schule ist kein geschlechtsneutraler Raum und Geschlechterverhältnisse sowie Stereotype werden in Lehrmaterialien, Unterrichtsgestaltungen und Interaktionen vielfach ungleich (re-)produziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Wesentliches des „doing-gender-Konzepts“
- „Doing gender“ im Schulkontext
- Fallrekonstruktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung zielt darauf ab, die Verknüpfung der Selektionskategorie Geschlecht mit Chancengleichheit im Schulkontext anhand eines konkreten Falles zu analysieren. Dazu wird das „doing-gender-Konzept“ in seinen zentralen Aspekten vorgestellt und der Fall „Frauen reden immer so viel“ aus der objektiven Hermeneutik beleuchtet.
- Das „doing-gender-Konzept“ und die Konstruktion von Geschlecht durch soziale Interaktion
- Die Relevanz des „doing gender“ im Schulkontext und die Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse
- Die Rolle von Lehrkräften bei der (Re-)Konstruktion von Geschlecht und die Notwendigkeit einer reflektierten Pädagogik
- Die Analyse des Falles „Frauen reden immer so viel“ und die Herausarbeitung relevanter Interaktionsprozesse
- Die Verknüpfung von Theorie und Fallrekonstruktion zur Beantwortung der Forschungsfrage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die Forschungsfrage vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie verweist auf die Relevanz der Genderforschung und die Bedeutung des Geschlechts als Faktor für gesellschaftliche Interaktionen und Chancengleichheit.
Theoretischer Teil
Der theoretische Teil beleuchtet das „doing-gender-Konzept“ und seine Bedeutung in der soziologischen Geschlechterforschung. Es wird dargelegt, wie Geschlecht nicht als biologisches Merkmal, sondern als sozial konstruiertes Produkt verstanden wird, das durch Interaktionsprozesse im Alltag entsteht und sich performativ gestaltet. Der Abschnitt erläutert, wie sich das „doing-gender-Konzept“ auf den Schulkontext bezieht und welche Auswirkungen es auf die Geschlechterverhältnisse in der Schule hat.
Fallrekonstruktion
Die Fallrekonstruktion analysiert den Fall „Frauen reden immer so viel“ aus dem Fallarchiv der Universität Hannover. Dabei werden einzelne Sequenzen des Falles objektiv-hermeneutisch interpretiert und die relevanten Interaktionsprozesse analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der vorliegenden Arbeit sind „doing gender“, Chancengleichheit, Schulkontext, Geschlechterverhältnisse, Interaktion, Fallrekonstruktion, objektive Hermeneutik und Geschlechterstereotype.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept des "Doing Gender"?
Geschlecht wird nicht als biologische Eigenschaft gesehen, sondern als soziales Produkt, das durch tägliche Interaktionen und Verhaltensweisen immer wieder neu hergestellt wird.
Wie beeinflusst Geschlecht die Chancengleichheit in der Schule?
Schulen sind keine geschlechtsneutralen Räume. Stereotype in Lehrmaterialien und Lehrer-Interaktionen können dazu führen, dass Ressourcen und Macht ungleich verteilt werden.
Was untersucht der Fall "Frauen reden immer so viel"?
Der Fall analysiert mittels objektiver Hermeneutik, wie durch Aussagen im Schulalltag Geschlechterstereotype reproduziert und gefestigt werden.
Welche Rolle spielen Lehrkräfte beim "Doing Gender"?
Lehrkräfte (re-)konstruieren oft unbewusst Geschlechterrollen durch ihre Unterrichtsgestaltung und Kommunikation, was eine reflektierte Pädagogik notwendig macht.
Ist das Zweigeschlechtlichkeitssystem für Kinder natürlich?
Kinder wachsen in diesem System auf und nehmen es unbewusst als natürlich wahr, während sie versuchen, sich in die vorgegebenen Rollen einzufinden.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Doing Gender im Schulkontext. Chancengleichheit in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005089