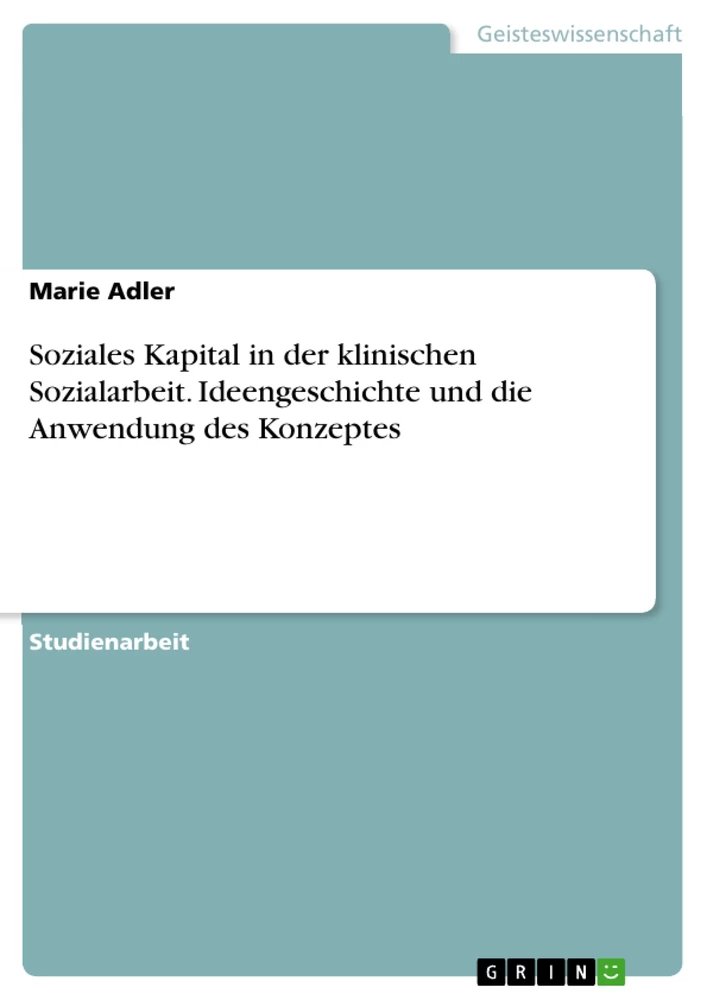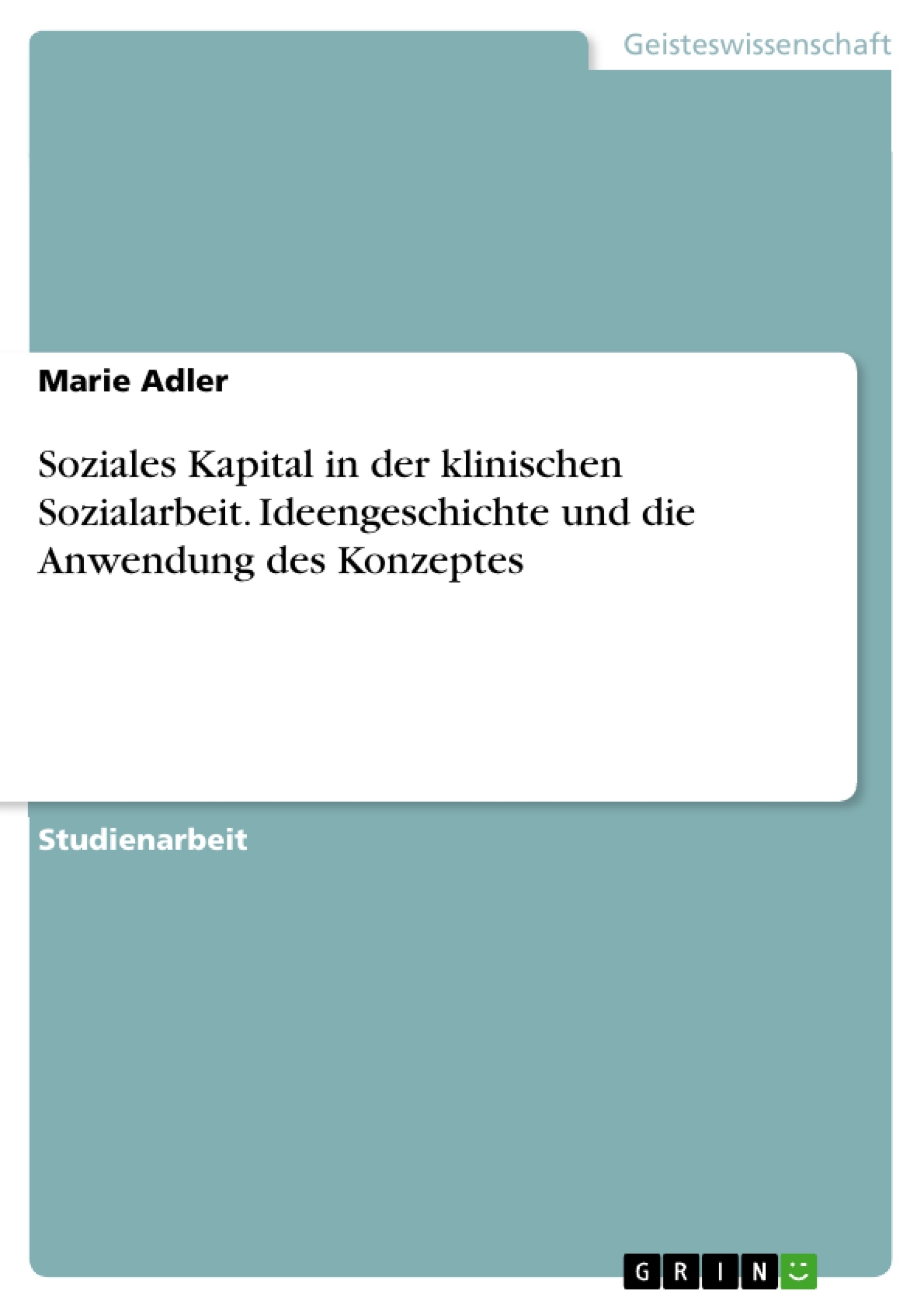In dieser Arbeit wird versucht, Aufschluss über die Anwendbarkeit des Konzeptes „soziales Kapital“ für die klinische Sozialarbeit zu gewinnen. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Überwindung sozialer Problemlagen mit diesem Konzept stattfinden kann oder ob es zur Exklusion von benachteiligten Gruppen beiträgt. Hierfür wird im zweiten Kapitel untersucht, wie der Begriff bei verschiedenen Autoren definiert wird und welche inhaltlichen Aspekte dabei berücksichtigt werden.
Soziale Arbeit ist von der Sozialpolitik geprägt, sodass sie sich neo-sozialen und ökonomischen Ideen stellen muss, die den Begriff des Sozialkapitals gerne dazu nutzen, die individuelle Eigenverantwortung des Menschen, das bürgerschaftliche Engagement und die Netzwerkarbeit hervorzuheben und die Verantwortlichkeiten von Politik und Staat zurückzustellen. Es ist fraglich, inwiefern dies mit der Sozialen Arbeit vereinbar ist. Im dritten Kapitel wird daher die Anwendbarkeit des Konzeptes für die klinische Sozialarbeit und insbesondere für die Gesundheitsgerontologie untersucht unter Betrachtung von positiven und negativen Effekten.
Das Thema "soziales Kapital" hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung in sozialwissenschaftlichen Publikationen gewonnen. Interesse weckten vor allem die verschiedenen Dimensionen des sozialen Kapitals sowie dessen positive Effekte auf Netzwerke und die Einbeziehung von Ressourcen im Sinne sozialer Beziehungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ideengeschichte des sozialen Kapitals
- Was ist soziales Kapital?
- Sozialkapital nach Pierre Bourdieu
- Sozialkapital nach James S. Coleman
- Sozialkapital nach Robert D. Putnam
- Zusammenfassung
- Das Konzept des sozialen Kapitals in der klinischen Sozialarbeit
- Anwendungsfelder und Adressaten Sozialer Arbeit
- Gesundheitsgerontologie
- Sozialkapital in der klinischen Sozialarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept des sozialen Kapitals und dessen Anwendbarkeit in der klinischen Sozialarbeit, insbesondere im Kontext der Gesundheitsgerontologie. Ziel ist es, die ideengeschichtliche Entwicklung des Begriffs zu beleuchten, verschiedene Definitionen zu analysieren und die Relevanz des Konzeptes für die Praxis der klinischen Sozialarbeit zu untersuchen.
- Die Entwicklung des Begriffs "soziales Kapital" in der Soziologie
- Verschiedene Definitionen und theoretische Ansätze zum sozialen Kapital
- Die Rolle des sozialen Kapitals in der Bewältigung sozialer Problemlagen
- Potentiale und Herausforderungen des sozialen Kapitals in der klinischen Sozialarbeit
- Die Anwendung des sozialen Kapitals im Bereich der Gesundheitsgerontologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema "soziales Kapital" ein und erläutert die wachsende Bedeutung des Begriffs in den Sozialwissenschaften. Es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern das Konzept zur Überwindung sozialer Problemlagen beitragen kann oder ob es zur Exklusion von benachteiligten Gruppen beiträgt.
Kapitel zwei beleuchtet die ideengeschichtliche Entwicklung des Begriffs "soziales Kapital" und präsentiert verschiedene Definitionen von Pierre Bourdieu, James S. Coleman und Robert D. Putnam. Die verschiedenen Ansätze werden im Detail vorgestellt und miteinander verglichen.
Schlüsselwörter
Soziales Kapital, klinische Sozialarbeit, Gesundheitsgerontologie, Ideengeschichte, Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert D. Putnam, Netzwerke, Ressourcen, soziale Beziehungen, soziale Problemlagen, Exklusion, Benachteiligung, Verantwortlichkeiten, Anwendbarkeit, Effekte, positive Effekte, negative Effekte.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter "sozialem Kapital" in dieser Arbeit verstanden?
Soziales Kapital bezieht sich auf Ressourcen in sozialen Beziehungen und Netzwerken, die Individuen zur Bewältigung von Problemlagen nutzen können.
Welche Theoretiker werden zur Definition herangezogen?
Die Arbeit analysiert die Konzepte von Pierre Bourdieu, James S. Coleman und Robert D. Putnam.
Wie wird soziales Kapital in der klinischen Sozialarbeit angewendet?
Es dient als Ansatz zur Aktivierung von Ressourcen in Netzwerken, wird aber auch kritisch hinsichtlich der Gefahr der Exklusion benachteiligter Gruppen betrachtet.
Was ist Gesundheitsgerontologie?
Ein Anwendungsfeld der Sozialen Arbeit, das sich mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden älterer Menschen befasst.
Welche negativen Effekte kann das Konzept haben?
Es besteht die Sorge, dass der Fokus auf Eigenverantwortung und bürgerschaftliches Engagement dazu genutzt wird, staatliche Verantwortlichkeiten zurückzustellen.
Warum ist Netzwerkarbeit hier wichtig?
Netzwerkarbeit ermöglicht den Zugriff auf soziale Ressourcen, die für die Überwindung sozialer Problemlagen essentiell sein können.
- Citar trabajo
- Marie Adler (Autor), 2017, Soziales Kapital in der klinischen Sozialarbeit. Ideengeschichte und die Anwendung des Konzeptes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005026