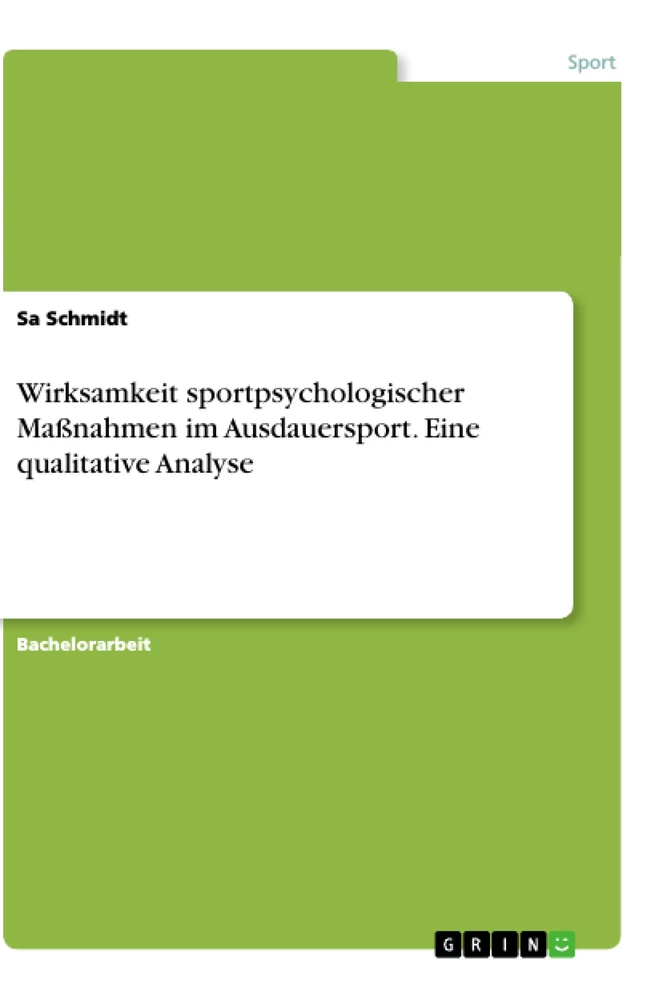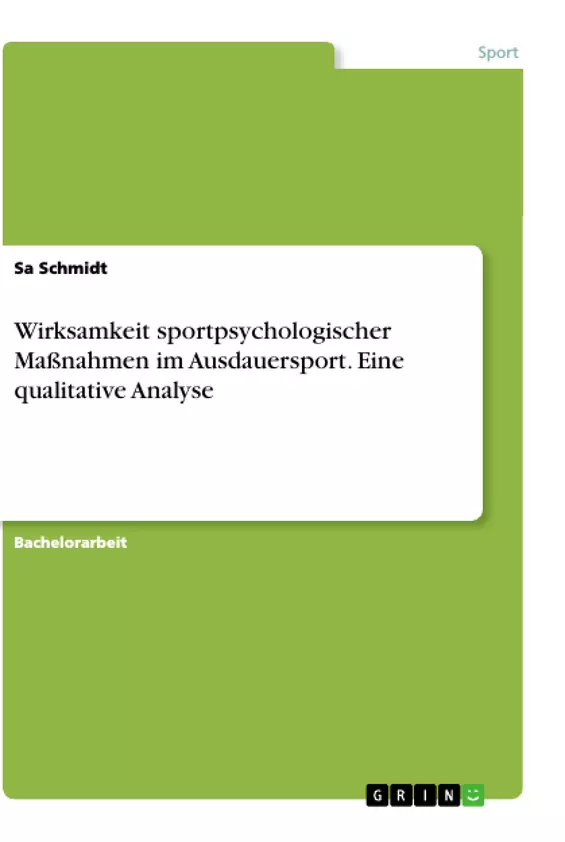Im Rahmen dieser Arbeit werden Motive von Athleten ergründet, um der Frage nach der "Wirksamkeit sportpsychologischer Maßnahmen zur Motivationsförderung", insbesondere im Ausdauersport, nachzugehen. Es wird betrachtet, ob psychologische Maßnahmen die Motivation des Sporttreibenden positiv beeinflussen können bzw. ob es diesbezüglich individuelle Unterschiede zwischen verschiedenen Athleten gibt. Weiterhin wird darauf eingegangen, in welchen Situationen psychologische Interventionen überhaupt sinnvoll sind.
Zum Einstieg wird daher zunächst eine Definition der "angewandten Sportpsychologie" gegeben und ihr Inhalt beschrieben sowie ihre "vermeintlichen Leistungen" genannt – nur so ist verständlich, weshalb spezifische psychologische Maßnahmen (wie beispielsweise zur Motivationssteigerung) überhaupt entwickelt wurden (Kapitel 1). In einem daran anschließenden Methodenteil werden die Begriffe "Motiv" und "Motivation" genauer erläutert, ebenso wie die Erschließung entsprechender diagnostischer Daten. Außerdem wird in diesem Teil das methodische Vorgehen innerhalb dieser Arbeit beschrieben und begründet (Kapitel 2).
Im Theorieteil werden grundlegende Annahmen über die Eigenschaften der "Sportlerpersönlichkeit" (Kapitel 3) sowie die verschiedenen sportpsychologischen Vorgehensweisen (Kapitel 4 "Grundlagentraining", Kapitel 5 "Fertigkeitstraining") dargelegt. Weiterhin werden wichtige Modelle der Motivationspsychologie vorgestellt (z.B. das bekannte "Risiko-Wahl-Modell" von Atkinson) (Kapitel 6), die eine Basis für das Verständnis der tatsächlichen Wirksamkeit der psychologischen Techniken bilden sollen.
Der Empirische Teil beinhaltet zunächst die inhaltlich passende, daher vorgeschobene Thematik zu Belastung und Erholung (Kapitel 7). Sodann folgen die Beschreibung als auch die Ergebnisse der empirischen Datenerhebung, welche mittels einer Einzelfallanalyse erfolgt ist: Durch eine gezielte Befragung im Rahmen eines direkten Interviews und der Übersicht über den Trainingsplan hinweg über mehrere Jahre (sprachlich im Rahmen des Interviews, vgl. Kapitel 8.1) konnte ein praxisnaher Bezug zur Theorie der sportpsychologischen Methoden genommen und deren Sinnhaftigkeit bzw. Wirksamkeit am Beispiel eines privat immer noch sehr aktiven, ehemaligen Hochleistungssportlers (Dieter Baumann) überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte zu Thema und Aufbau der Arbeit
- "Angewandte Sportpsychologie" - Was ist das?
- Argumente für den Einsatz sportpsychologischer Methoden
- Wissenschaftliche Grundlagen
- Definition "Motiv" und "Motivation"
- Diagnostik zur Ermittlung von sportpsychologischem Bedarf
- Methodisches Vorgehen innerhalb dieser Arbeit
- Modelle der Motivationspsychologie
- Bedürfnispyramide von Maslow
- Risiko-Wahl-Modell von Atkinson
- Supermotivation-Ansatz von Spitzer
- Die "Sportlerpersönlichkeit"
- Selektions- vs. Sozialisationshypothese
- Zusammenhang zwischen Sporttreiben und Persönlichkeit
- Sportpsychologisches Grundlagentraining
- Atementspannung
- Progressive Muskelrelaxation
- Autogenes Training
- Sportpychologisches Fertigkeitstraining
- Aktivierung
- Zielsetzung
- Attribution und Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- Selbstgespräch
- Konzentrationstraining
- Imagination
- Routinen und Habituation
- Belastung erfordert Erholung
- Erholungsstrategien und Monitoring
- Psychologisches Aufbautraining nach Verletzungen
- Motivation im Ausdauersport
- Trainingsgestaltung
- Motivationsförderung und -erhaltung
- Einfluss psychischer Belastungen
- Signifikante Persönlichkeitsfaktoren
- Zusammenfassung
- Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Motivation von Athleten im Ausdauersport und analysiert die Wirksamkeit sportpsychologischer Maßnahmen zur Motivationsförderung. Sie untersucht, ob psychologische Interventionen einen positiven Einfluss auf die Motivation von Sporttreibenden haben und ob es individuelle Unterschiede in der Wirksamkeit dieser Methoden gibt. Darüber hinaus wird die Sinnhaftigkeit von psychologischen Interventionen in bestimmten Situationen beleuchtet.
- Definition und Bedeutung der angewandten Sportpsychologie
- Motivationsforschung und -diagnostik
- Modelle der Motivationspsychologie und ihre Anwendung im Sport
- Sportpsychologische Trainingsmethoden und ihre Auswirkungen auf die Motivation
- Bedeutung von Erholung und psychologischer Unterstützung im Ausdauersport
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert die "angewandte Sportpsychologie" und ihre Bedeutung im Hinblick auf Trainingsoptimierung und Leistungssteigerung. Es beleuchtet die Rolle von mentalen Fähigkeiten und Selbstregulationsfertigkeiten im Sport. Das zweite Kapitel geht auf die Definition von "Motiv" und "Motivation" ein sowie auf die Diagnostik von sportpsychologischem Bedarf. Es beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit, das sich auf eine Einzelfallanalyse stützt. Das dritte Kapitel stellt verschiedene Modelle der Motivationspsychologie vor, um die Wirksamkeit von psychologischen Techniken zu verstehen. Es umfasst das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson. Das vierte Kapitel befasst sich mit der "Sportlerpersönlichkeit" und deren Einfluss auf die Motivation. Es beleuchtet die Selektions- und Sozialisationshypothese sowie den Zusammenhang zwischen Sporttreiben und Persönlichkeit.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit sportpsychologischem Grundlagentraining, das verschiedene Entspannungstechniken wie Atementspannung, progressive Muskelrelaxation und autogenes Training umfasst. Das sechste Kapitel befasst sich mit sportpsychologischem Fertigkeitstraining, das Themen wie Aktivierung, Zielsetzung, Attribution und Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstgespräch, Konzentrationstraining, Imagination, Routinen und Habituation umfasst.
Das siebte Kapitel geht auf die Bedeutung von Erholung im Zusammenhang mit sportlicher Belastung ein. Es beinhaltet Erholungsstrategien und Monitoring sowie psychologisches Aufbautraining nach Verletzungen. Das achte Kapitel widmet sich der Motivation im Ausdauersport und untersucht die Auswirkungen von Trainingsgestaltung, Motivationsförderung und Einfluss psychischer Belastungen. Das neunte Kapitel befasst sich mit signifikanten Persönlichkeitsfaktoren, die für die sportliche Leistung relevant sind.
Schlüsselwörter
Angewandte Sportpsychologie, Motivation, Ausdauersport, Sportpsychologische Maßnahmen, Motivationsförderung, Selbstregulationsfertigkeiten, Sportlerpersönlichkeit, Trainingsoptimierung, Leistungssteigerung, Einzelfallanalyse, Risiko-Wahl-Modell, Erholung, Belastung, psychische Belastungen, Persönlichkeitsfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist angewandte Sportpsychologie?
Sie befasst sich mit der Anwendung psychologischer Erkenntnisse und Techniken zur Optimierung von Training, Wettkampfleistung und dem psychischen Wohlbefinden von Sportlern.
Welche Techniken gehören zum Fertigkeitstraining?
Dazu zählen Zielsetzung, Selbstgespräche, Konzentrationstraining, Imagination (mentales Vorstellen) sowie die Etablierung von Routinen.
Was besagt das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson?
Es erklärt die Motivationsstärke als Ergebnis aus der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und dem Anreizwert des Erfolgs, wobei Individuen entweder erfolgszuversichtlich oder misserfolgsängstlich agieren.
Können psychologische Maßnahmen die Motivation steigern?
Ja, die qualitative Analyse zeigt, dass gezielte Interventionen die Motivation positiv beeinflussen können, wobei individuelle Unterschiede zwischen Athleten bestehen.
Warum wurde Dieter Baumann für die Einzelfallanalyse gewählt?
Als ehemaliger Hochleistungssportler bietet er fundierte Einblicke in die langfristige Wirksamkeit sportpsychologischer Methoden und deren Bedeutung im Ausdauersport.
- Arbeit zitieren
- Sa Schmidt (Autor:in), 2014, Wirksamkeit sportpsychologischer Maßnahmen im Ausdauersport. Eine qualitative Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001337