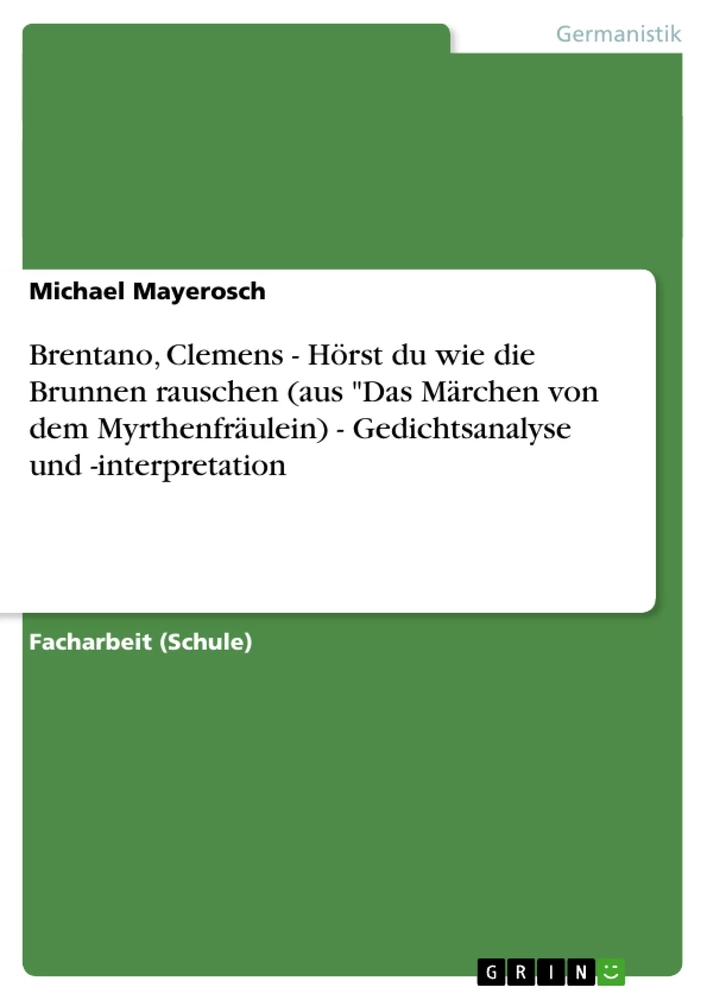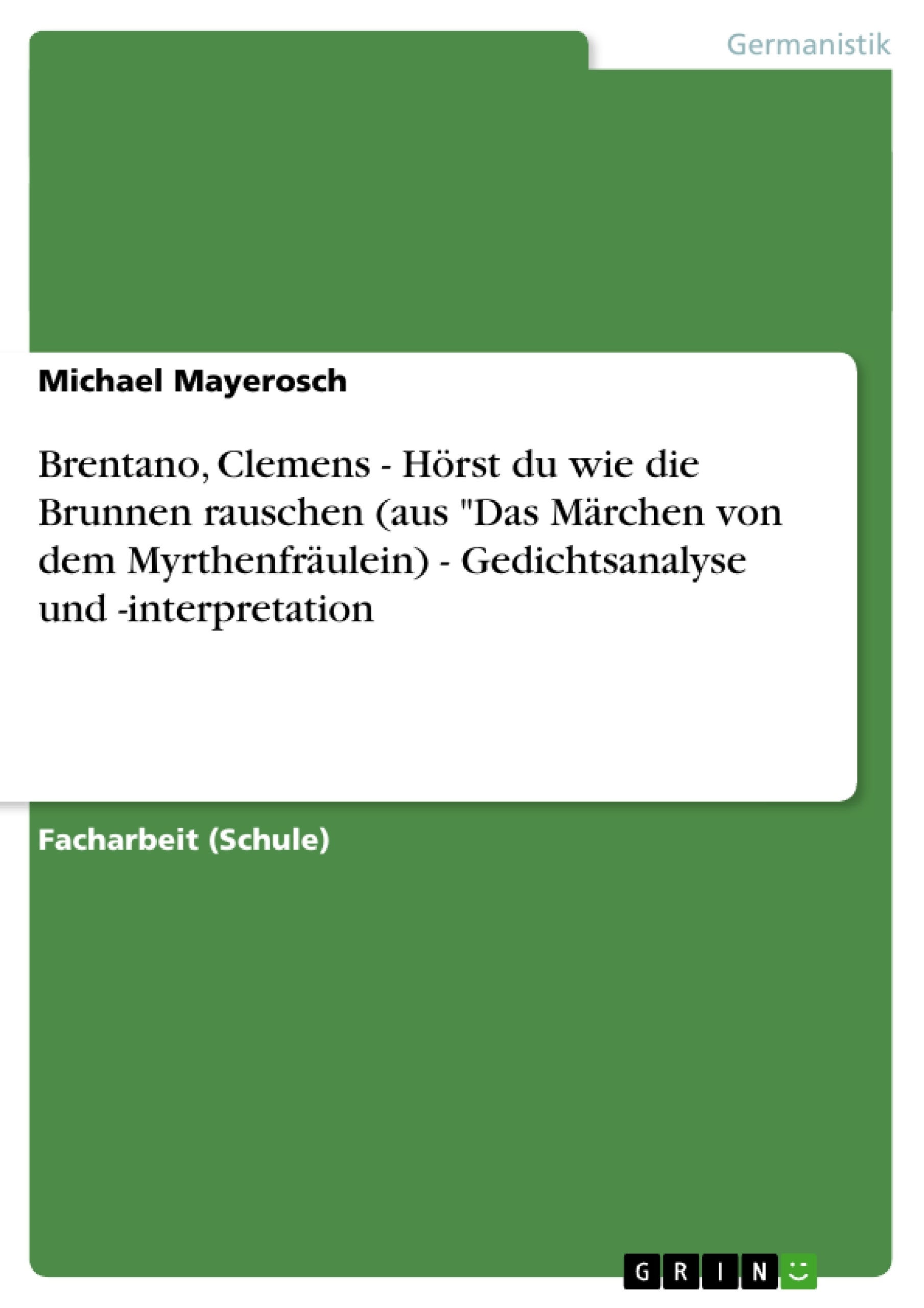Stell dir vor, die Nacht haucht dir ein Geheimnis ins Ohr, ein Flüstern, das tiefer dringt als jeder Tagtraum: Clemens Brentanos "Hörst du wie die Brunnen rauschen" ist mehr als nur ein Schlaflied; es ist eine Einladung in eine Welt, in der Träume blühen und die Seele Flügel bekommt. Dieses Gedicht, eingebettet in das romantische Märchen vom Myrtenfräulein, entführt uns in eine Sphäre der Geborgenheit und unbegrenzten Möglichkeiten, wo der Mond ein Schlaflied singt und Sterne wie Blumen gepflückt werden können. Die Analyse enthüllt die tiefere Bedeutung dieser Verse, die nicht nur das Myrtenfräulein in den Schlaf wiegen sollen, sondern auch uns Leser dazu anregen, uns der Kraft der Träume hinzugeben. Entdecke die romantische Poesie Brentanos, seine meisterhafte Verwendung von Klang und Rhythmus, die eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens schaffen. Tauche ein in die Welt der Romantik, in der die Sehnsucht nach dem Unendlichen und die Idealisierung der Mutterliebe zentrale Themen sind. Erfahre, wie Brentano durch Personifikationen und eine sanfte, melodische Sprache eine Brücke zwischen der realen Welt und der Traumwelt schlägt. Lass dich von der Harmonie und dem Zauber dieses Gedichtes verführen und entdecke die verborgenen Botschaften, die in den Versen schlummern. Diese Interpretation bietet einen umfassenden Einblick in Brentanos Werk, seine romantischen Ideale und die zeitlose Schönheit seiner Sprache. Ergründe die Bedeutung von Träumen als Quelle der Glückseligkeit und finde heraus, wie du selbst in die Welt des Schlafs eintauchen kannst, um dort die Freiheit und Erfüllung zu finden, die im wachen Zustand oft unerreichbar scheinen. Bereite dich darauf vor, die Magie der Romantik neu zu erleben und dich von der beruhigenden Kraft der Poesie tragen zu lassen. Wage es, in deinen Träumen zu fliegen und die unendlichen Weiten deiner Fantasie zu erkunden – denn nur wer träumt, kann wirklich leben. „Hörst du wie die Brunnen rauschen“ ist nicht nur ein Gedicht, sondern ein Schlüssel zu deinem inneren Universum.
Gedichtsanalyse und –interpretation
Clemens Brentano – Hörst du wie die Brunnen rauschen
„ ,Heute will ich einmal singen’, und sie gab es nach vielen Bitten zu; da sang er folgendes Liedchen:“ Mit diesem Auszug wird das Gedicht „Hörst du wie die Brunnen rauschen“ in dem Hauptwerk „Das Märchen von dem Myrtenfräulein“ eingeleitet. Verfasst wurden das Märchen und demnach auch das zu behandelnde Gedicht zwischen 1826 und 1827 vom deutschen Schriftsteller Clemens Brentano.
Er war der Sohn eines oberitalienischen Kaufmanns und der vom jungen Johann Wolfgang von Goethe verehrten Maximiliane von La Roche (1756-1793), deren unglückliche Ehe Niederschlag in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ fand. Clemens Brentano wurde am 9. September 1778 in Ehrenbreitstein dem heutigen Koblenz geboren und wuchs dort, sowie zum Teil in Frankfurt am Main auf. Er hatte 2 Schwestern von denen eine Bettina von Arnim (eigentlich Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano) war, welche neben der Heirat mit Ludwig Achim von Arnim auch selbst eine begabte Schriftstellerin war. Nachdem er zunächst als Kaufmann tätig war, studierte er ab 1797 in Halle und Jena, wo er mit der Weimarer Klassik und der Frühromantik in Kontakt kam. Zusammen mit seinem neuen Schwager Achim von Arnim gab Brentano unter dem Titel „Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder“ (zwischen 1805 und 1808 verfasst) eine Sammlung deutscher Volksdichtungen heraus. Brentano verfasste Gedichte, Prosawerke und Bühnenstücke, welche sich in ihren Metaphern und Formulierungen stets durch großen Phantasiereichtum auszeichneten.
Brentano starb am 28. Juli 1842 in Aschaffenburg, nachdem er sich seit 1817 verstärkt dem katholischen Glauben zugewandt hatte.
Jenes Gedicht um das es hier gehen soll, entnommen aus „Das Märchen von dem Myrtenfräulein“ hat eigentlich keinen richtigen Namen wird aber vielfach als „Schlaflied“ oder eben „Hörst du wie die Brunnen rauschen“ bezeichnet. Dass der Name Schlaflied viel eher passt, ergibt sich aus dem Inhalt des Märchens von dem Myrtenfräulein. Dieses handelt von einem Prinzen der einen Myrtenbaum besitzt aus dem eines Tages ein Wesen mit entzückender Stimme entsteigt, welches er jedoch nicht ansehen darf. Sie sagte ihm, dass er sie sehen könne, doch vorher müsse er sich erst ein Lied von ihr anhören. Doch dieses Lied schläferte ihn nur ein, so wie es auch die folgenden sieben Tage lang fortsetzte. Seine Begier sie zu sehen wuchs soweit an, dass er ihr am achten Abend eine Falle stellte und sie darum bat, ihr doch zuerst ein Lied singen zu dürfen. Daraufhin fiel das Myrtenfräulein ihrerseits in tiefen Schlaf und der Prinz erblickte in ihr die
„ wunderschönste Jungfrau, welche jemals gelebt, im Antlitz wie der klare Mond so mild und rein, Locken wie Gold um die Stirne spielend und auf dem Haupt ein Myrtenkrönchen […]. [S]ie hatte ein grünes Gewand an, mit Silber gestickt, und ihre Hände gefaltet wie ein Engelchen “ (aus „Das Märchen von dem Myrtenfräulein“).
Das vorliegende Gedicht ist nun genau jenes Einschlaflied, mit dem der Prinz das Myrtenfräulein zum Einschlafen brachte. Es wurde, wie eben das Hauptwerk in der Zeit der Romantik verfasst (1790 – 1830) und trägt auch deutliche Spuren dieser Epoche. Besonders das Hauptmotiv des Träumens und der starke lautmalerische Schreibstil sind äußerst typisch für romantische Werke.
Das Gedicht liegt aus unterschiedlichen Quellen in verschiedenen Versionen vor, welche sich allerdings ausschließlich in den Satzenden unterscheiden. Ich werde auf die vorliegende gedruckte Version von 1827 eingehen. Allgemein ist dieses Gedicht, welches sehr starke liedhafte Züge trägt, gegliedert in insgesamt 12 Verse ohne Unterteilung in Strophen. Als Reim bediente sich Brentano dem Kreuzreim (abab – cdcd - efef) und das Versmaß ist ein durchgängig 4-hebiger Trochäus, was beides zusammen dem Ganzen einen harmonischen, flüssigen Ton verleiht. Das ist bei einem Schlaflied auch durchaus angemessen, da ein solches eher beruhigend wirken soll, als faszinierend und spannend. Auch der ständige konstante Wechsel zwischen männlichen und weiblichen Kadenzen trägt einen gewissen liedhaften, aber beruhigenden Charakter. Noch mehr Harmonie bringt Brentano durch die Verwendung der beiden Anaphern in Zeile 1 & 2 („Hörst […] Hörst“) sowie in Zeile 4 & 5 („Selig […] Selig“) in das Gedicht ein. Es klingt, als ob der Prinz beim Singen einen besonders sanften Ton an den Tag legen möchte. Er spricht gleich am Anfang des Gedichtes das Myrthenfräulein bzw. direkt den Leser mit „du“ an, wobei die ersten beiden Zeilen zusammen eine Frage bilden. Hier stellt also das lyrische-Ich Fragen, welche allerdings eher als rhetorische Fragen zu verstehen sind, worauf also eigentlich keine Antwort erwartet wird. Es erscheint, als solle sich das Myrtenfräulein umhören und merken wie ruhig es doch um sie ist, nämlich so ruhig, dass sie sogar die Brunnen rauschen hören kann. Mit diesen Fragen soll beim Leser - zumindest hat es das bei mir - eine sanfte, leicht schwermütige Ruhe vermittelt werden. In Zeile 4 & 5 finden sich nun unübersehbare Merkmale romantischer Dichtkunst. „Selig, wer in Träumen stirbt“ (Z. 4), übermittelt die Botschaft, dass man nur glücklich und erfüllt sterben kann, wenn man in der Lage ist seinen Träumen freien Lauf zu lassen. Auch kann sich also der freuen, welcher im glückseligsten aller Zustände, dem Träumen sterben „darf“. Ein anderer Interpretationsansatz wäre, nicht davon auszugehen, dass mit dem Sterben wirklich das körperlich Sterben gemeint ist, sondern vielmehr das Schlafen. Dann würde man nur erholsame Nächte haben, wenn man fähig ist zu träumen. Selig beschreibt dabei einen Zustand, in dem man keine Probleme und keine Wünsche mehr hat. Und dieses kann man laut Brentanos Aussage also nur erreichen, wenn man zulässt, dass „der Traum den Flügel schwingt“ (Z. 8) und der „Mond ein Schlaflied singt“ (Z. 6). Diese beiden Personifikationen stehen für das Erreichen der Glückseligkeit, welches laut den Romantikern über die Träume geschieht. Im weiteren Verlauf beschreibt der Prinz die unendlichen Möglichkeiten in Träumen, so dass man sogar „an blauer Himmeldecke Sterne […] wie Blumen pflück[en]“ (Z. 9f) könne. Es soll das Myrtenfräulein und auch den Leser zu besonders schönen und fantasiereichen Träumen anregen, in denen man alle seine kühnsten Phantasien ausleben kann. Es folgt ein, wie eine Anleitung zum richtigen Träumen aufgebauter Klimax in Zeile 11: „Schlafe, träume, flieg, ich wecke“. Zuerst soll man schlafen, dann träumt man und in den Träumen fliegt man schließlich. Hier taucht auch das erste Mal das lyrische-Ich persönlich auf, welches das lyrische-Du aufwecken will, nachdem es geträumt hat. Es wird erwähnt, dass das lyrische-Ich also der Prinz beglückt ist wenn, das Myrtenfräulein wieder aufwachen wird, was man durchaus als Liebe ansehen könnte.
Nun stellt sich noch die Frage mit welchem Hintergrund Brentano diese direkte Ansprache und das Thema des Schlafliedes gewählt hat. Soll es überhaupt ein Schlaflied von einem Mann für eine Frau sein? Ohne die gesamte Geschichte vom Märchen des Myrtenfräuleins zu kennen, ergab sich mir erst der Eindruck es wäre ein Einschlaflied, welches sehr wohl auch von einer Mutter für ihr Kind gesungen werden könnte. Dieser Aspekt erscheint mir in sofern logisch, wenn man bedenkt, dass Brentano ein sehr gutes und inniges Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Nach ihrem Tod 1793 zentralisierte er sie zum Hauptthema vieler seiner Werke und idealisiert die Mutterliebe als Reinstes und Höchstes.
So könnte man nun das Gedicht in seinem Gesamtkontext betrachten, woraus sich schnell ergibt, dass es eine einschläfernde Wirkung auf das vom Prinzen verehrte Myrtenfräulein haben sollte. Oder man sieht es eben so, dass es, auf Brentanos Mutterliebe bezogen, eine Erlebnisschilderung vielleicht aus seiner Kindheit ist, in der ihm seine Mutter eventuell ebenfalls Einschlaflieder vorsang. In jedem Fall jedoch ist dieses Gedicht geprägt von absoluter Harmonie, Ruhe, Emotion und Geborgenheit. Es zeigt eindeutige Anzeichen für ein romantisches Gedicht, wofür die deutliche Ausformulierung der unbegrenzten Handlungsmöglichkeiten in Träumen spricht. Auch wertet Brentano darin, wie sich Menschen mit und ohne Träume entwickeln indem er sagt, dass nur der selig werde oder werden könne,
„wer in Träumen stirbt“ (Z. 4).
Wörter: 1316
Hiermit erkläre ich, das vorliegende Dokument
„ Gedichtsanalyse und –interpretation
Clemens Brentano - Hörst du wie die Brunnen rauschen “
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Gedichtsanalyse und -interpretation von Clemens Brentanos "Hörst du wie die Brunnen rauschen"?
Die Gedichtsanalyse und -interpretation befasst sich mit Clemens Brentanos Gedicht "Hörst du wie die Brunnen rauschen", das ursprünglich in seinem Werk "Das Märchen von dem Myrtenfräulein" enthalten ist. Die Analyse untersucht den historischen Hintergrund des Autors, die Einordnung des Gedichts in die Romantik und die Bedeutung verschiedener Elemente wie Reimschema, Versmaß, Anaphern und Personifikationen.
Wer war Clemens Brentano?
Clemens Brentano (1778-1842) war ein deutscher Schriftsteller der Romantik. Er stammte aus einer Familie mit künstlerischen Wurzeln, war mit Bettina von Arnim verwandt und veröffentlichte zusammen mit Achim von Arnim die Volksliedsammlung "Des Knaben Wunderhorn". Seine Werke zeichnen sich durch Phantasiereichtum und Metaphorik aus.
In welchem Kontext steht das Gedicht "Hörst du wie die Brunnen rauschen"?
Das Gedicht ist ein Schlaflied, das im Märchen vom Myrtenfräulein vom Prinzen gesungen wird, um das Myrtenfräulein in den Schlaf zu wiegen. Es ist ein Einschlaflied, das eine beruhigende Wirkung haben soll.
Welche Merkmale der Romantik finden sich in dem Gedicht?
Typische Merkmale der Romantik sind das Hauptmotiv des Träumens und der stark lautmalerische Schreibstil. Die Sehnsucht nach einer idealen Welt und die Betonung von Gefühlen und Fantasie sind ebenfalls präsent.
Welche formalen Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse betrachtet das Reimschema (Kreuzreim), das Versmaß (4-hebiger Trochäus), die Kadenz (wechselnd männlich und weiblich) sowie die Verwendung von Anaphern. Diese Elemente tragen zur harmonischen und beruhigenden Wirkung des Gedichts bei.
Was bedeutet die Aussage "Selig, wer in Träumen stirbt"?
Die Aussage wird als Botschaft interpretiert, dass man nur glücklich sterben kann, wenn man in der Lage ist, seinen Träumen freien Lauf zu lassen. Eine alternative Interpretation sieht das Sterben als Einschlafen, wodurch nur erholsame Nächte möglich sind, wenn man fähig ist zu träumen.
Welche Rolle spielt die Mutterliebe im Kontext des Gedichts?
Es wird angedeutet, dass das Gedicht möglicherweise auch als Ausdruck von Brentanos idealisierter Mutterliebe interpretiert werden kann, da er nach dem Tod seiner Mutter diese zum Hauptthema vieler seiner Werke machte und Mutterliebe als etwas Reines und Höchstes darstellte. Es könnte also auch ein Einschlaflied sein, wie es eine Mutter für ihr Kind singen würde.
Welche verschiedenen Interpretationsansätze gibt es?
Das Gedicht kann entweder als Einschlaflied im Kontext des Märchens vom Myrtenfräulein oder als Erlebnisschilderung aus Brentanos Kindheit interpretiert werden, in der ihm seine Mutter Einschlaflieder vorsang.
Was sind die wichtigsten Merkmale des Gedichts laut der Analyse?
Das Gedicht zeichnet sich durch Harmonie, Ruhe, Emotion und Geborgenheit aus. Es zeigt deutliche Anzeichen für ein romantisches Gedicht durch die Betonung der unbegrenzten Handlungsmöglichkeiten in Träumen.
- Arbeit zitieren
- Michael Mayerosch (Autor:in), 2005, Brentano, Clemens - Hörst du wie die Brunnen rauschen (aus "Das Märchen von dem Myrthenfräulein) - Gedichtsanalyse und -interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109763