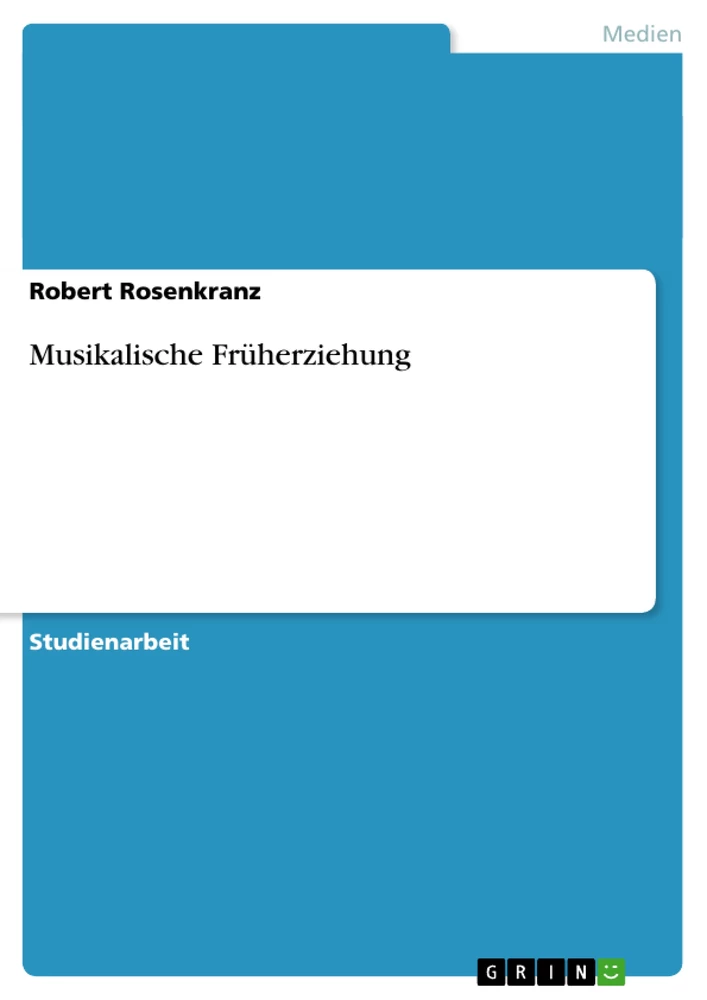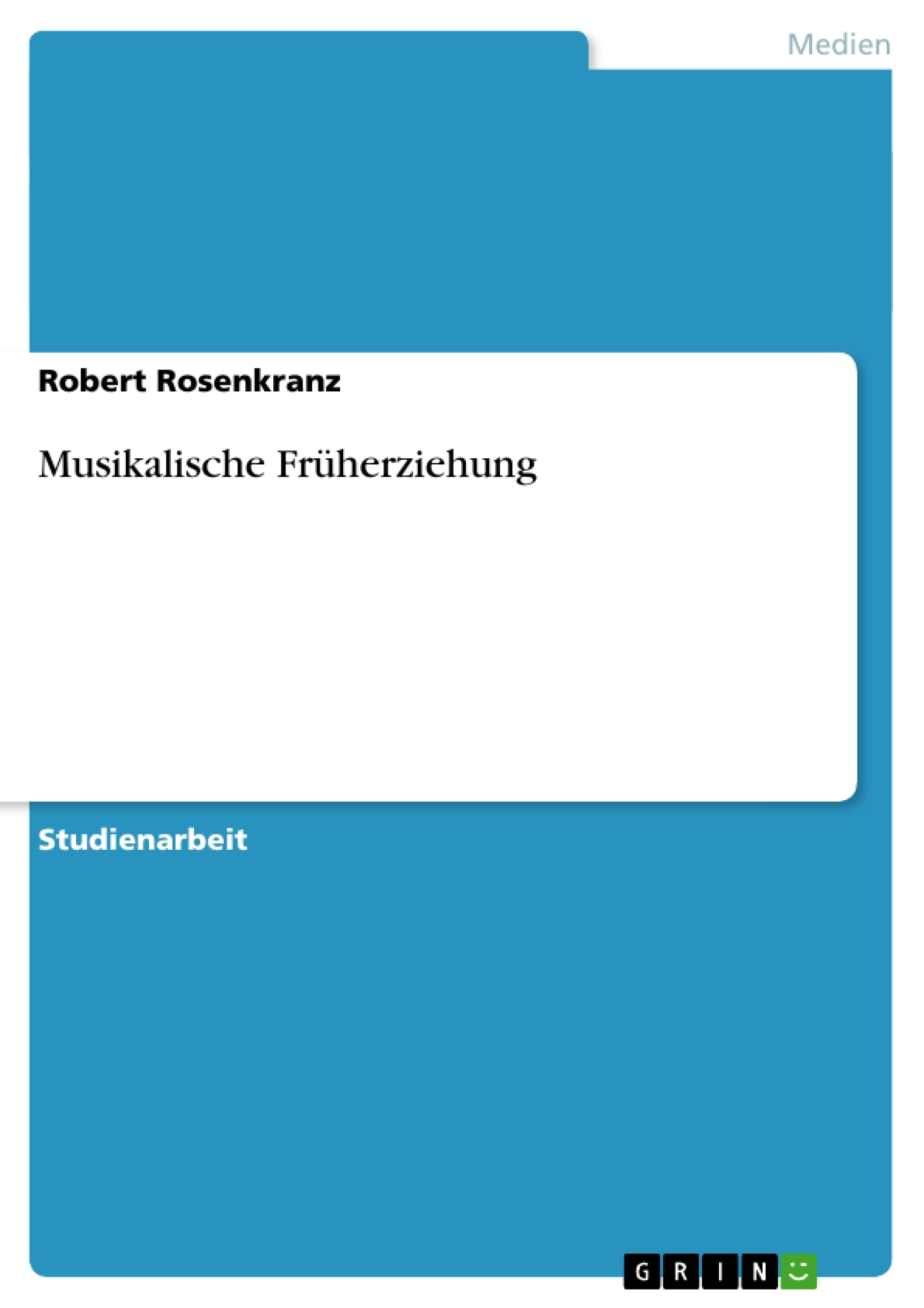Musikalische Früherziehung
1. Musikalische Früherziehung
Ausgangspunkt für die verstärkte Forschung auf dem Gebiet der allgemeinen Früherziehung war die Erkenntnis, dass Entwicklungsprozesse, die einen Grossteil unserer Entwicklungsmöglichkeiten im späteren Leben entscheidend beeinflussen, zu einem weit früheren Zeitpunkt einsetzen, als bisher angenommen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass eine systematische Förderung geistigen Potentials weit früher einsetzen muss als mit dem Eintritt in die Schule, also etwa im Alter von 6-8 Jahren.
Nach Auffassung der Wissenschaft liegt der Beginn von Lernprozessen im Bereich des Vorschulalters, wobei die für die Lernprozesse notwendige Lern- und Leistungsmotivation als Grundlage von Lernaktivitäten am günstigsten im Alter von 3-8 Jahren zu wecken und zu festigen ist.
Wichtig ist vor allem voranzustellen, dass Erziehung und die mit ihr zu erreichenden Ergebnisse nicht einzig abhängig sind vom Intellekt, als einer durch Herkunft von vornherein Festgelegten Größe. Erziehung findet vielmehr statt in einem Spannungsfeld von vielen auf das Kind einwirkenden Faktoren.
,,Innere Faktoren" sind dabei vor allem Intelligenz und Begabung, zwischen denen folgendermaßen zu differenzieren ist - Intelligenz kann als generelles Instrument zur Selbstbehauptung und Lebensbewältigung angesehen werden. Sie steht verschiedensten Aufgaben in unterschiedlichen Lebenslagen gegenüber, hat demzufolge keine besondere qualitative Ausrichtung auf ein bestimmtes Gebiet.
Ihr gegenüber steht als innerer Faktor die Begabung, die als bestimmte Leistungsbereitschaft Im Hinblick auf ein bestimmtes Betätigungsfeld beschrieben werden kann. Begabung ist demnach eine zu entwickelnde geistige Fähigkeit. Sie beeinflusst jedoch selber die Persönlichkeitsentwicklung, indem sie innere Antriebe, Interessen und Motive verstärkt oder in eine bestimmte Richtung lenkt.
Äußere Faktoren, die Erziehungserfolge mitbestimmen, können nicht abschließend aufgezählt werden. Sie stellen die sozialen und kulturellen Bedingungen dar, unter denen ein Kind aufwächst - wird ein Kind intensiv dazu angeregt, sich in Form von Spielen oder anderen Beschäftigungen mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen, seien es andere Kinder, Menschen oder die Natur, wird es mehr Fähigkeiten entwickeln, als ein Kind, dem diese Anregungen fehlen. Vorraussetzungen für die Entwicklung ist neben Hinwendung auch solcher materieller Art - wie Zeit und Raum, sowie finanzielle Mittel, die für eine Ausbildung zur Verfügung stehen. Optimal wäre es, soviel als möglich dieser Faktoren zu beeinflussen. Erziehung im Vorschulalter sollte demnach vor allem darauf zielen, Grundlagen für späteres Lernen und Denken zu entwickeln, als da sind:
- Selbständigkeit und Unabhängigkeit
- Originalität und Neugier
- differenziertes Sprachverhalten
- schöpferisches Tun
- Symbolverständnis
- Sinnesschulung
- Raumvorstellungen
- erste logische Operationen
Im Umgang mit Vorschulkindern muss dabei besonders darauf geachtet werden, dass Erziehung sich der Mittel bedient, die Kinder in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt nutzen, dies ist vor allem das Spiel. Spielend zu lernen kann jedoch nur dann zur Entwicklung der genannten Voraussetzungen führen, wenn ins ,,freie Spielen" Lernaktivitäten mit einem stetigem Verlauf und steigendem Schwierigkeitsgrad einbezogen werden. Ziel der Entwicklung in der Elementarstufe ist es demnach vor allem, Kindern ein ihrer Alterstufe entsprechendes Bildungsangebot verfügbar zu machen, welches ihre Entwicklungsmöglichkeiten erhöht und sich darum bemüht, umwelt- oder entwicklungsbedingte Benachteiligungen auszugleichen.
1.1. Probleme einer musikalischen Früherziehung
Zum Verständnis der Problematik einer musikalischen Früherziehung ist zu verdeutlichen, in welchem Verhä ltnis zueinander sich die Faktoren der
- musikalischen Begabung
- Musikalität
- und musikalischen Fähigkeiten
sich zueinander befinden. So wird weitgehend vertreten, dass musikalische Fähigkeiten entwickelbar sind, allerdings durch Begabung unterschieden und geprägt. So ergeben empirische Untersuchungen, dass etwa 85 % aller Menschen ´musikalisch´ sind, das heißt, unter entsprechenden Bedingungen in Ihrer Umgebung sich musikalische Fähigkeiten aneignen können. Unterbleiben dagegen musikalische Aktivitäten, wird die Entwicklung einer musikalischen Begabung gehemmt, bzw. gar nicht ausgelöst. Diese Überlegungen finden vor allem in den die musikalische Früherziehung prägenden Prinzip ,,Durch Musik zur Musik,, ihren Ausdruck. Um Musikalität von musikalischer Begabung abzugrenzen, ist festzuhalten, dass Musik ein Komplex darstellt, der aus der ständigen Praktischen Auseinbandersetzung mit musikalischen Sachverhalten in musikalischen Tätigkeiten entspringt. Sie ist demnach direkt abhängig von dem Grad an erreichten musikalischen Fähigkeiten und folglich primär umweltbedingt. Inwieweit äußeres musikalisches Können gesteigert wird durch schöpferische Akzente, d.h. eine eigene Interpretation der Musik, die über die reine Reproduktion derselben hinausgeht, stattfindet, ist der Grad des Begabungsniveaus entscheidend. Zu entwickelnde musikalische Fähigkeiten sind vor allem
- musikalisches Hören
- Tongedächtnis
- motorische Fähigkeiten und
- geistige musikalische Fähigkeiten.
Zusammengefasst lassen sich diese Begriffe als ´Melodiebewußtsein` beschreiben.
Ziel einer musikalischen Früherziehung muss es demnach sein, in einem systematischen Lernprozess ein solches möglichst frühzeitig zu entwickeln.
2. Musikalische Tätigkeiten in der musikalischen Früherziehung
Ziel der musikalischen Früherziehung ist es, dem Kind das Medium Musik so zu erschließen, dass es mit ihm umgehen kann, es ihm mit der Zeit zum selbstverständlichen Ausdrucksmittel wird. Die ist nicht möglich durch Zufall oder sporadische Beschäftigung mit Kindern im Vorschulalter, sondern durch systematische Bemühungen und konsequente Anleitung und Führung. Die Erschließung von Musik erfordert vor allem das Erleben und Erforschen verschiedener musikalischer Tätigkeiten und deren wechselseitige Ergänzung und Verflechtung. Vielseitige musikalische Betätigung umfasst deshalb vor allem Folgendes:
- Musik bewegungsmäßig zu gestalten in Form von Rhythmik und Tanz
- Musik hören
- Musik lesen und schreiben
- Musik machen ( Singen, Musizieren )
- Musik verstehen
Um einen nachhaltigen Lerneffekt in der Beschäftigung mit diesen Tätigkeiten zu erzielen, ist es wichtig, dass, wenn ein neues Thema in Angriff genommen wird, die musikalischen Erfahrungen aus vorangegangen Unterrichtsabschnitten wieder aufgegriffen werden und dadurch auf die neue musikalische Tätigkeit einwirken. Durch eine solche ständige Wiederholung, Ergänzung, Vertiefung und Verknüpfung musikalischer Tätigkeiten, wird im Laufe der Zeit eine musikalische Praxis entstehen, die zur Entfaltung von Musikalität bei jedem Kind entsprechend seiner Anlagen und Bemühungen führen. Dies und nicht die isolierte Suche nach besonderen Begabungen ist vornehmlich Aufgabe der musikalischen Früherziehung.
2.1. Musik bewegungsmäßig gestalten
Bewegungserziehung beinhaltet in erster Linie die Beschäftigung mit Rhythmik und Tanz. Ihnen ist das Ziel gemeinsam, den Körper zum Instrument des Ausdrucks zu machen. Sie bietet sich an, an den Anfang der musikalischen Früherziehung gestellt zu werden. Rhythmik stellt den Körper in den Mittelpunkt der Beschäftigung und lässt Kinder Bewegungserfahrungen gewinnen, die besonders wichtig für die Entwicklung eines Körperbewusstseins sind. Sie entstehen durch Beantwortung von Reizen aus Zeit, Raum, Kraft und Form, die mit den Mitteln des Tastens, Sehens und Hörens gewonnen werden. Aus dieser Auseinandersetzung von Mensch und ihn umgebender Wirklichkeit können sich Fähigkeiten wie Urteilsvermögen, Konzentration, Reaktion, Phantasie, Spontaneität, Willenskraft und Gestaltungskraft zu entwickeln. Am Anfang wirkt die Musik hier mehr, als ein Medium, ohne selbst im Vordergrund der Wahrnehmungen zu stehen. Später ist es wichtig, musikalische Sachverhalte und Ordnungsprinzipien bewusst zu machen, und durch Bewegungserfahrungen zu verdeutlichen. Die Rhythmik erfüllt die Rolle eines Mittlers zwischen Mensch und Musik und dient der Erlernung der Differenzierung musikalischer Details.
Dass Tanz eine wichtige Ausdrucksform im kindlichen Alter ist, zeigt die große Anzahl an Spielliedern. Sie spricht für ein Bedürfnis des Kindes, den gesungenen Text bewegungsmäßig zu gestalten und bietet sich deshalb als Beschäftigungsform an. In der Auseinandersetzung mit geeignetem Liedmaterial kann das Kind ein Repertoire an Schritt-, Lauf-, Hüpf- und anderen Bewegungstypen gewinnen, die Vorraussetzung für weitere tänzerische Darstellungsweisen sind. Eine Gewöhnung an die tänzerische Darstellung von Liedern ist im fortgeschrittenen Ausbildungsstadium von Bedeutung, wenn das textgebundene Lied von der nicht textgebundenen Musik als Grundlage abgelöst wird. Dieser Übergang ist für Kinder schwierig, da Orientierungspunkte, die bislang der Liedtext bot, fehlen, und nun aus der Musik entnommen werden müssen oder deren formaler Gliederung. Eine intensive Hörerziehung ist Vorraussetzung, wenn ein solcher Übergang gelingen soll.
Bei der Auswahl der Musikstücke ist darauf zu achten, dass sie möglicht einen geraden Takt aufweisen, da Stücke im ungeraden Takt für Kinder schwerer zu erfassen sind und demgemäss Schwierig bewegungsmäßig umzusetzen. Besonders empfehlenswert sind vor allem Musikstücke, die durch ihren programmatischen Charakter bereits Anregungen für eine mögliche Umsetzung in Bewegung geben - als Beispiele kann aus Robert Schumanns ,,Album für die Jugend": ´Der wilde Reiter´ dienen. Wichtig ist die Beschäftigung mit dem Tanz innerhalb von Kindergruppen insbesondere auch für die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten wie Toleranz, Integrationsvermögen, Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit gegenüber anderen Mitgliedern der Gruppe. Darbietungen innerhalb der Gruppe beziehen sich immer auf einen Partner und werden als Leistung der Gemeinschaft angesehen.
2.2. Musik hören
Die Gabe des Hörens ist jedem Kind eigen.
Aufgabe der musikalischen Früherziehung ist es jedoch, das Kind vom undifferenzierten Hören wegzuführen, wie es zumeist zu Hause als Folge des Überangebots durch die Massenmedien geschieht. Musikerlebnis wird vor allem möglich durch ein bewusstes Ablaufes von Tönen untereinander, von Spannungsverläufen innerhalb der Musik.
Eine solche Wahrnehmung setzt die Fähigkeit voraus, Intervalle und Intervallverbindungen zu erkennen, sowie deren Bedeutung, die sie durch ihre Beziehung zum Grundton erhalten. Diese Fähigkeit wird als relatives Hören bezeichnet. Darüber hinaus führt das funktio nale Hören, welches die Wahrnehmung bestimmter melodischer und harmonischer Qualitäten von Motiven beschreibt. Zur Verdeutlichung sei hingewiesen auf die unterschiedliche Dynamik, welche den folgenden Melodieverbindungen innewohnt. Das Leiermotiv 5-6-5-3 oder eine aufsteigende Tonfolge 1-2-3-4-5 , die Verbindung des Leittons mit dem Grundton 7-8 des Gleittons mit der Terz 4-3 bleiben unverändert, wenn sie in eine andere Tonart transponiert werden. Die absolute Tonfolge g-a-g-e verändert jedoch ihren Charakter durch Veränderung der Tonalität z.B. von C-Dur nach G-Dur nach F-Dur nach E-Dur und gewinnt dadurch eine andere inhaltliche Qualität. Einsicht in melodische Zusammenhänge der Töne zum Grundton und untereinander zu vermitteln, ist deshalb Anliegen der musikalischen Früherziehung. Es bedarf hierzu letztlich auch des Mithörens anhand von Noten und der entsprechenden Kenntnisse in Notenschrift.
Wenn der Anfang der musikalischen Betätigung nicht in der musikalischen Früherziehung wesentlich in der Beschäft igung mit dem Kinderlied liegt, wird sich der Unterricht vorerst auf die Erkundung des Durtonraumes beschränken, da der absolut überwiegende Anteil ( über 90 % ) der europäischen Kinderlieder sich in diesem Tonraum bewegt. Andere Klangräume können demnach weniger auf der Basis des Singens erkundet werden, als über das Hören. Dieses Erleben ist umso intensiver und das Erlernte umso nachhaltiger, wenn die Kinder zu richtigem Zuhören ( welches sich nicht nur auf Rezeption beschränkt ) und zum Gespräch über das Gehörte angehalten werden. Um dies zu ermöglichen, ist besonders darauf zu achten, dass kurze instruktive Hörbeispiele gewählt werden, die die kindliche Konzentrationsfähigkeit nicht überfordern, und die dem Kind etwas hörbar werden lassen, was ihm fassbar, interessant und bedeutsam ist. Hörendes ´Bemerken´ kann sich dabei auf den Inhalt ( programmatische Aussage, erzählende und malende Musik ), den Klangcharakter ( Instrumentierung, Solostimme, Chor ), die formale Anlage eines Musikstückes ( A-B, A-B-A, gleiche Melodieteile) und auf dynamische Elemente beziehen (f, p, cresc., decresc., accel., etc. ). Mit zunehmender Hörerfahrung kann dann vom Wahrnehmen formaler Kategorien auf die Wahrnehmung ästhetischer Hörkategorien übergegangen werden. Hörbeispiele können aus allen Gattungen und Stilrichtungen gewählt werden, auch die zeitgenössische Musik bietet instruktive Beispiele und sollte nicht ausgeschlossen werden. Eine anhand solcher Gesichtspunkte durchgeführter Musikerziehung wird nicht nur zur Entwicklung von Fähigkeiten zum relativ - funktionalen Hören und Notenlesen beitragen, sie wird auch zu einem tieferen Musikverständnis führen.
2.3. Musik lesen und schreiben
Musik lesen und schreiben zu lernen ist deshalb unverzichtbarer Teil auch von Musikerziehung im Vorschulalter, da nur Notenschrift die flüchtige akustische Wahrnehmung in ein optisches Schema bindet und dadurch einen zusätzlichen Verstehensweg zur Musik ermöglicht. Es sollte sich im Unterricht nicht auf die Vermittlung der herkömmlichen Notation beschränkt werden, die Kinder sollten auch behutsam an grafische Notation herangeführt werden, wie sie vor allem in der zeitgenössischen Musik gängig sind. Schwierig ist dabei, der Notenschrift ihre intellektuelle und abstrakte Form zu nehmen, um sie den Kindern leichter verständlich zu machen. Das kann erreicht werden durch methodische Vereinfachungen unter Zuhilfenahme optisch-akustischer Anschauungsmittel. Hier bietet sich vor allem die Darstellung der einzelnen Tonstufen mittels Handzeichen und grafisch mittels Haftbausteinen für die Tafel, und las Stecksystem ( vergleichbar den Zählstäbchen für den Beginn des Mathematikunterrichtes ) für den Gebrauch des Schülers an. Erforderlich sind außerdem entsprechend ausgewählte Musikbeispiele, damit akustisches Hörerlebnis mit Notenlesen und Notenlernen verbunden werden kann. Im Bereich der Notation ist es wichtig, den Kindern die Tonqualität der sieben Tonstufen und ihre unveränderte Beziehung zum Grundton und untereinander erlebbar zu machen. Besonders geeignet sind hierfür die Tonarten C-Dur, F-Dur und G-Dur.
Ziel ist es nicht, den Kindern das Blattsingen beizubringen, sondern die Fähigkeit, schriftlich fixierte Musik in Klangvorstellungen umzusetzen. Das Schreiben von Musik ist mangels Bedeutung in der Praxis jedenfalls nicht von gleicher Bedeutung. Dem spielerischen Charakter der Früherziehung entspricht viel mehr die Beschäftigung mit den vorgefertigten, farbigen Notensymbolen an der Tafel.
2.4. Musik machen ( singen )
Im Vorschulalter ist Singen für ein Kind noch Lebensäußerung, Auseinandersetzung mit Lebenswirklichkeit und Wiederspiegelung seiner Umwelt. Die mag sich für den Heranwachsenden angesichts der Medienflut anders darstellen, hat jedoch für dieses Alter noch seine Berechtigung. Ein Kind vermag noch nicht im selben Umfang zwischen Realität und Unwirklichkeit zu unterscheiden, wie ein Erwachsener, es nimmt das Märchen im Lied ebenso an, wie eine wahre Geschichte und vollzieht sie durch Singen als eigenes Erlebtes nach. Singen bietet dem Kind folglich eine Chance, seine Umwelt zu erkennen und zu begreifen, und gleichzeitig seine Sprache zu entwickeln und zu verbessern. Bei der Auswahl des Liedmaterials sind vor allem folgende Gesichtspunkte zu beachten:
- es soll textlich und musikalisch eine Einheit bilden und dem kindlichen Fassungsvermögen entsprechen
- es sollte deutsches Liedgut an geeigneter Stelle durch ausländisches ergänzt werden
- die textliche Vorlage sollte der kindlichen Lebenswirklichkeit entnommen sein, so wird der Anreiz, sich mit diesem Lied zu beschäftigen geschaffen
- musikalisch sollte das Lied interessant sein und musikalisch Sachelementares enthalten, es hat im Unterricht weitgehend dienende Funktion
- der Tonumfang sollte allmählich gesteigert werden um die Singfähigkeit und den
Umfang der Stimmlage zu erweitern, erforderlich sind hierfür außerdem entsprechende Stimmbildungs- und Atmungsübungen - der Lehrer muss außerdem ein entsprechende Vorbild abgeben - Kinder lernen im Vorschulalter vor allem durch Nachahmung.
2.5. Musizieren
Zunächst bedient sich das Kind als Reaktion auf äußere Reize seiner natürlichen Instrumente des Körpers, der Körperteile und der Stimme. In der weiteren Entwicklung treten zwischen Körper und instrumentale Aussage ein Medium - das Instrument. Eingedenk dieser Umstände wird an den Anfang der musikalischen Früherziehung die Beschäftigung mit den natürlichen Schlaginstrumenten des Kindes - Händen und Füßen gestellt werden. Es können verschiedene Schrittformen entwickelt (gehen laufen schreiten stampfen hüpfen) und verwendet werden , ebenso wie das Fingerschnalzen und Ähnliches. Auf einer weiteren Stufe kann ein kleines Schlagwerk eingeführt werden. Dies kann zu einer differenzierten Hörerziehung beitragen und eine Empfindlichkeit für die Klanqualitäten einzelner Instrumente wecken. Wichtig ist vor allem, dass der Gebrauch der Instrumente vorbildlich vorgeführt wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der musikalischen Früherziehung?
Das Hauptziel der musikalischen Früherziehung ist es, Grundlagen für späteres Lernen und Denken zu entwickeln, wie Selbstständigkeit, Originalität, differenziertes Sprachverhalten, schöpferisches Tun, Symbolverständnis, Sinnesschulung, Raumvorstellungen und erste logische Operationen.
Welche Faktoren beeinflussen die musikalische Entwicklung eines Kindes?
Die musikalische Entwicklung eines Kindes wird durch innere Faktoren wie Intelligenz und Begabung, sowie äußere Faktoren wie soziale und kulturelle Bedingungen, Anregungen aus der Umgebung und materielle Voraussetzungen (Zeit, Raum, finanzielle Mittel) beeinflusst.
Was ist der Unterschied zwischen musikalischer Begabung und Musikalität?
Musikalische Begabung ist eine angeborene Leistungsbereitschaft in Bezug auf Musik, während Musikalität ein Komplex ist, der aus der praktischen Auseinandersetzung mit Musik in musikalischen Tätigkeiten entsteht und somit umweltbedingt ist.
Welche musikalischen Fähigkeiten sollen in der Früherziehung entwickelt werden?
Zu entwickelnde musikalische Fähigkeiten sind musikalisches Hören, Tongedächtnis, motorische Fähigkeiten und geistige musikalische Fähigkeiten, zusammengefasst als Melodiebewusstsein.
Welche musikalischen Tätigkeiten sind wichtig in der musikalischen Früherziehung?
Wichtige musikalische Tätigkeiten sind: Musik bewegungsmäßig gestalten (Rhythmik, Tanz), Musik hören, Musik lesen und schreiben, Musik machen (Singen, Musizieren) und Musik verstehen.
Warum ist Bewegungserziehung ein wichtiger Bestandteil der musikalischen Früherziehung?
Bewegungserziehung, insbesondere Rhythmik und Tanz, helfen Kindern, ein Körperbewusstsein zu entwickeln und musikalische Sachverhalte durch Bewegungserfahrungen zu verdeutlichen. Sie fördert auch soziale Fähigkeiten in Gruppenaktivitäten.
Was bedeutet relatives Hören und warum ist es wichtig in der musikalischen Früherziehung?
Relatives Hören ist die Fähigkeit, Intervalle und Intervallverbindungen zu erkennen und deren Bedeutung in Bezug zum Grundton zu verstehen. Es ist wichtig für ein bewusstes Musikerlebnis und die Wahrnehmung von Spannungsverläufen innerhalb der Musik.
Warum ist das Lesen und Schreiben von Musik wichtig in der musikalischen Früherziehung?
Das Lesen und Schreiben von Musik bindet die flüchtige akustische Wahrnehmung in ein optisches Schema und ermöglicht dadurch einen zusätzlichen Verstehensweg zur Musik. Es fördert die Umsetzung von schriftlich fixierter Musik in Klangvorstellungen.
Welche Aspekte sind bei der Liedauswahl für die musikalische Früherziehung zu beachten?
Bei der Liedauswahl sind folgende Aspekte wichtig: Einheit von Text und Musik, kindliches Fassungsvermögen, Ergänzung von deutschem Liedgut durch ausländisches, Bezug zur kindlichen Lebenswirklichkeit, musikalisches Interesse und elementare musikalische Inhalte, allmähliche Steigerung des Tonumfangs.
Welche Rolle spielt das Musizieren mit Instrumenten in der musikalischen Früherziehung?
Das Musizieren mit Instrumenten beginnt mit dem Einsatz des eigenen Körpers (Hände, Füße) und der Stimme. Später können kleine Schlagwerke eingeführt werden, um die Hörerziehung zu differenzieren und die Empfindlichkeit für Klangqualitäten einzelner Instrumente zu wecken.
- Quote paper
- Robert Rosenkranz (Author), 2000, Musikalische Früherziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99984