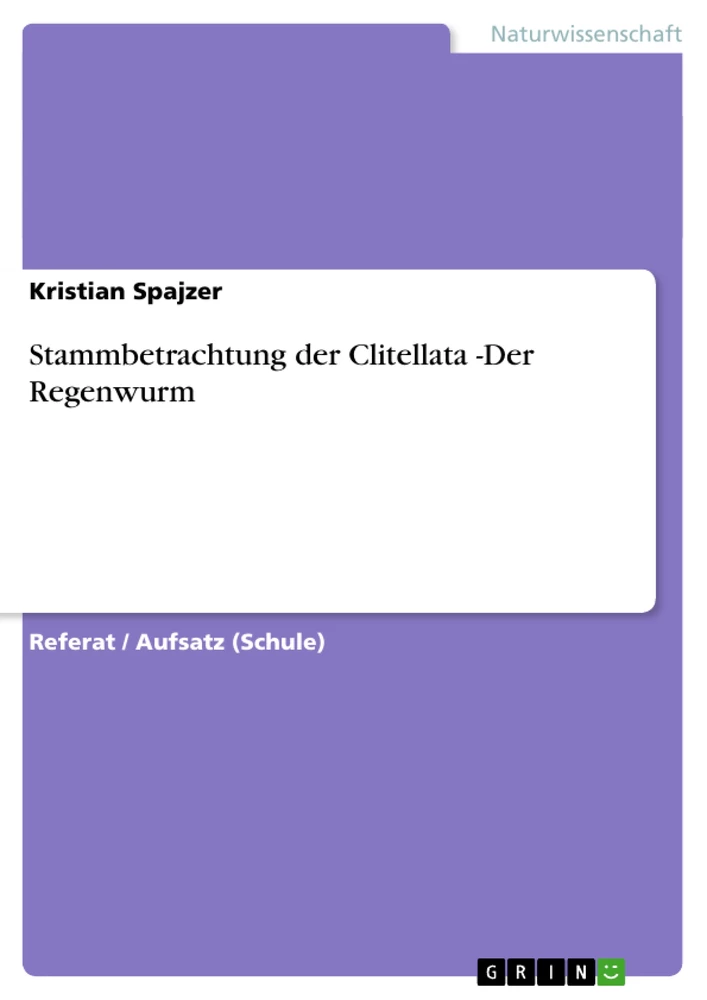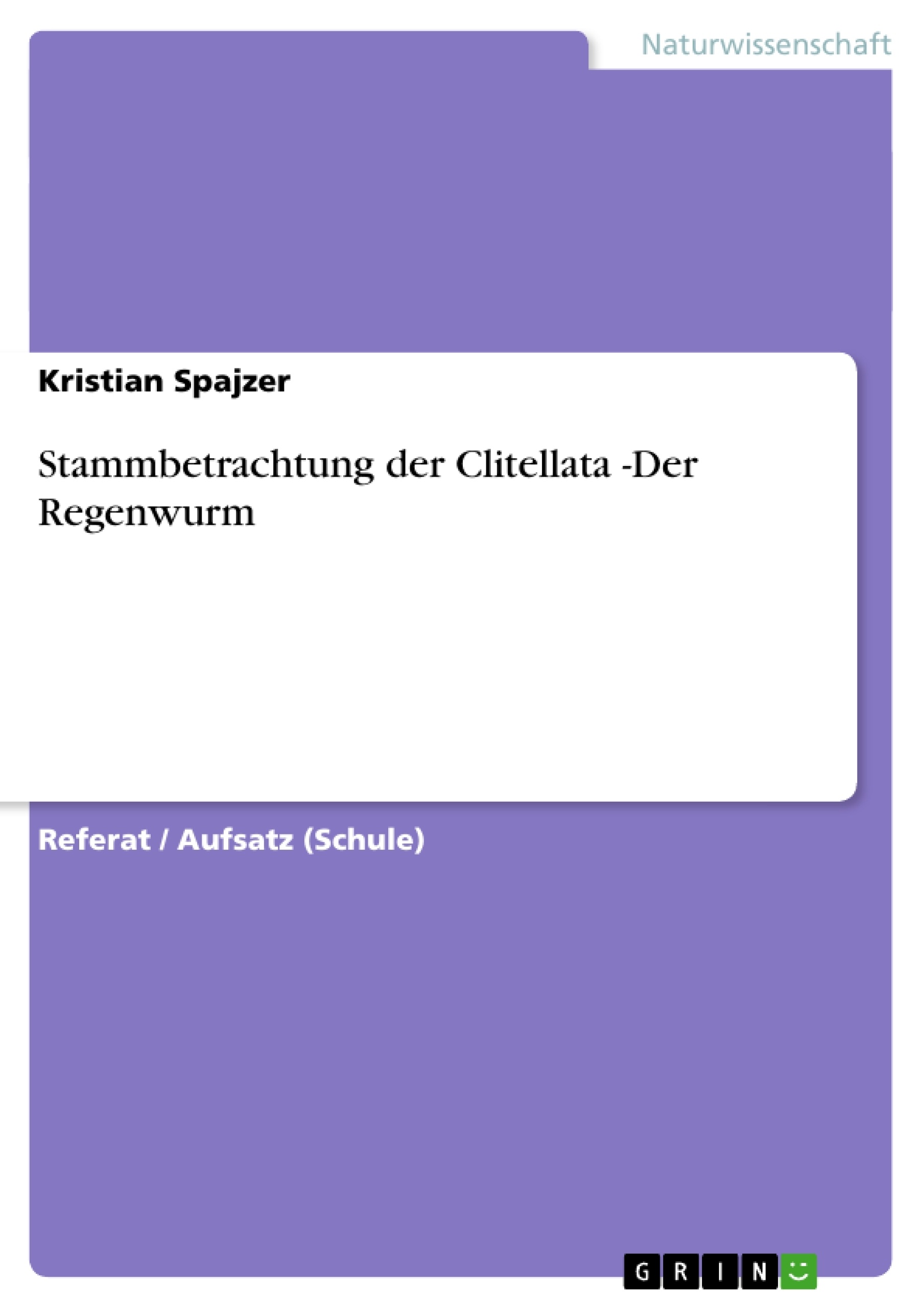Betrachtung der Clitellata
Systematische Stellung:
Unterreich: Metazoa ( Vielzeller )
Abteilung: Eumetazoa ( echte Vielzeller ) Unter-Abteilung: Bilateria
Stamm: Annelida
Klasse: Clitellata
Besondere Merkmale des Stamms :
- Homonome Metamerie (Segmentierung)
- Alle Segmente sind gleich gestaltet
- Abgegrenzt durch Dissepimente (Querwände)
- Hydroskelett
- Hautmuskelschlauch + Coelomflüssigkeit + Borsten
- Zwei Coelome pro Segment
- Darmtrakt
- Eine Mundöffnung und ein After
- Pharynx, Ösophagus, Kropf, Muskelmagen, Mitteldarm
- Geschlossenes Blutgefäßsystem
- Hautatmung
- Exkretionsorgane _ Metanephridien
- Strickleiternervensystem
- Cerebralganglion mit Bauchmark
- Komplexe Geschlechtsorgane
Nahrungs-, bzw. Stoffaufnahme:
- Versteifung des Pharynx und Aufnahme von mineralische und organischen Stoffen
- Nahrung durchläuft Ösophagus und landet im Kropf
- Kleine Steinchen im Muskelmagen zerreiben durch Muskelkontraktion die Nahrung
- Zerriebene Nahrung wird an den Mitteldarm weitergeleitet
- Oberflächenvergrößerung durch Einstülpung (Typhlosolis) und Auskleidung mit Darmepithel
- Resorption von brauchbaren Stoffen und Weiterleitung ins Blut
- Fettspeicherung und Glykogensynthetisierung in Chloragogzellen (umgewandelte Zellen des Coelomepithels)
- Bildung von Harnstoff und Harnsäure
Atmung:
- Durch die Haut
- Sauerstofftransport im Blut durch Hämoglobin
- O2 Aufnahme und CO2 Abgabe durch Blutkapillaren in der Haut
Exkretion:
- Durch Metanephridien
- Jeweils eins recht und eins links vom Darm pro Coelom und Segment
- in Querschlingen liegende Kanäle, beginnend mit einem Wimpertrichter
- Endabschnitt wird als Harnblase bezeichnet endet mit Exkretionsporus nach außen _ endet mit Exkretionsporus nach außen
- Produktion des Primärharns an den mit Blutgefäßen versorgten Coelomwänden
- Einstrudelung des Primärharns in den Wimpertrichter
- Resorption von noch brauchbaren Stoffen in der Harnblase
- Ausscheiden des Harns am Exkretionsporus, der im nächsten Segment liegt
- Durch den After wird unverdautes aus dem Darm ausgeschieden
Kreislauf:
- Geschlossenes Kreislaufsystem
- Fünf laterale Herzen, bzw. Schlingen, pumpen Blut ins ventrale Blutgefäß
- Blut im dorsalen Blutgefäß fließt Richtung Prostomium, um im ventralen Richtung Pygidium
- Blut aus dem ventralen Blutgefäß fließt durch Dorsoparietalgefäße in das dorsale Blutgefäß
Nervensystem:
- Zentrales Nervensystem ist das Cerbralganglion
- Davon gehen zwei Nervenstränge in die Pharynx zur Bindung mit den Sinnesorganen im Prostomium
- Verbindung mit dem Bauchmark durch zwei Nervenleitungen
- Vereinigung der Nervenbahnen im Bauchmark als Unterschlundganglion _ vier zusammengerückte Ganglienpaare (enthalten Somata)
- Das Bauchmark besteht aus zwei Strängen segmentierter Ganglien, die durch Konnektive verbunden sind
- ventrales Strickleiternervensystem
- In jedem Segment gehen zwei Paar Nerven ab, die in den Hautmuskelschlauch übertreten
Fortpflanzung:
- Geschlechtsapparat besteht aus:
- Hoden
- Ansammlung von Zellen die Spermatozoen entwickeln
- umgeben von Samenkapseln und Samenblase
- Samentrichter der zu den männlichen Geschlechtsöffnungen führt
- Ovarien
- zur Eiproduktion
- Eihälter
- Eileiter der zu den weiblichen Geschlechtsöffnungen führt
- Receptaculum seminis mit Mündung
- Gametenreifung:
- Hodenzellen produzieren unvollständige Spermatozoen
- Auffangen durch die Samenkapsel
- Weiterleitung zu den Samenblasen zur vollständigen Differenzierung
- Bei beendeter Reifung, Weiterleitung der Spermatozoen durch Samentrichter und Samenleiter zu den männlichen Geschlechtsöffnungen
- Ovarien produzieren unvollständige Ei- Zellen
- Auffangen durch Eitrichter
- Vollständige Differenzierung
- Weiterleitung durch Eileiter zu den weiblichen Geschlechtsöffnungen
- Befruchtung:
- Produktion von Schleim an den Drüsenzellen des verdickten Clitellums
- Zwei proterandische Zwitter verkleben
- Spermatozoenweiterleitung aus männlicher Geschlechtsöffnung über externe Samenrinne zur Mündung des Receptaculum seminis
- Speicherung der Spermatozoen im Receptaculum seminis
- Bildung eines Schleimringes am Clitellum
- Schleimring wandert zu weiblichen Geschlechtsöffnungen
- Einlegen von einem oder mehreren Eiern
- Schleimring wandert weiter zu den Mündungen des Receptaculum seminis
- Einführung des gespeicherten Samens in den Schleimring uns somit Befruchtung der Eier
- Schleimring schnürt sich am Prostomium ab
- Aus abgeschnürtem Schleimring bildet sich ein neuer Wurm
Fortbewegung:
- Kontraktion der Ringmuskeln am Kopfpol
- Streckung des vorderen Bereiches
- Coelom mit Flüssigkeit ist Antragonist zu den Ringmuskeln
- Darauf folgt davor und dahinter lokale Kontraktionswelle der Längsmuskeln
- lokale Verdickung zieht Körper nach vorn
- Zurückrutschen wird durch Ausfahren der Borsten verhindert
- Erneute Streckung durch Kontraktion der Ringmuskeln
- Peristaltische Welle verläuft entgegengesetzt der Fortbewegungsrichtung
- Erstreckt sich meist über 10 bis 15 Segmente
- Meist zwei peristaltische Wellen gleichzeitig
- Die gestreckten Segmente Bewegen sich relativ zum Untergrund
- Fortbewegungsgeschwindigkeit beträgt ca. 2 cm/s
Sonstiges:
- Prostomium = zugespitzt
- Pygidium = abgerundet und abgeplattet
- Bauchseite ist abgeflacht
- Rückenseite ist abgerundet und meist dunkler als Bauchseite
- Männliche Geschlechtsöffnung in Segment Nr. 15
- Weibliche Geschlechtsöffnung in Segment Nr. 14
- Clitellum erstreckt sich über die Segmente 32 bis 37
- Der Wurmbauplan ist immer gleich
- Immer gleiche Organe in gleichen Segmenten
- Haut ist feucht und glatt
- Verdunstungsschutz
- Ventrale und laterale Borstenpaare sind vorhanden
- entgegen der Laufrichtung gerichtet
- durch Muskeln möglich zum Ein- und Ausfahren
- immer gleiche Anzahl
- im Prostomium und Pygidium nicht vorhanden
- bei Anheftung eines Zettels an Borsten bleibt Zettel stationär
- Winterverhalten
- Eingerollt und Kältestarre in 2m Tiefe
- Hautmuskelschlauch (Ring-&Längsmuskulatur) um Coelom sowie Darm
Häufig gestellte Fragen
Was ist die systematische Stellung der Clitellata?
Die Clitellata gehören zum Unterreich Metazoa (Vielzeller), der Abteilung Eumetazoa (echte Vielzeller), der Unter-Abteilung Bilateria, dem Stamm Annelida und bilden die Klasse Clitellata.
Welche besonderen Merkmale hat der Stamm der Annelida?
Die Annelida zeichnen sich durch homonome Metamerie (Segmentierung) aus, wobei alle Segmente gleich gestaltet und durch Dissepimente (Querwände) abgegrenzt sind. Sie besitzen ein Hydroskelett bestehend aus Hautmuskelschlauch, Coelomflüssigkeit und Borsten. Jedes Segment enthält zwei Coelome. Der Darmtrakt erstreckt sich vom Mund bis zum After und beinhaltet Pharynx, Ösophagus, Kropf, Muskelmagen und Mitteldarm. Ein geschlossenes Blutgefäßsystem, Hautatmung, Exkretionsorgane (Metanephridien) und ein Strickleiternervensystem (Cerebralganglion mit Bauchmark) sowie komplexe Geschlechtsorgane sind ebenfalls charakteristisch.
Wie erfolgt die Nahrungsaufnahme und Stoffaufnahme bei den Clitellata?
Die Clitellata versteifen den Pharynx zur Aufnahme von mineralischen und organischen Stoffen. Die Nahrung gelangt über den Ösophagus in den Kropf und wird im Muskelmagen durch kleine Steinchen zerrieben. Im Mitteldarm, dessen Oberfläche durch Einstülpungen (Typhlosolis) und Darmepithel vergrößert ist, erfolgt die Resorption brauchbarer Stoffe ins Blut. Chloragogzellen (umgewandelte Zellen des Coelomepithels) speichern Fett, synthetisieren Glykogen und bilden Harnstoff und Harnsäure.
Wie atmen die Clitellata?
Die Clitellata atmen durch die Haut. Der Sauerstofftransport im Blut erfolgt durch Hämoglobin. In den Blutkapillaren der Haut findet der Gasaustausch (O2-Aufnahme, CO2-Abgabe) statt.
Wie erfolgt die Exkretion bei den Clitellata?
Die Exkretion erfolgt durch Metanephridien, von denen sich jeweils eines rechts und eines links vom Darm pro Coelom und Segment befinden. Die in Querschlingen liegenden Kanäle beginnen mit einem Wimpertrichter. Der Endabschnitt wird als Harnblase bezeichnet und endet mit einem Exkretionsporus nach außen. Primärharn wird an den mit Blutgefäßen versorgten Coelomwänden produziert und in den Wimpertrichter eingestrudelt. In der Harnblase werden noch brauchbare Stoffe resorbiert. Unverdautes wird über den After ausgeschieden.
Wie ist der Kreislauf der Clitellata aufgebaut?
Die Clitellata besitzen ein geschlossenes Kreislaufsystem. Fünf laterale Herzen, bzw. Schlingen, pumpen Blut ins ventrale Blutgefäß. Das Blut fließt im dorsalen Blutgefäß Richtung Prostomium und im ventralen Richtung Pygidium. Blut aus dem ventralen Blutgefäß fließt durch Dorsoparietalgefäße in das dorsale Blutgefäß.
Wie ist das Nervensystem der Clitellata aufgebaut?
Das zentrale Nervensystem ist das Cerbralganglion, von dem zwei Nervenstränge in den Pharynx zur Bindung mit den Sinnesorganen im Prostomium gehen. Es besteht eine Verbindung mit dem Bauchmark durch zwei Nervenleitungen. Im Bauchmark vereinigen sich die Nervenbahnen als Unterschlundganglion, bestehend aus vier zusammengerückten Ganglienpaaren. Das Bauchmark besteht aus zwei Strängen segmentierter Ganglien, die durch Konnektive verbunden sind (ventrales Strickleiternervensystem). In jedem Segment gehen zwei Paar Nerven ab, die in den Hautmuskelschlauch übertreten.
Wie erfolgt die Fortpflanzung bei den Clitellata?
Der Geschlechtsapparat besteht aus Hoden (mit Samenkapseln und Samenblase), Samentrichtern, Ovarien, Eihältern, Eileitern und Receptaculum seminis mit Mündung. Die Gametenreifung umfasst die Produktion unvollständiger Spermatozoen in den Hodenzellen, die in den Samenkapseln aufgefangen und in den Samenblasen vollständig differenziert werden. Die Ovarien produzieren unvollständige Eizellen, die im Eitrichter aufgefangen und differenziert werden. Die Befruchtung erfolgt durch die Produktion von Schleim am Clitellum. Zwei proterandrische Zwitter verkleben, Spermatozoen werden aus der männlichen Geschlechtsöffnung über eine externe Samenrinne zur Mündung des Receptaculum seminis weitergeleitet und dort gespeichert. Ein Schleimring am Clitellum wandert zu den weiblichen Geschlechtsöffnungen, nimmt Eier auf und wandert dann weiter zu den Mündungen des Receptaculum seminis, wo die Eier befruchtet werden. Der Schleimring schnürt sich am Prostomium ab und bildet einen neuen Wurm.
Wie bewegen sich die Clitellata fort?
Die Fortbewegung erfolgt durch die Kontraktion der Ringmuskeln am Kopfpol, wodurch der vordere Bereich gestreckt wird. Das Coelom mit Flüssigkeit wirkt als Antagonist zu den Ringmuskeln. Darauf folgt eine lokale Kontraktionswelle der Längsmuskeln davor und dahinter. Die lokale Verdickung zieht den Körper nach vorn, wobei das Zurückrutschen durch das Ausfahren der Borsten verhindert wird. Die peristaltische Welle verläuft entgegengesetzt der Fortbewegungsrichtung und erstreckt sich meist über 10 bis 15 Segmente. Die Fortbewegungsgeschwindigkeit beträgt ca. 2 cm/s.
Was sind einige weitere Merkmale der Clitellata?
Das Prostomium ist zugespitzt, das Pygidium abgerundet und abgeplattet. Die Bauchseite ist abgeflacht, die Rückenseite abgerundet und meist dunkler als die Bauchseite. Die männliche Geschlechtsöffnung befindet sich in Segment Nr. 15, die weibliche in Segment Nr. 14. Das Clitellum erstreckt sich über die Segmente 32 bis 37. Der Wurmbauplan ist immer gleich, mit immer gleichen Organen in gleichen Segmenten. Die Haut ist feucht und glatt, um Verdunstung zu verhindern. Ventrale und laterale Borstenpaare sind vorhanden, die entgegen der Laufrichtung gerichtet sind und durch Muskeln ein- und ausgefahren werden können. Im Winter rollen sie sich ein und verfallen in Kältestarre in 2m Tiefe. Der Hautmuskelschlauch (Ring-&Längsmuskulatur) umschließt das Coelom sowie den Darm. Unter dem Bauchmark ist noch ein Subneuralgefäß vorhanden.
- Quote paper
- Kristian Spajzer (Author), 2001, Stammbetrachtung der Clitellata -Der Regenwurm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99928