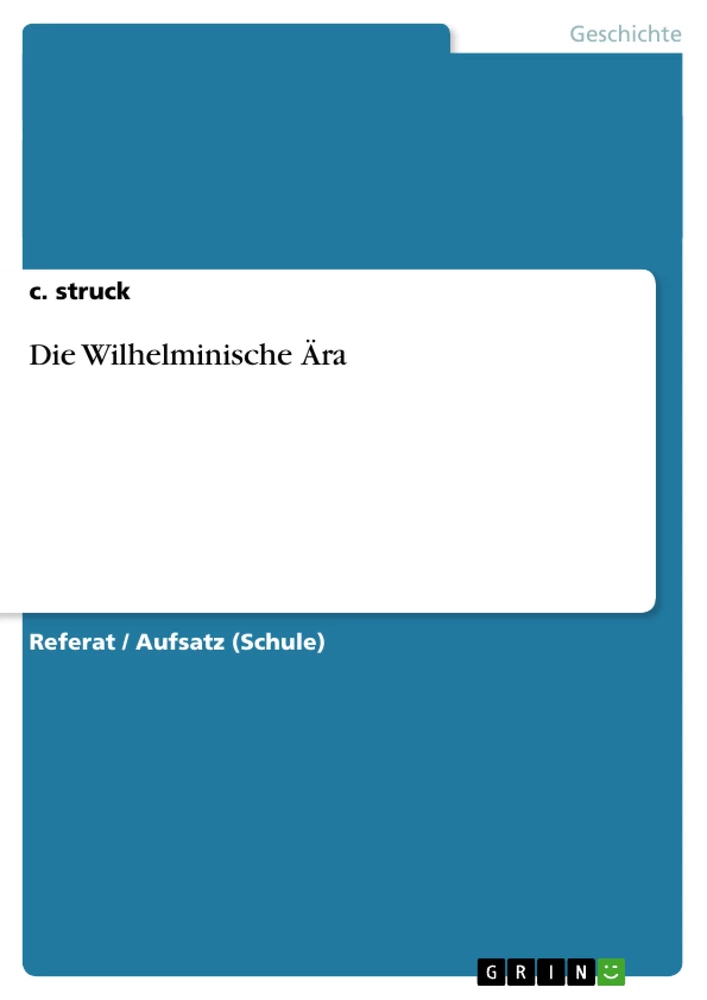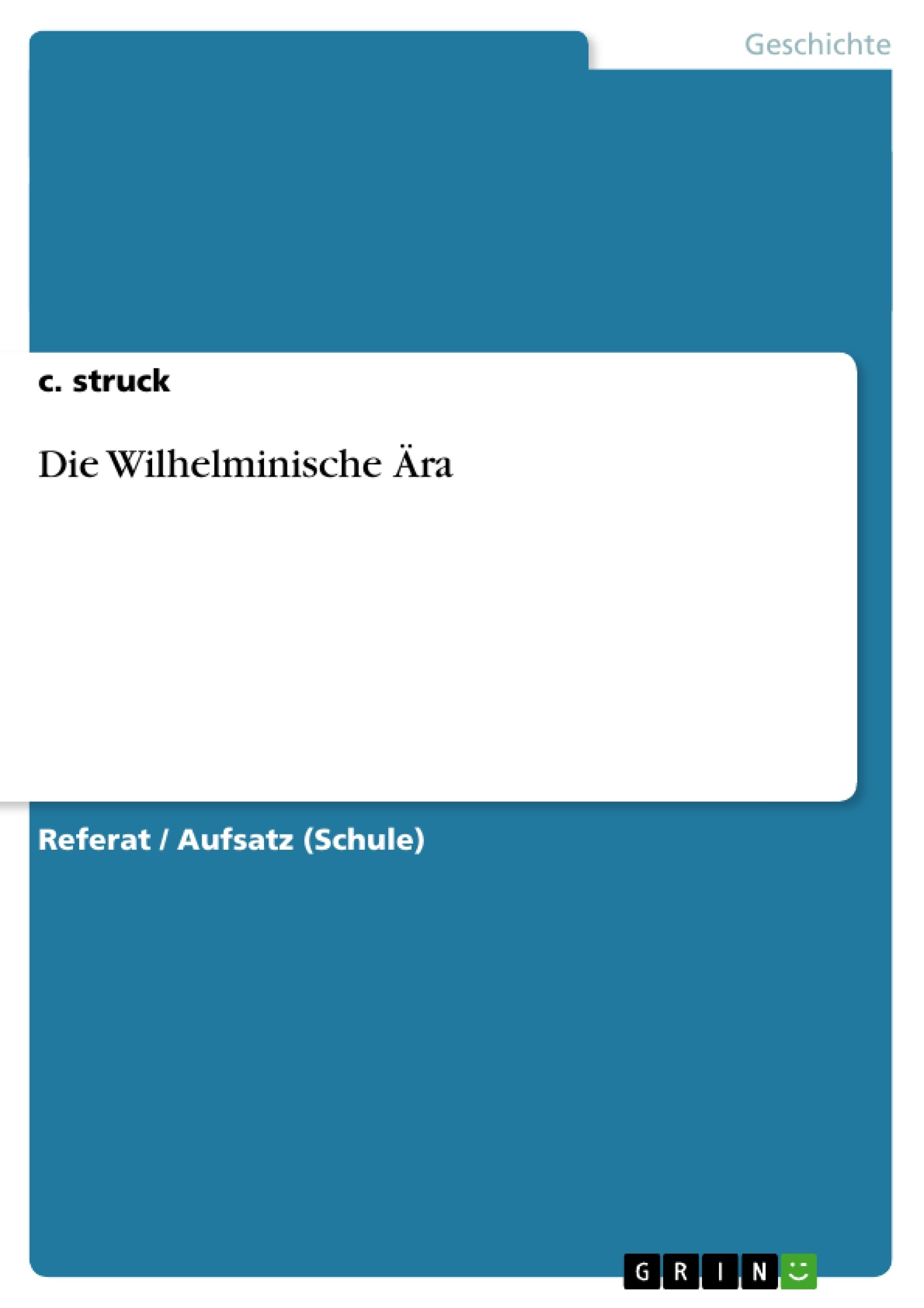Inhaltsverzeichnis
1. Biographie
1.1 Wilhelm
1.2 Friedrich
1.3 Wilhelm
2. Industrialisierung
2.1 Industrielle Revolution
2.2 Soziale Missstände
3. Frauen und Familie zur Zeit des Kaiserreichs
3.1 Familien vor der Industrialisierung
3.2 Familien nach der Industrialisierung
3.3 Unterschied zwischen der bürgerlichen und der Arbeiterfamilie
3.4 Die Rolle der Frau in der Gesellschaft
1. Biographie
1.1 Wilhelm I.
Wilhelm I. (geb. 22.3.1797 in Berlin, gest. 9.3.1888 ebd.), König von Preußen seit 1861, deutscher Kaiser (1871-1888).
Wilhelm I. war der zweite Sohn des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III.. Da sein älterer Bruder Friedrich Wilhelm IV. ohne Nachwuchs blieb, hatte er automatisch Anspruch auf das preußische Thronerbe. Ganz im Geiste der preußischen Militärtradition erzogen, sammelte Wilhelm seine ersten militärischen Erfahrungen auf den Schlachtfeldern der Befreiungskriege. Seit 1807 in preußischen Diensten, stieg er im Jahr 1825 zum Kommandeur des hiesigen Gardekorps auf. 1841 wurde Wilhelm als voraussichtlicher Thronfolger zum "Prinz von Preußen" ernannt. Vor dem Hintergrund der Märzrevolution floh er kurzfristig nach England, bevor er sich nach seiner Rückkehr an der Niederschlagung der Aufstandsbewegung maßgeblich beteiligte. Sein Eifer und Einsatz bei der Eindämmung der Revolution haben ihm den Beinahmen "Kartätschenprinz" eingebracht. Nachdem Wilhelm I. im Juni 1848 in die preußische Nationalversammlung gewählt worden war, wurde er ein Jahr darauf bei der Unterdrückung der Badischen und Pfälzischen Aufstände aktiv. Nach dem endgültigen Ende der Revolution agierte Wilhelm zwischen 1849 und 1854 von Koblenz aus als Generalgouverneur von Rheinland und Westfalen, ab 1854 zusätzlich als Gouverneur der Festung Mainz.
Als sich der geistige Zustand seines Bruders Friedrich Wilhelm zum Ende der fünfziger Jahre sichtbar verschlechterte, übernahm Wilhelm in seiner Funktion als "Prinz von Preußen" im Jahr 1857 die Stellvertretung, ein Jahr darauf die Regentschaft des Erkrankten. Anders als sein Vorgänger hatte sich Wilhelm I. unter dem Einfluss seiner Gattin Augusta von Sachsen- Weimar mehr und mehr den Vorstellungen des Liberalismus geöffnet, obwohl er bisher das alte, militärisch geprägte, konservativ- monarchische Preußen repräsentiert hatte. Der Wandel seiner politischen Vorstellungen ließ sich bereits vor seinem offiziellen Amtsantritt als preußischer König ablesen. Der Kurs der so genannten "Neuen Ära", den er nach seiner Thronbesteigung am 2. Januar 1861 mit der Berufung eines liberalen Ministeriums einläutete, war indes nur von kurzer Dauer. Bereits in den Auseinandersetzungen um eine Heeresreform, die schließlich im preußischen Verfassungsstreit mündeten, kehrte Wilhelm I. zu den Maximen konservativer Politik zurück. Nachdem er bereits eine Abdankung zugunsten seines Sohnes Friedrich III. in Erwägung gezogen hatte, berief er im Jahr 1862 auf Empfehlung seines Ratgebers Albrecht Roon Otto von Bismarck zum neuen preußischen Ministerpräsidenten. Bismarck entwickelte sich bald zum führenden Kopf der preußischen Politik, wobei sein Vorgehen von Wilhelm I. nicht nur gedeckt, sondern auch gefördert wurde. Innenpolitisch durch den neuen Ministerpräsidenten gestärkt, erreichte der preußische König als formeller Oberbefehlshaber den militärischen Erfolg im 2. Deutsch-Dänischen Krieg und setzte sich überdies im Deutschen Krieg als stärkste deutsche Macht gegen Österreich durch.
Nach dem preußischen Sieg im Deutsch-Französischen Krieg wurde Wilhelm I. am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser des neu gegründeten Deutschen Reichs ausgerufen. Gleich zwei Attentate, denen Wilhelm I. entkommen konnte, hatten im Jahr 1878 die Sozialistengesetze zur Folge. Damit wurde die Sozialdemokratie, auf Initiative Bismarcks hin, als potentielle Urheber der Anschläge verboten. Auch während der Auseinandersetzungen des Kulturkampfes konnte sich Bismarck der Unterstützung des deutschen Kaisers sicher sein.
Außenpoltisch war Wilhelm I. stets an einem freundschaftlichen Verhältnis zu Russland interessiert. Am 9. März 1888 verstarb Wilhelm I. und machte seinem Nachfolger und Sohn Friedrich III. Platz, bevor in diesem Dreikaiserjahr sein Enkel Wilhelm II. den Thron bestieg.
1.2 Friedrich III.
Friedrich III. (geb. 18.10.1831 in Potsdam, gest. 15.6.1888 ebd.), dt. Kaiser. Friedrich III. war der Sohn Wilhelms I. und als preußischer Kronprinz unter dem Namen Friedrich Wilhelm bekannt.
Er war ein ausgesprochen liberaler Vertreter seines Standes und sprach sich für eine weitgehende Liberalisierung und die Überwindung des nicht mehr zeitgemäßen aus. Politisch war er, gestärkt von seiner Frau, der Princess Royal Viktoria, ein Gegner Bismarcks. In den Einigungskriegen war er als Sieger bei Königgrätz eine der herausragenden Persönlichkeiten. Nach der Verwirklichung seines nationalen Ziels im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) schwebte ihm ein "freier deutscher Kaiserstaat", vor allem auch als Widerstand gegen den Sozialismus, vor. Außenpolitisch tendierte er zu England, was angesichts des bestimmenden Einflusses seiner Frau auch kaum verwundern kann. Das Warten auf seine Zeit (sein Vater wurde über 90 Jahre alt) zermürbte ihn zusehends. Er erkrankte an Kehlkopfkrebs und regierte, schon nicht mehr fähig zu sprechen, im Dreikaiserjahr 1888 für nur 99 Tage. Ihm folgte sein von ihm selbst nur wenig geschätzter Sohn Wilhelm II. auf den Thron.
1.3 Wilhelm II.
Wilhelm II. (geb. 27.1.1859 in Berlin, gest. 4.6.1941 in Haus Doorn), deutscher Kaiser und preußischer König (1888-1918), Enkel von Wilhelm I. sowie ältester Sohn von Friedrich III.. Der junge Wilhelm genoss eine generell liberale Erziehung und entpuppte sich in seiner Jugend als ein Bewunderer des alten mächtigen Otto von Bismarck. Nach seiner Thronbesteigung am 15. Juni 1866 wandte er sich jedoch rasch vom liberalen elterlichen Erbe ab. Überdies geriet er zunehmend in Konflikt mit der Politik Bismarcks. Zum einen stieß sein Versuch, die Arbeiterschaft durch verschiedene sozialpolitische Maßnahmen von der Sozialdemokratie fernzuhalten, beim Reichskanzler auf wenig Gegenliebe. Zum anderen erregte Bismarcks Bündnispolitik das Missfallen Wilhelms II., da sie mit seinen offenkundigen Großmachtansprüchen nicht vereinbar war.
Die zunehmenden Differenzen beider Persönlichkeiten, die sowohl auf politischer als auch auf persönlicher Ebene sichtbar wurden, führten im Jahr 1890 zur Entlassung Bismarcks. Innenpolitisch verkündete der deutsche Kaiser nach Bismarcks Sturz neue politische Richtlinien. Die als Phase des "Persönlichen Regiments" bekannte, weitgehend unter dem Einfluss des neuen Reichskanzlers Leo Caprivi stehende Phase, die bis zum Jahr 1908 andauerte, war von einer Rückkehr zu Vorstellungen des Absolutismus geprägt. Dabei setzte sich Wilhelm II. unter Missachtung der tatsächlichen Machtverhältnisse eigenwillig an die Spitze der Reichspolitik. Die Phase des "Persönlichen Regiments" hatte negative Auswirkungen auf das Verhältnis Wilhelms II. zu den Nachfolgern Caprivis, den Reichskanzlern Chlodwig von Hohenlohe, Bernhard Bülow und Moritz August von Bethmann-Hollweg zur Folge. Gleichzeitig konnten persönliche Berater Wilhelms wie Botho Eulenburg zunehmend an Einfluss gewinnen. Während der Regentschaft Wilhelms II. wurde überdies der Druck auf die Sozialdemokraten gelockert.
Außenpolitisch zeichnete sich die Regentschaft Wilhelms II. durch die an Maximen des Imperialismus angelehnten persönlichen Wünsche des Kaisers aus. So verzichtete der deutsche Kaiser zunächst auf eine Neuauflage des Rückversicherungsvertrages mit Russland und suchte stattdessen über den Helgoland-Sansibar-Vertrag eine Annäherung an England. Bald jedoch bemühte sich Wilhelm II. um eine Wiederherstellung des guten Verhältnisses zu Russland. Generell führte die Regierungszeit Wilhelms II. zu einer zunehmenden Verschlechterung der Beziehungen zu den übrigen europäischen Staaten und zu einer zunehmenden Isolation des Deutschen Reichs in Europa. Mehr als heikel war die Tatsache, dass Wilhelm II. diplomatisches Geschick vermissen ließ, wodurch sowohl auf dem innenpolitischen Parkett als auch auf der außenpolitischen Bühne Misstrauen gesät wurde.
Dazu trugen nicht zuletzt die in Szene gesetzte deutsch-englische Flottenrivalität unter Alfred Tirpitz, die antienglische Krügerdepesche von 1896 und die Daily- Telegraph-Affäre aus dem Jahr 1908 bei, die beinahe den Rücktritt des deutschen Kaisers ausgelöst hat. Die Selbsternennung Wilhelms II. zum "obersten Kriegsherren" zu Beginn des Ersten Weltkrieges indes blieb nur von kurzer Dauer. Mehr und mehr wurde der Monarch von den führenden Köpfen der "Obersten Heeresleitung" wie Paul Hindenburg und Erich Ludendorff sowie dem an Einfluss gewinnenden Reichstag machtpolitisch in den Hintergrund gedrängt. Angesichts der militärischen Niederlage des Deutschen Reichs und in Anbetracht der Ereignisse beim Ausbruch der Novemberrevolution kam das Ende der Regentschaft Wilhelms II. Am 9. November 1918 verkündete Reichskanzler Prinz Max von Baden eigenmächtig den Rücktritt des Kaisers, der sich daraufhin ins holländische Exil begab und am 28.11.1918 seinen Rücktritt als deutscher Kaiser offiziell bestätigte. Vom Titel des preußischen Königs indes war er nicht bereit zurückzutreten. Der in den Niederlanden verbleibende Monarch hoffte bis zu seinem Lebensende auf eine Wiederherstellung des preußischen Königtums. Wilhelm II. war er von 1881-1921 mit Augusta Victoria von Schleswig-Holstein und nach ihrem Tod seit 1922 mit Hermine von Schönaich-Carolath verheiratet.
2.Industriealisierung
2.1 Industrielle Revolution
Die gesellschaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts wurden durch wirtschaftliche Entwicklungen nachhaltig beeinflusst. Die Industrialisierung des europäischen Kontinents hat wegen ihrer Umwälzungen den Begriff einer Revolution mindestens ebenso verdient wie die politischen Ereignisse von 1789 oder 1848. Am Beginn standen Erfindungen, die bereits im 18. Jahrhundert in England gemacht wurden. Sie betrafen vor allem die Textilindustrie und die Eisenerzeugung. Der Einsatz neuer Maschinen anstelle der handwerklichen Fertigung ermöglichte die Produktion größerer Mengen in kürzerer Zeit. Mit der Dampfmaschine (1765) wurde die Industrie unabhängig von natürlichen Energien. Dampfschiff und Dampflokomotive (1825) revolutionierten den Transport. Ihren technischen Vorsprung konnten die Engländer noch das ganze 19. Jahrhundert als Wirtschaftsvorteil nutzen. Um 1850 trat Deutschland schließlich in die Antreibphase ("Take-off") der industriellen Revolution. Außer technischen Erfindungen waren auch der Ausbau des Verkehrswesens und der Gütertransport, der Abbau von Zollschranken für die Entstehung eines Marktes und vor allem die Freisetzung von Arbeitskräften und Anlagekapital notwendige Voraussetzungen für die Industrialisierung. Immer größere Fabriken wurden eröffnet, in denen arbeitsteilige Strukturen herrschten und freie Lohnarbeiter anstelle von Handwerksgesellen beschäftigt wurden. In der Folgezeit kam es zu zahlreichen Bankengründungen, denn mit der Betriebsgröße stieg auch der Kapitalbedarf. Das Bürgertum profitierte von der wirtschaftlichen Liberalisierung. Mit der Herstellung von Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit entstand ein neuer Unternehmertyp, der ohne Zunftzwänge Werkstätten eröffnen und nach eigenem Gutdünken Geld investieren konnte. Materielle Güter waren die Grundlage dieser neuen gesellschaftlichen Klasse, die als Besitzbürgertum an wirtschaftlicher Modernisierung und pragmatischem Handeln orientiert war. Staatlicherseits wurde die vorteilhafte Wirtschaftsentwicklung bald gefördert. Allerdings trat der Staat selten als Unternehmer auf, sondern versuchte private Initiative zu wecken. Weiteren Einfluss nahm er außerdem zum einen mit der Einrichtung von Gewerbeschulen und Technischen Hochschulen und zum anderen durch den Ausbau des Verkehrssystems. Ab 1835 wurde das Eisenbahnnetz in kürzester Zeit verdichtet und damit für die Wirtschaft nutzbar. Durch die Eisenbahn verkürzte sich die Beförderungszeit der Güter drastisch, der Transport auf der Schiene war konkurrenzlos billig und verband binnen kurzen auch die wichtigsten Städte und Regionen Mit teleuropas zu einem Absatzmarkt. Lokomotivbau und Schienenproduktion erhöhten die Nachfrage nach schwerindustriellen Erzeugnissen. Die Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie nahm einen rasanten Aufschwung, woran auch die Rüstung ihren Anteil hatte. Für den Eisenbahnbau wurde zudem erstmals ein neues Finanzierungsinstrument in größerem Umfang eingesetzt: die Aktiengesellschaft. Innerhalb des Deutschen Bundes verliefen diese Entwicklungen nicht in allen Staaten parallel. Besonders in Österreich kam die Industrialisierung nicht so rasch in Gang und beschränkte sich auf einzelne Regionen. Dadurch blieb die Volkswirtschaft wesentlich länger agrarisch orientiert. Preußen hingegen verfügte seit 1815 mit dem Rheinland und Oberschlesien über bedeutende Erzvorkommen, die die Voraussetzungen für den Aufstieg des Landes zur Industriemacht legten. Von Westfalen, das seit dem Wiener Kongress ebenfalls zu Preußen gehörte, gingen die entscheidenden Schritte zur Industrie aus (Mechanisierung der Textil- und Eisenindustrie sowie Liberalisierung des preußischen Berggesetzes 1851). An Rhein und Ruhr, in Brandenburg, Sachsen und Oberschlesien entstanden seit der Jahrhundertmitte Bergwerke, große Betriebe zur Eisenverhüttung sowie gewaltige Großstahl- und Maschinenfabriken. Aus der Verwertung von Nebenprodukten, die bei der Verkokung von Kohle anfallen, entwickelte sich ein neuer Wirtschaftszweig, die chemische Industrie, deren Produkte (Synthetische Farben, Kunstdünger) großen Absatz fanden. 1834 wurde außerdem der Deutsche Zollverein gegründet, ein Wirtschaftsabkommen, das die Binnenzölle im innerdeutschen Warenverkehr aufhob und so Deutschlands wirtschaftliche Einigung vorantrieb. Ihm traten unter preußischer Führung nahezu alle deutschen Staaten bei. Österreich dagegen beteiligte sich nicht und verlor deshalb weiter an Einfluss in Deutschland. Die spätere "kleindeutsche Lösung" wurde durch diese wirtschaftliche Entwicklung begünstigt. Das revolutionäre Instrument der Industrialisierung war ihre außerordentliche Geschwindigkeit. Sie spielte sich zwischen 1834 und 1873 ab und war zur Zeit der Reichsgründung bereits erfolgreich abgeschlossen. In der deutschen Volkswirtschaft bestimmte nicht mehr die Landwirtschaft, sondern die Industrie den Konjunkturverlauf. Deutschland war zur zweitgrößten Industrienation in Europa geworden.
2.2 Soziale Missstände
Der deutsche Wirtschaftsboom hielt bis 1873 an. Seit 1848 hatte sich das deutsche Volkseinkommen verdoppelt. Aber gerade jene Gesellschaftsschicht, die durch ihre Arbeit den Aufschwung ermöglicht hatte, verelendete zusehends. Pauperismus und Agrarreform hatten eine große Bevölkerungsgruppe entstehen lassen, die auf dem Land keine Erwerbsmöglichkeit mehr fand und in den Städten ihr Auskommen suchte. Dort trafen die besitzlosen Landarbeiter und verarmten Kleinbauern auf arbeitslos gewordene Handwerksgesellen und bildeten zusammen das moderne Industrieproletariat. Ihre Lebensbedingungen waren entsetzlich, denn Arbeitskraft war eine billige Ware: Es gab zuviel davon auf dem Markt. Um sich gegen die ausländische, vor allem britische Konkurrenz behaupten und die deutschen Industrieprodukte billig halten zu können, wurden von den Unternehmen ohnehin nur geringe Löhne gezahlt. Die Landflucht vergrößerte das Angebot von Arbeitern, was die Löhne zusätzlich drückte und dazu führte, dass eine Familie nur durch Kinder- und Frauenarbeit existieren konnte. Üblich waren Arbeitszeiten von 12, teilweise über 14 Stunden an 6 bis 7 Tagen pro Woche ohne geregelte Erholung oder Urlaub. Die Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz waren höchst mangelhaft, Unfälle an der Tagesordnung. Es gab keine Vorsorge im Fall von Krankheit und Invalidität. Altersversorgung oder Kündigungsschutz waren unbekannt. Jeder Konjunktureinbruch hatte Massenarbeitslosigkeit zur Folge. Das Qua lifikationsniveau war gering, es gab kaum Aufstiegschancen. Der Bedarf an Arbeitskräften schellte in Zeiten der Hochkonjunktur sowie beim Ausbau arbeitsintensiver Wirtschaftszweige wie dem Montanbereich sprunghaft an. Aus immer größeren Entfernungen strömten Zuwanderer in die Städte und neuen
Ballungsgebieten, wo sie ihren Arbeitsplatz wiederum häufig wechseln mussten. Die rasch gebauten Arbeiterunterkünfte waren nur primitiv ausgestattet, ihre Überbelegung führte zu unhygienischen und krankheitsfördernden Wohnverhältnissen. Die Lebenserwartungen unter solchen Bedingungen waren gering, die Kindersterblichkeit hoch.
3.Frauen und Familie zur Zeit des deutschen Kaiserreichs
3.1 Familien vor der Industrialisierung
Vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gab es nicht die heutige Vater-Mutter-Kind- Familie, sondern Hausangestellte und Lehrlinge gehörten auch zu den Familienmitgliedern. Auf einem Bauernhof zum Beispiel waren dies neben Bauer und Bäuerin und den Kindern auch die Knechte.
Das Heiratsalter lag bei 28 bis 30 Jahren und eine Frau brachte durchschnittlich sechs bis acht Kinder zur Welt, von denen aber meist nur zwei das Erwachsenenalter erreichten. Ehen wurden nur innerhalb eines Standes geschlossen und bei der Wahl des Ehepartners gab es wirtschaftliche Überlegungen, meist war jedoch der Wille der Eltern ausschlaggebend.
3.2 Familien nach der Industrialisierung
Durch den Fortschritt der Medizin und die Aufklärung (...) stieg die Lebenserwartung des einzelnen und die Mehrheit der Kinder erreichte das Erwachsenenalter. Die Geburtenrate ging zurück und auch die Auffassung über Erziehung der Kinder änderte sich, so sollten die Kinder nun behütet und umsorgt aufwachsen. Knechte und Hausangestellte gehören jetzt nicht mehr zur Familie. Es gibt nun die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie. Die Rolle der Frau wird immer mehr die, der Köchin, Haushälterin und Erzieherin der Kinder.
3.3 Der Unterschied zwischen der bürgerlichen Familie und der Arbeiterfamilie
In der bürgerlichen Familie arbeitete der Vater in einer bessergestellten Position, beispielsweise als Beamter. Er genießt zu Hause das Ansehen von seiner Frau und den Kindern. Die Frau ist für die Erziehung der Kinder zuständig, wofür damals etwa 30% des Haushaltseinkommens ausgegeben wurden, und führt zusammen mit den Hausangestellten den Haushalt. Für sie ist es ausgeschlossen einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. In der Arbeiterfamilie arbeitet der Mann durchschnittlich 14 Stunden täglich. Die Frau führt den Haushalt und geht nebenbei noch einer niederen beruflichen Tätigkeit nach. Die Kinder besuchen im Gegensatz zur bürgerlichen Familie meist die Schule nur kurz und verlassen diese dann, um sich eine Anstellung zu suchen und etwas zum Familieneinkommen beizutragen.
3.4 Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft
Nach der Industrialisierung beschränkte sich der Wirkungsbereich der Frau in Deutschland nur auf Familie und Kinder. Sie hatte kein Recht auf Mitsprache in öffentlichen Angelegenheiten. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es ihr nicht erlaubt höhere Schulen zu besuchen und ihr Mann war ihr rechtlicher Vertreter.
Nach der Revolution von 1848/49 begannen sich die Frauen dagegen zu wehren und sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Um 1900 tauchten dann die ersten Frauenbewegungen auf. Das Wahlrecht erreichten sie 1918 in der Revolution.
Literaturverzeichnis:
1. Weltgeschichte , erschienen im Lingen Verlag Köln 1988
2. CD-ROM ,,Das große DATA BECKER LEXIKON 2001"
3. Deutsche Geschichte, erschienen im Josef-Beck-Verlag Ludwigshafen 1977
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die deutsche Geschichte während des Kaiserreichs, einschließlich Biographien wichtiger Persönlichkeiten, der Industrialisierung und der Rolle von Frauen und Familien in dieser Zeit.
Welche Personen werden in den Biographien behandelt?
Die Biographien behandeln Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II., allesamt wichtige Herrscher in Preußen und dem Deutschen Reich.
Was sind die wichtigsten Punkte zur Biographie von Wilhelm I.?
Wilhelm I. war König von Preußen und später deutscher Kaiser. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung der Märzrevolution und arbeitete eng mit Otto von Bismarck zusammen. Er wurde 1871 im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen.
Was sind die wichtigsten Punkte zur Biographie von Friedrich III.?
Friedrich III. war der Sohn Wilhelms I. und bekannt für seine liberalen Ansichten. Er regierte jedoch nur für kurze Zeit (99 Tage) im Dreikaiserjahr 1888 aufgrund von Kehlkopfkrebs.
Was sind die wichtigsten Punkte zur Biographie von Wilhelm II.?
Wilhelm II. war der Enkel von Wilhelm I. und bekannt für sein "Persönliches Regiment" nach der Entlassung Bismarcks. Seine Regierungszeit war geprägt von imperialistischen Ambitionen und einer zunehmenden Verschlechterung der Beziehungen zu anderen europäischen Staaten. Er dankte am Ende des Ersten Weltkriegs ab.
Welche Aspekte der Industrialisierung werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die industrielle Revolution in Deutschland, einschließlich der frühen Erfindungen in England, des Ausbaus des Verkehrswesens, der Gründung des Deutschen Zollvereins und der sozialen Missstände, die mit der Industrialisierung einhergingen.
Was waren die sozialen Missstände während der Industrialisierung?
Die sozialen Missstände umfassten Verelendung, niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten, Kinderarbeit, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen, fehlende soziale Absicherung und unhygienische Wohnverhältnisse.
Wie veränderte sich die Familie im Laufe der Industrialisierung?
Vor der Industrialisierung waren Großfamilien mit Hausangestellten und Lehrlingen üblich. Nach der Industrialisierung entstand die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie, wobei die Rolle der Frau zunehmend auf Haushalt und Kindererziehung beschränkt wurde.
Was war der Unterschied zwischen bürgerlichen und Arbeiterfamilien?
In bürgerlichen Familien hatte der Vater eine bessergestellte Position, und die Frau war für die Kindererziehung und den Haushalt zuständig. In Arbeiterfamilien arbeitete der Mann lange Stunden, und die Frau ging zusätzlich einer niederen beruflichen Tätigkeit nach. Die Kinder verließen oft frühzeitig die Schule, um zum Familieneinkommen beizutragen.
Welche Rolle spielten Frauen in der Gesellschaft während des Kaiserreichs?
Die Rolle der Frauen war hauptsächlich auf Familie und Kinder beschränkt. Sie hatten kein Mitspracherecht in öffentlichen Angelegenheiten und durften bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts keine höheren Schulen besuchen. Nach der Revolution von 1848/49 begannen sie sich jedoch für Gleichberechtigung einzusetzen.
Welche Quellen wurden für den Text verwendet?
Die Quellen umfassen Weltgeschichte, Das große DATA BECKER LEXIKON 2001, Deutsche Geschichte und Unsere Geschichte.
- Quote paper
- c. struck (Author), 2001, Die Wilhelminische Ära, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99874