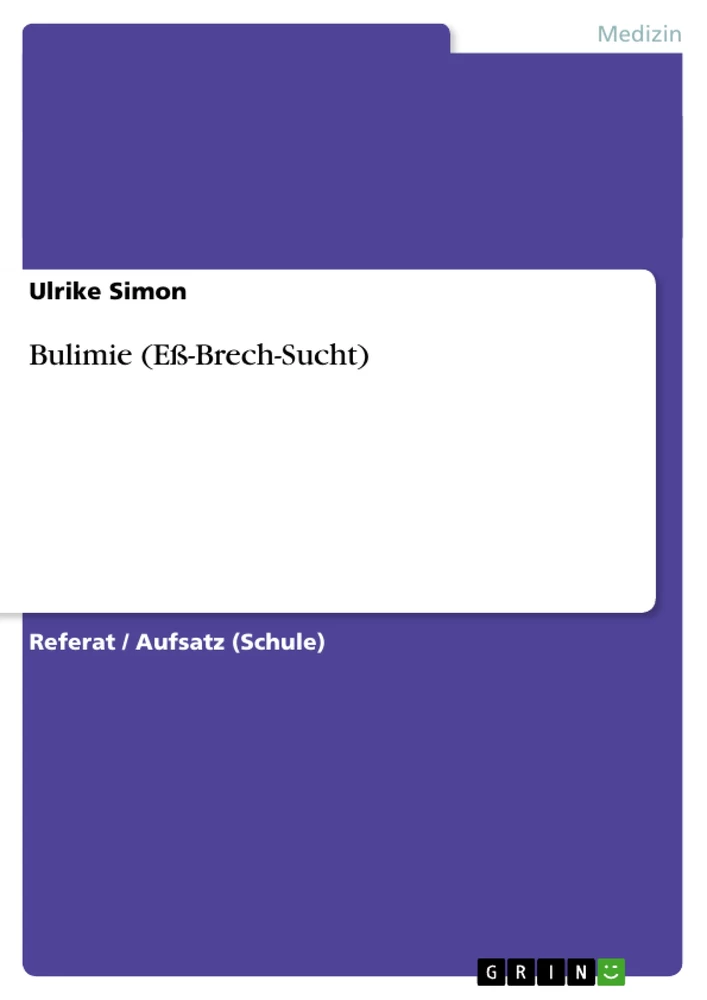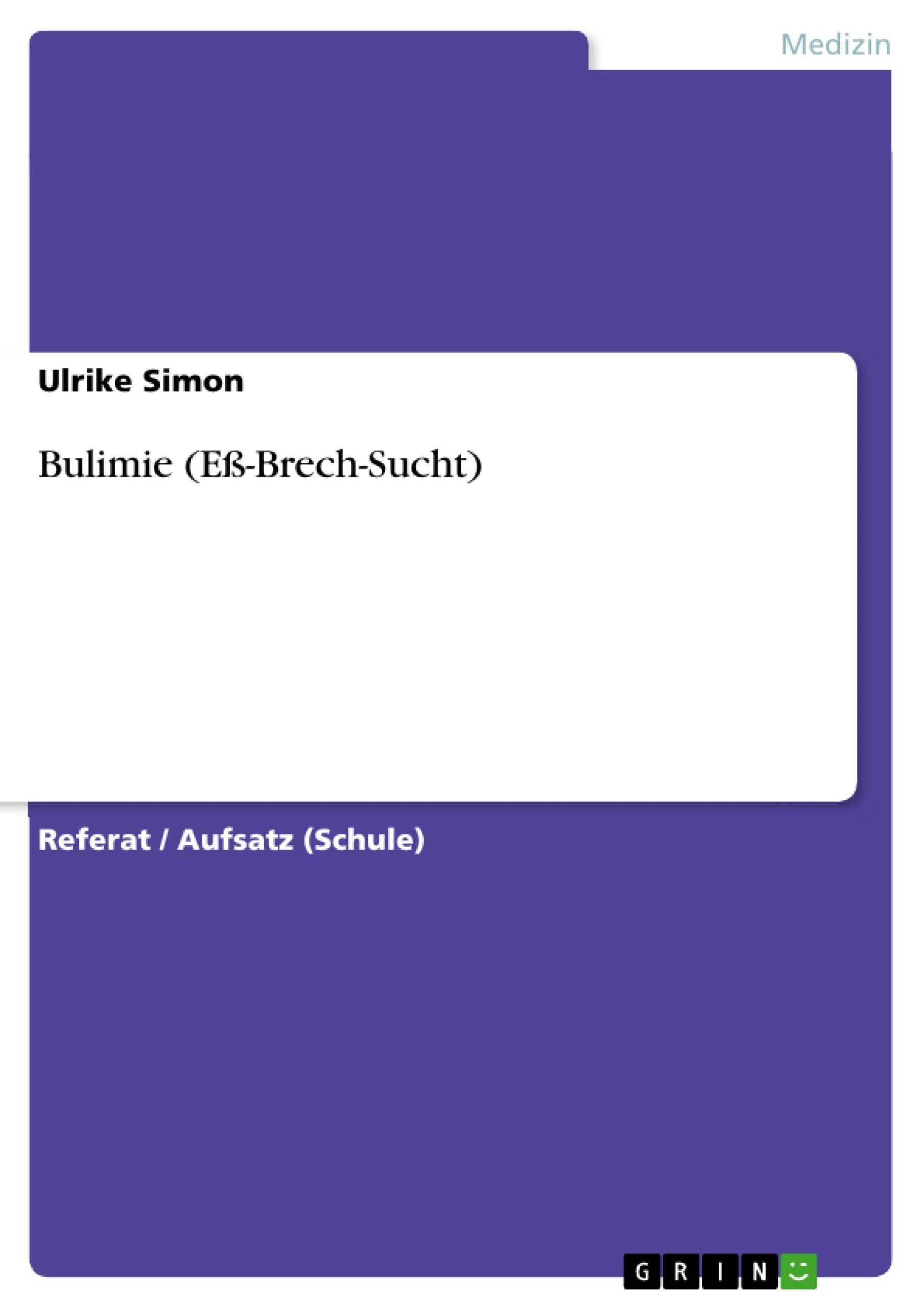Was treibt junge Frauen in den Teufelskreis aus Heißhunger und Erbrechen? Tauchen Sie ein in die verborgene Welt der Bulimie, einer Essstörung, die weit mehr ist als nur ein Kampf mit dem Gewicht. Dieses Buch enthüllt die komplexen psychologischen Ursachen und Mechanismen hinter der Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa), beleuchtet das verzerrte Körperbild und die tief verwurzelten Selbstwertprobleme, die Betroffene quälen. Erfahren Sie, wie der gesellschaftliche Druck, dem Schönheitsideal zu entsprechen, und innere Konflikte zu einem Teufelskreis aus Kontrollverlust und Scham führen. Die Autorin geht auf die Bedeutung der Geheimhaltung, die Rolle von Schuldgefühlen und die Ambivalenz zwischen dem Bedürfnis nach Nahrung und dem Wunsch, sich davon zu befreien, ein. Entdecken Sie, wie Bulimie zum Ausdruck unterdrückter Emotionen wie Wut und Angst wird und welche fatalen Folgen die ständigen Gewichtsschwankungen, der Abführmittelmissbrauch und die Selbstinduzierten Erbrechen für Körper und Psyche haben können. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Fachleute, der nicht nur die Symptome und Ursachen der Bulimie aufzeigt, sondern auch Wege zu einem gesunden Umgang mit Gefühlen und einem positiven Körperbild eröffnet. Es bietet einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt von Bulimikerinnen, zeigt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Therapie und ermutigt dazu, sich von der Essstörung zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Lernen Sie die Warnsignale zu erkennen, die körperlichen Probleme zu verstehen und die ersten Schritte aus der Sucht zu wagen. Ein Buch, das Hoffnung schenkt und Mut macht, sich der Krankheit zu stellen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um den Weg zu einem gesunden Selbstwertgefühl und einem unbeschwerten Leben zu finden. Verstehen Sie die Essstörung Bulimie und finden Sie Ihren Weg zur Heilung.
Bulimie (Eß-Brech-Sucht)
Was ist das?
Bulimie, eine Angst und ständige übermäßige Sorge um Gewicht und Figur führen zu Episoden, bei denen die betroffene Person in kurzer Zeit sehr viel ißt und sich der Nahrung anschließend durch absichtliches Erbrechen, Abführmittel oder Fasten wieder entledigt oder mit starker körperlicher Anstrengung versucht, das Gewicht zu verringern Wiederholtes Erbrechen raubt dem Körper Flüssigkeit und Kalium; dieser Mangel kann die Herzfunktion gefährden.
Bulimieverhalten beobachtet man manchmal auch bei Magersucht, aber die Bulimie allein führt nicht zu starkem Gewichtsverlust. Sie kann jedoch Darmbeschwerden und schweren Kaliummangel auslösen; außerdem schädigt die Säure in dem Erbrochenen häufig die Zähne. In der Regel entwickelt sich die Bulimie bei Jugendlichen (vorwiegend bei jungen Frauen) als Folge verschiedener psychischer Belastungen; der eindeutigste Faktor ist dabei die gesellschaftliche Betonung eines schlanken Schönheitsideals.
Erscheinungsformen
Bulimie zeichnet sich durch Fressanfälle aus, in denen die Person große Mengen von Nahrungsmittel ohne Unterbrechung zu sich nimmt. In der Regel werden solche Anfälle durch anschließendes selbstinduziertes Erbrechen beendet. Diese Fressanfälle sind von einem Gefühl begleitet, die Nahrungsaufnahme nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Um einer Gewichtszunahme entgegenzusteuern, greifen die Betroffenen regelmäßig zu Maßnahmen wie selbstinduziertes Erbrechen, dem Gebrauch von Abführmittel, strenge Diäten oder Fastenkuren oder übermäßiger körperlicher Betätigung. Die Gedanken der betroffenen Frauen dreht sich ständig um ihre Figur, ihr Gewicht und um das Essen. Die Angst zuzunehmen, ist sehr groß. Ihr Körpergewicht ist hingegen als normal zu bezeichnen. Bulimikerinnen empfinden sich selber als hässlich und abstoßend in ihrer Körperlichkeit, zweifeln stark an sich selbst und ihren Wert.
Bedeutung der Bulimie und Umgang damit
Manche betrachten Bulimie als eine Art "missglückte" Magersucht und zwar in dem Sinne, dass die Frauen nicht in der Lage sind, ihr Gewicht allein nur durch Nahrungsverzicht zu halten oder zu reduzieren. Auch vielen bulimischen Frauen wäre es lieber, wenn sie nicht erbrechen müssten. Bei näherem Verständnis des Symptoms Bulimie wird aber deutlich, dass die Frauen einen bestimmten Grund haben, genau diese Essstörung für sich "gewählt" zu haben. Im Gegensatz zu Magersüchtigen löst ihr Essverhalten nicht das Gefühl aus, sich stark und selbstbeherrscht zu fühlen. Im Gegenteil, ihr dominierendes Gefühl ist, die Kontrolle verloren zu haben, versagt zu haben. Die daraus resultierenden Schuldgefühle und die Scham trägt sie aber nicht nach außen, sondern versucht "Normalität" vorzutäuschen. Aber sie selbst weiß, dass diese Normalität unecht ist und die Angst, dass jemand diesen "Betrug" aufdeckt, ist ständig präsent. Diese Geheimhaltung ihres Essverhaltens ist bereits ein Hinweis auf die symbolische Bedeutung.
Für Bulimikerinnen ist das Aufnehmen von Nahrung genauso wichtig, wie etwas wieder von sich zu geben. Beides, aufnehmen und wieder loswerden, sind wichtige Bestandteile und drücken die starke Zerissenheit der Gefühle und Empfindungen von bulimischen Frauen sehr deutlich aus. Bulimikerinnen spüren ihre Bedürftigkeit. Mittels Nahrung versuchen sie sich zu geben, was sie brauchen. Aber aufgrund ihrer früheren Erfahrungen erfüllt sie dies mit Schuld und Entsetzen, sie erbricht alles und befördert es wieder aus sich heraus und flüchtet sich in einen Zustand von Leere und Isolation, welcher leichter und sicherer zu ertragen ist als ihre maßlose Gier. Gierig und bedürftig zu sein ist wie auch die maßlos aufgenommene Nahrung, schlecht und giftig.
Durch das Erbrechen können nicht nur die als bedrohlich empfundenen Bedürfnisse wieder aus sich heraus gebracht werden, sondern noch andere Gefühle, die Frau als falsch und böse zu bewerten gelernt hat. Bulimie erlaubt, verbotene Gefühle wie Wut, Widerwillen und Angst zum Ausdruck zu bringen, Gefühle, die Reaktion auf Forderungen anderer an die bulimische Frau sind.
Dies bedeutet, dass die Frauen für sich einen neuen Umgang mit ihren bis jetzt negativ bewerteten Gefühlen lernen müssen, bevor sie ihr Essverhalten aufgeben können.
Esssucht mit Erbrechen (Bulimia Nervosa)
Esssucht ist eine ,,verborgene" Krankheit. Der gewaltige Appetit, das Erbrechen und die Depression, die sie begleiten, werden vor der Umwelt geheim gehalten. Ein ungünstiges Zusammenspiel des Patienten mit seiner Umwelt trägt dazu bei, dass die Esssucht zu einem festen Muster wird und die gefühlsmäßigen Probleme schwer zu lösen sind. Die Ess-Brech-Sucht wurde erst in den Jahren 1976 bis 1980 begrifflich und inhaltlich von der Anorexia nervosa abgegrenzt und schließlich 1980 von der American Psychiatric Association als eigenständige Erkrankung definiert. Seit der Erstbeschreibung ist das Krankheitsbild unter acht verschiedenen Namen in die Literatur eingegangen. Die inzwischen bevorzugte Bezeichnung Bulimia nervosa leitet sich ab aus den Griechischen Worten Bous (Ochse) und Limos (Hunger), bedeutet also ,,Stierhunger", im übertragenen Sinne ,,verzehrender Hunger" und weist mit dem Zusatz ,,nervosa" auf den psychischen Hintergrund der Erkrankung hin. Alle Krankheitsbezeichnungen stellen das gierige Essverhalten als Hauptsymptom in den Vordergrund.
Einige Kranke wissen ungefähr, wann sie solche Attacken zu erwarten haben, wieder andere bereiten systematisch regelrechte Fressgelage vor.
Körperlich empfundener Hunger ist nicht der eigentliche Auslöser, selbst wenn die Betroffenen es so bezeichnen. Erstauslösend wirken Abmagerungskuren, in deren Verlauf Fress-Attacken auftreten, welche dann in einen ,,bulimischen Teufelskreis" münden. Das Verschlingen der Nahrungsmittel geschieht heimlich unter starker seelischer Spannung und mit schlechtem Gewissen. Im Gegensatz zur Anorexia nervosa leiden diese Patienten unter ihrem Ess-Fehl-Verhalten. Sie wagen aber lange nicht, davon zu sprechen. Selbstvorwürfe, Minderwertigkeitsgefühle, depressive Verstimmungen bis hin zum Selbstmordversuch sind die Folge.
Anfangs wird das Erbrechen selbst herbeigeführt, später geht es von alleine. Die meisten Betroffenen erbrechen regelmäßig nach jeder Fress-Attacke ein bis mehrmals am Tage. Zum Teil werden große Flüssigkeitsmengen nachgetrunken, um mehrmals erbrechen zu können, was praktisch einer Magenspülung gleichkommt. Vereinzelt sehen die Betroffenen keinen Zusammenhang von Fress-Anfällen und Erbrechen, wenigstens in der Anfangszeit. Gewichtsreduktion wird auch durch strenge Diät, Einsatz von Abführ- oder Entwässerungsmitteln herbeigeführt. Appetithemmer werden von den Betroffenen eingesetzt, um Hungergefühle zu unterdrücken und dem drohenden Gewichtsanstieg entgegenzuwirken. Diese Mittel gehören entsprechend den chemischen Grundsubstanzen zu den Aufputschmitteln. Sie wirken also anregend und aktivitätssteigernd. Das führt bei manchen Betroffenen zu unangenehmen Nervositätszuständen und schließlich zum Absetzen des Mittels.
Abführmittel und entwässernde Medikamente werden ebenfalls mit dem Ziel der Gewichtsreduktion eingesetzt. Abführmittelmissbrauch kommt bei mindestens 50 % der Fälle vor. Im Unterschied zu Anorexia nervosa-Patienten haben Bulimia nervosa-Patienten in der Regel ein Wunschgewicht, das fast immer unter ihrem aktuell erreichten Körpergewicht liegt. Wenn sie durch Nahrungsbegrenzung, Diät, Abführmittelmissbrauch, Erbrechen diesem Gewicht nahe gekommen sind, lassen die Gegensteuerungsversuche zu den Essimpulsen nach - im Erleben der Betroffenen sind das dann entspannte, glückliche Zeiten - bis durch Gewichtsanstieg wieder neue Abmagerungsversuche unternommen werden müssen. Die sichtbare Folge: große Gewichtsschwankungen.
- Unter anderem deshalb sind Adipöse extrem auf Außenreiz zum Essverhalten angewiesen. Die Außenreizabhängigkeit gilt aber auch für die schon erwähnten latent Adipösen, also für Menschen, die ihr Gewichtsproblem durch kognitive Kontrollmaßnahmen und andere Orientierungshilfen im Griff haben. ¬ Orale Kompensationsmechanismen für belastende Situationen: Bekannt sind Appetitsteigerungen bei Ärger, Trauer, Misserfolg und Langeweile. Derartige Reaktionen kommen in der Bevölkerung relativ häufig vor. Wenn aus solchen Reaktionen eine Gewohnheit und daraus ein situationsunabhängiges, gierig-süchtiges Verschlingen großer Nahrungsmengen wird, dann haben wir es mit einer behandlungsbedürftigen Essstörung zu tun.
- Ein weiterer Faktor, der Essverhalten prägt, ist das schon erwähnte Schlankheitsideal und die damit zusammenhängende soziale Diskriminierung Adipöser. Vor allem adipöse Frauen, deren Stoffwechsel und psychisches Gleichgewicht sich auf ein bestimmtes Körpergewicht eingependelt haben, stehen in starker seelischen Spannung zwischen dem sozial erwünschten Schlankheitsideal und ihren Essimpulsen. Wenn sie versuchen abzunehmen, kann sich daraus der verhängnisvolle Kreislauf einer Ess-Brech-Sucht entwickeln, ohne dass sich auf Dauer das Körpergewicht verändern muss.
- Schließlich findet man auch bei Adipösen Körper-Schema-Störungen und aggressiv besetzte Ablehnung des eigenen Körpers - ähnlich wie bei der Anorexia und Bulimia nervosa.
Die Ess-Brechsucht ist ebenfalls eine psychische Störung. Der Essbrechkreislauf wird von selbsabwertenden und selbstverletzenden Gedanken begleitet.
Warnsignale und körperliche Probleme der Magersucht und der Ess-Brechsucht sind:
- auffälliger Gewichtsverlust und Gewichtsstörungen
- Verzerrtes Körperbild
- starkes körperliches Training trotz Ermüdung · sozialer Rückzug
- Ausbleiben der Regelblutung
- Zahnzerstörung wegen der Magensäure · Essanfälle
- Vergrößerung der Speicheldrüse · starke Depressionen
- Nierenprobleme · Knochenschwund
Häufig gestellte Fragen
Was ist Bulimie (Eß-Brech-Sucht)?
Bulimie ist gekennzeichnet durch Angst und ständige Sorge um Gewicht und Figur, was zu Episoden führt, in denen die betroffene Person in kurzer Zeit sehr viel isst und sich der Nahrung anschließend durch absichtliches Erbrechen, Abführmittel oder Fasten wieder entledigt oder mit starker körperlicher Anstrengung versucht, das Gewicht zu verringern. Wiederholtes Erbrechen kann zu Flüssigkeits- und Kaliummangel führen, was die Herzfunktion gefährden kann.
Wie unterscheidet sich Bulimie von Magersucht?
Bulimieverhalten kann auch bei Magersucht beobachtet werden, aber Bulimie allein führt nicht zu starkem Gewichtsverlust. Sie kann jedoch Darmbeschwerden und schweren Kaliummangel auslösen, und die Säure in dem Erbrochenen schädigt häufig die Zähne. Im Gegensatz zu Magersüchtigen, die ihr Gewicht durch Nahrungsverzicht zu halten versuchen, ist das Körpergewicht bei Bulimikern oft normal.
Was sind die typischen Verhaltensweisen bei Bulimie?
Bulimie zeichnet sich durch Fressanfälle aus, bei denen große Mengen an Nahrung ohne Unterbrechung konsumiert werden, gefolgt von selbstinduziertem Erbrechen. Betroffene greifen regelmäßig zu Maßnahmen wie Abführmittel, strenge Diäten, Fastenkuren oder übermäßiger körperlicher Betätigung, um einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken. Die Gedanken der Betroffenen kreisen ständig um Figur, Gewicht und Essen.
Welche psychologischen Aspekte spielen bei Bulimie eine Rolle?
Bulimikerinnen empfinden sich oft als hässlich und abstoßend in ihrer Körperlichkeit, zweifeln stark an sich selbst und ihrem Wert. Im Gegensatz zu Magersüchtigen, die sich durch Nahrungsverzicht stark fühlen, empfinden Bulimikerinnen oft Kontrollverlust, Schuldgefühle und Scham. Sie versuchen, "Normalität" vorzutäuschen, während sie Angst haben, dass ihr Verhalten entdeckt wird.
Welche Bedeutung hat das Erbrechen bei Bulimie?
Das Erbrechen ermöglicht es Bulimikerinnen, nicht nur die als bedrohlich empfundenen Bedürfnisse wieder loszuwerden, sondern auch andere Gefühle wie Wut, Widerwillen und Angst, die sie als falsch und böse bewertet haben. Bulimie erlaubt, verbotene Gefühle auszudrücken, die eine Reaktion auf die Forderungen anderer an die betroffene Frau sind.
Wie wird Bulimie in Bezug auf Essstörungen definiert?
Bulimie wird als eine Art "missglückte" Magersucht betrachtet, da die Betroffenen nicht in der Lage sind, ihr Gewicht allein durch Nahrungsverzicht zu halten. Sie wurde in den 1980er Jahren als eigenständige Erkrankung definiert, wobei das gierige Essverhalten als Hauptsymptom im Vordergrund steht.
Was sind die Auslöser für Fressattacken bei Bulimie?
Körperlich empfundener Hunger ist nicht der eigentliche Auslöser für Fressattacken. Oft wirken Abmagerungskuren erstauslösend, die dann in einen "bulimischen Teufelskreis" münden. Das Essen geschieht heimlich unter seelischer Spannung und mit schlechtem Gewissen.
Welche weiteren Methoden werden zur Gewichtsreduktion bei Bulimie eingesetzt?
Neben Erbrechen werden strenge Diäten, der Einsatz von Abführ- oder Entwässerungsmitteln und Appetithemmer zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Abführmittelmissbrauch kommt häufig vor. Gewichtsschwankungen sind eine sichtbare Folge dieser Verhaltensweisen.
Welche Rolle spielen Außenreize und das Schlankheitsideal bei Bulimie?
Adipöse und latent Adipöse sind stark auf Außenreize zum Essverhalten angewiesen. Das Schlankheitsideal und die damit verbundene soziale Diskriminierung von Adipösen verstärken die seelische Spannung zwischen Essimpulsen und dem Wunsch nach einem schlanken Körper. Körper-Schema-Störungen und eine aggressive Ablehnung des eigenen Körpers können ebenfalls eine Rolle spielen.
Welche Warnsignale und körperlichen Probleme sind mit Bulimie verbunden?
Zu den Warnsignalen und körperlichen Problemen gehören: auffälliger Gewichtsverlust und Gewichtsstörungen, verzerrtes Körperbild, starkes körperliches Training trotz Ermüdung, sozialer Rückzug, Ausbleiben der Regelblutung, Zahnzerstörung, Essanfälle, Vergrößerung der Speicheldrüse, starke Depressionen, Nierenprobleme, Knochenschwund, trockene Haut und Haarausfall.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Simon (Autor:in), 2000, Bulimie (Eß-Brech-Sucht), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99856