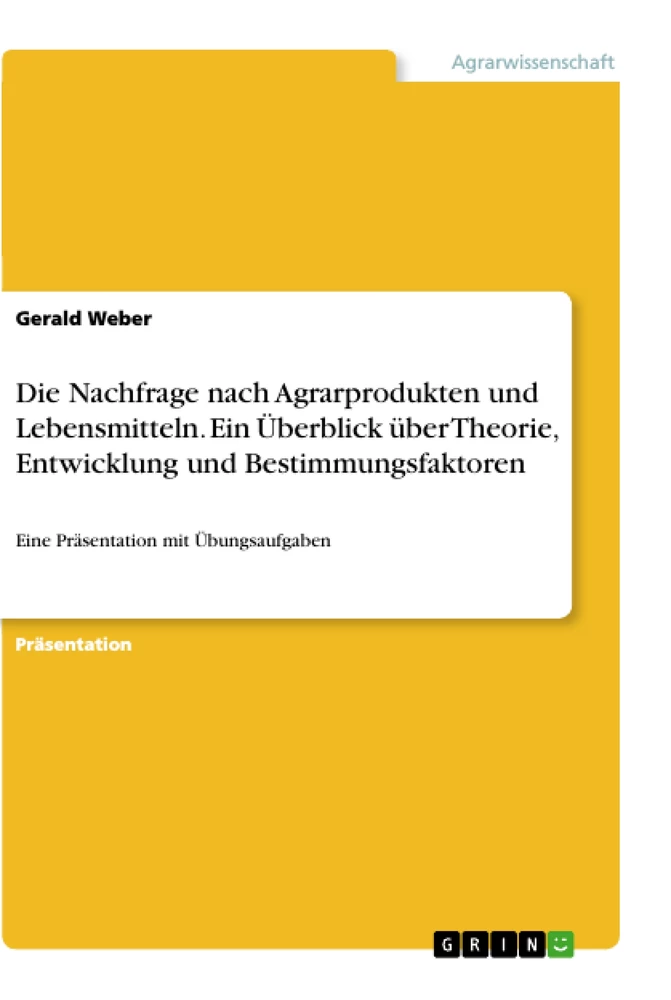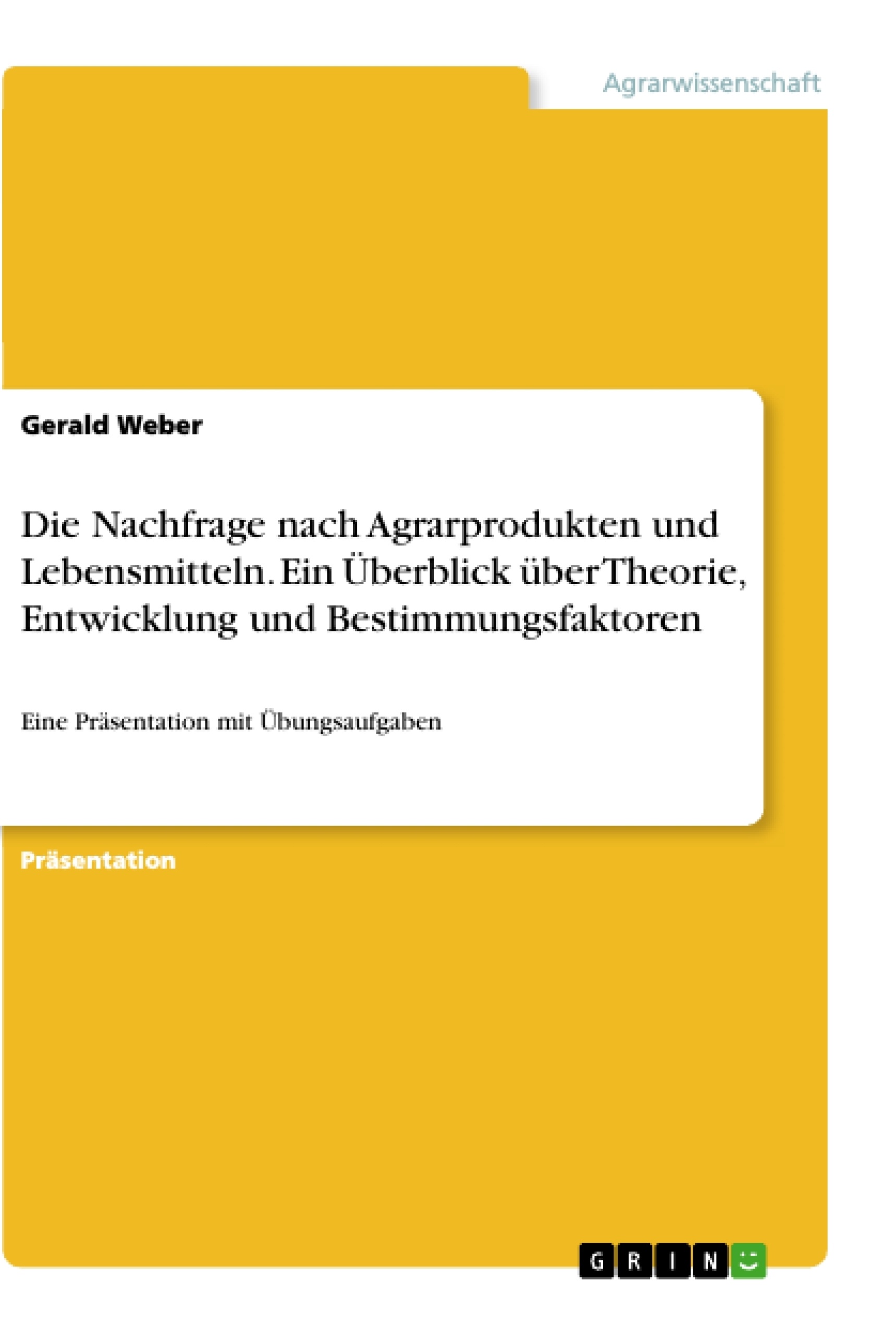Die Präsentation gibt einen Überblick über das Thema Nachfrage nach Agrarprodukten und Lebensmitteln im Bereich Agrarökonomik. Sie behandelt folgende Themen: Mikroökonomische Theoriegrundlagen, Entwicklung der Nachfrage nach Agrargütern, Bestimmungsfaktoren der Nahrungsmittelnachfrage, Verlauf von Nachfragekurven, Engel‘sches Gesetz, Empirische Nachfrageanalyse. Am Ende der Präsentation finden sich Übungsaufgaben zu den behandelten Inhalten.
Die Nachfrage nach Agrarprodukten und Lebensmitteln
Inhaltsverzeichnis
1 Mikroökonomische Theoriegrundlagen
2 Entwicklung der Nachfrage nach Agrargütern
3 Bestimmungsfaktoren der Nahrungsmittelnachfrage
4 Verlauf von Nachfragekurven
5 Engel‘sches Gesetz
6 Empirische Nachfrageanalyse
7 Übungsaufgaben
8 Literaturhinweise
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Inhaltsfolie zu Kapitel 1:
Mikroökonomische Theoriegrundlagen
- Nachfragetheorie - Grundannahme
- Grundlegende Aussagen aus der Nachfragetheorie
- Definition der Budgetgeraden
- Budgetgerade im Zwei- Güter-Fall
- Verschiebung der Budgetgeraden durch Einkommensänderung
- Drehung der Budgetgeraden durch Preisänderung
- Vollständigkeit der Konsumentenpräferenzen
- Transitivität der Konsumentenpräferenzen
- Reflexivität der Konsumentenpräferenzen
- Indifferenzkurve im Zwei-Güter-Fall
- Grenzrate der Substitution (GRS)
- Indifferenzkurven und Nutzenniveaus
- Maximierung der Konsumentenbefriedigung
- Auswirkungen von Preisänderungen auf die Nachfrage
- Verlauf der Preis-Nachfragekurve
- Kreuzpreisreaktionen der Nachfrage
- Auswirkungen von Einkommensänderungen auf die Nachfrage
- Verlauf der Einkommens-Nachfragekurve
Nachfragetheorie -Grundannahme
Die Konsumenten wählen aus einer Vielzahl möglicher Güterbündel das beste Güterbündel aus, das sie sich (gerade noch) leisten können.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Grundlegende Aussagen aus der Nachfragetheorie
- Auf der Budgetgeraden liegen alle Güterbündel, die das für den Konsum verfügbare Einkommen vollständig ausschöpfen.
- Einkommenzuwächse (-rückgänge) verschieben die Budgetgerade vom (zum) Ursprung weg (hin).
- Veränderungen der Produktpreisrelationen verändern die Steigung der Budgetgeraden.
- Indifferenzkurven geben die Präferenzen der Konsumenten wieder.
- Die Grenzrate der Substitution (GRS) misst die Steigung der Indifferenzkurve. Sie beschreibt wie viel Einheiten von Gut 2 der Konsument bereit ist aufzugeben für eine zusätzliche Einheit von Gut 1.
- Das optimale Konsumgüterbündel ist dasjenige Güterbündel auf der Budgetgeraden, das auf der höchsten Indifferenzkurve liegt. An dieser Stelle entspricht die GRS der Steigung der Budgetgeraden.
- Bei einem „normalen Gut“ führt ein Einkommenszuwachs (-rückgang) zu einem Nachfrageanstieg (-rückgang).
- Bei einem gewöhnlichen Gut geht (steigt) die Nachfrage zurück (an), wenn sich der Preis erhöht (verringert).
Definition der Budgetgeraden
Budgetrestriktion: m > P1X1 + P2X2 + ... + PnXn
Der Konsument kann nicht mehr Geld für den Konsum
des Güterbündels (X1,X2 , ..., Xn ) ausgeben, als ihm an Einkommen m zur Verfügung steht.
Budgetgerade: m =P1X1+ P2X2+ ... + PnXn
Das Güterbündel (X1,X2, ..., Xn) schöpft das Einkommen m bei gegebenen Preisen P1, P2, ..., Pn gerade aus.
Xi: Menge Gut i Pi: Preis Gut i m: Einkommen
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Budgetgerade im Zwei- Güter-Fall
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(d.h. Verbrauchsmengen X1 und X2 der beiden Güter 1 und 2) dar, die mit dem verfügbaren Einkommen m des Haushaltes bei gegebenen Preisen P1 und P2 realisierbar sind.
Verschiebung der Budgetgeraden durch Einkommensänderung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei einem Anstieg des Einkommens verschiebt sich die Budgetgerade nach „Nordost“. In welche Richtung verschiebt sie sich bei einem Einkommensrückgang?
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Drehung der Budgetgeraden durch Preisänderung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei einem Anstieg des Preises von Gut 1 dreht sich die Budgetgerade ausgehend vom vertikalen Achsenabschnitt nach „Südwest“. Wie dreht sie sich bei einem Rückgang des Preises von Gut 2?
Konsumenten vergleichen unterschiedliche Güterbündel bzw.
Warenkörbe Y=(Y1,Y2, ...,Yn) und X=(X1,X2, ...,Xn) und bilden eine Rangfolge, die ihre Präferenzordnung ausdrückt:
Indifferent [Y-X]: Güterbündel mit gleich hohem Nutzen.
Strikt präferiert [Y>X]: Y mit höherem Nutzen als X.
Schwach präferiert [ ¥>X ].: Y mit mindestens so hohem Nutzen wie X.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Transitivität der Konsumentenpräferenzen
(2. Annahme der Theorie des Konsumentenverhaltens)
Gewährleistung konsistenter Konsumentenpräferenzen:
Wenn
Y=(Y1,...,Yn) :■ X=(X1,...,Xn) und X=(X1,...,Xn) > Z=(Z!,...,Zn) dann
Y=(Y1,Y2, ...,Yn) ■ Z=(Z1,Z2, ...,Zn).
Identische Güterbündel liefern identischen Nutzen:
Es sei: Y^Y
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Indifferenzkurve im Zwei-Güter-Fall
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alle Güterbündel, die auf ein und derselben Indifferenzkurve liegen, sind indifferent, d.h. in der Bewertung durch den
Konsumenten „gleich gut“.[(X1‘,X2‘) ~(X1,X2)].
Grenzrate der Substitution (GRS)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Grenzrate der Substitution ist die Rate, zu der der Konsument bei konstantem Nutzenniveau bereit ist, Gut 2 gegen Gut 1 zu tauschen. Sie entspricht der Steigung der an die Indifferenzkurve gelegten Tangente.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Indifferenzkurven und Nutzenniveaus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine weiter vom Ursprung entfernt liegende Indifferenzkurve repräsentiert ein höheres Nutzenniveau.
Maximierung der Konsumentenbefriedigung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei gegebenem Einkommen wird das höchste Nutzenniveau erreicht, wenn die GRS zwischen Gut 2 und Gut 1 dem negativen Preisverhältnis von Gut 1 zu Gut 2 entspricht.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Auswirkungen von Preisänderungen
P1‘‘ > P1‘ > P1 X1‘‘ < X1‘ < X1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Preisanstieg von Gut 1 bewirkt einen Rückgang der Nachfrage nach
Gut 1 (AX1/Ap1 < 0). Die Nachfrage nach Gut 2 verändert sich hier nicht (AX2/Ap1 = 0). Das muss aber nicht so sein, wie wir später sehen werden.
Verlauf der Preis-Nachfragekurve
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Preis-Nachfragefunktion hat gewöhnlich einen fallenden Verlauf.
Ein Gut, dessen Konsum bei steigendem (fallendem) Preis abnimmt (zunimmt), wird als „gewöhnliches Gut“ bezeichnet.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Kreuzpreisreaktionen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Nachfrage nach Gut 2 steigt durch den Preisanstieg von Gut 1 an (AX2/Ap1 > 0).
Auswirkungen von Einkommensänderungen
m‘‘> m‘> m X/ > X/ > Xt und X2‘‘ > X2‘ > X2
Y
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Einkommensanstieg bewirkt eine Zunahme der Nachfrage nach beiden Gütern.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Verlauf der Einkommens-Nachfragekurve
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Einkommens-Nachfragefunktion hat im Normalfall einen steigenden Verlauf. Ein Gut, dessen Konsum bei ansteigendem (fallendem) Einkommen zunimmt (abnimmt), wird als „normales Gut“ bezeichnet.
Die Einkommens-Nachfragekurve wird auch als Engelkurve bezeichnet.
Inhaltsfolie zu Kapitel 2:
Entwicklung der Nachfrage nach Agrargütern
- Bestandteile der Agrargüternachfrage nach Art der Verwendung
- Abnehmer für Agrargüter
- Nahrungsverbrauch - pflanzliche Erzeugnisse
- Nahrungsverbrauch -tierische Erzeugnisse
- Nahrungsverbrauch in der EU (Grafik)
- Nahrungsverbrauch in den Entwicklungsländern (Grafik)
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Bestandteile der Agrargüternachfrage nach Art der Verwendung
- Als Vorleistung in der Landwirtschaft
- Direkt, z.B. Futtergetreide, Saatgut, Jungvieh, Ferkel
- Nach Weiterverarbeitung, z.B. Futtergetreide Kraftfutter
- Als Nahrungsmittel
- Direkter menschlicher Verbrauch (z.B. Obst, Gemüse)
- Nach Weiterverarbeitung
z.B. in Molkereien: Rohmilch Trinkmilch, Butter, Käse, ... in Müllereien: Weizen Mehl, Gries
- Als Industrierohstoff und Energielieferant
(„Nachwachsende Rohstoffe“)
z.B. Zucker und Stärke chemische Grundstoffe
Raps, Zuckerrohr Biokraftstoffe
Mais Biogas Strom
Abnehmer für Agrargüter
- Unternehmen
- Andere landwirtschaftliche Unternehmen
- Privater und genossenschaftlicher Landhandel
- Ernährungs- und Futtermittelindustrie (Kraftfutterhersteller, Molkereien, Schlachthöfe, Mühlen, ...)
- Ernährungshandwerk (Bäckereien, Metzgereien)
- Lebensmittelhandel
- Gastronomie
- Direktabsatz an Privathaushalte
- Ausland (Exporte)
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Nahrungsverbrauch - pflanzliche Erzeugnisse
Durchschnitt (kg/Kopf/Jahr) Jährl. Änd. (%)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Berechnung mit Daten aus FAO: FAOSTAT, Datenbankabfrage vom 18.3.2003, http://www.fao.org
Nahrungsverbrauch - tierische Erzeugnisse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Berechnung mit Daten aus FAO: FAOSTAT, Datenbankabfrage vom 18.3.2003, http://www.fao.org
Aktuellere Daten: siehe Übungsaufgabe 8
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Nahrungsverbrauch in der EU
Entwicklung des pro-Kopf-Nahrungsverbrauchs ausgewählter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der EU-15, 1980-2000
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jahr
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten aus FAO: FAOSTAT, Datenbankabfrage vom 18.3.2003, http://www.fao.org
Aktuellere Daten: siehe Übungsaufgabe 8
Nahrungsverbrauch in den Entwicklungsländern
Entwicklung des pro-Kopf-Nahrungsverbrauchs ausgewählter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in den Entwicklungsländern, 1980-2000
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jahr
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten aus FAO: FAOSTAT, Datenbankabfrage vom 18.3.2003, http://www.fao.org Aktuellere Daten: siehe Übungsaufgabe 8
© Gerald Weber, HU Berlin
Bestimmungsfaktoren der Nachfrage
- Bevölkerungsentwicklungen (z.B. Wachstum, Altersstruktur)
- Einkommen
- Preise
- Gewohnheiten, Traditionen, Lebensstil
- Gesundheits- und Umweltbewusstsein
- Urbanisierung
- Trends, Influencer
- Kennenlernen anderer Esskulturen (z.B. durch Reisen und Medien)
- Migration
- Sondereinflüsse (z.B.Corona-Pandemie)?
Bestimmungsgründe der Nahrungsmittelnachfrage
X = X N (p, Ps, Pk, Y k, B, U)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Entwicklung der Weltbevölkerung
in Millionen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten aus FAO: FAOSTAT, Datenbankabfrage vom 19.2.2002, http://www.fao.org
Wachstumsraten der Weltbevölkerung
in % p.a.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten aus FAO: FAOSTAT, Datenbankabfrage vom 19.2.2002, http://www.fao.org
Aktuellere Daten: siehe Übungsaufgabe 8
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Einfluss der Bevölkerungsentwicklung
- In Entwicklungsländern treibende Kraft der Nahrungsmittelnachfrage
- Lose Beziehungen zwischen Bevölkerungswachstum und Wirtschaftsentwicklung
- Häufig negative Beziehung Beziehung zwischen ProKopf-Einkommen und Geburtenrate
- In Ländern mit sehr niedrigem Einkommen meist höheres Bevölkerungswachstum als in Ländern mit sehr hohem Einkommen
- Unterschiede in der Relation „Geburtenrate/Sterberate“ zwischen Industrie- und Entwicklungsländern führen zu unterschiedlichen Alterstrukturen und damit auch zu anderen Bedürfnisstrukturen.
Einkommen
- In mittleren Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Schwellenländer) ist das Einkommenswachstum tragende Kraft des Wachstums der Nahrungsmittelnachfrage.
- Im weiteren Verlauf des wirtschaftlichen Wachstums nimmt die Bedeutung des Einkommens für die Höhe der quantitativen Nahrungsmittelnachfrage aufgrund der Bedarfssättigung wieder ab (Engel‘sches Gesetz).
- In einer Wohlstandsgesellschaft kommt es durch Veränderung der Lebens- und Arbeitsumstände zu einer differenzierteren Nahrungsmittelnachfrage mit qualitativem Wachstum. So werden eiweiß- und vitaminreiche Lebensmittel oder Lebensmittel mit besonderen Qualitätsstandards (z.B. Produkte aus ökologischem Landbau) vermehrt nachgefragt. Außerdem wird meist ein höherer Verarbeitungsgrad nachgefragt (z.B. Fertigprodukte).
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Preise
- In anfänglichen Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung haben die Preise für Nahrungsmittel meist einen stärkeren Einfluss auf die Nachfragemengen. In Ländern mit einem hohen Anteil an Selbstversorgerwirtschaft wird der Preiseinfluss jedoch abgeschwächt.
- Mit zunehmendem Wohlstand hat das Preisniveau für Nahrungsmittel einen immer geringeren Einfluss auf die Gesamtnachfrage nach Nahrungsmitteln.
- Gleichwohl können auch bei relativ hohem Volkseinkommen Preisänderungen bei einzelnen Agrarund Ernährungsgütern Substitutionsprozesse im Konsum auslösen. Diese führen jedoch weniger zu einer Veränderung der Gesamtnachfrage nach Nahrungsmitteln sondern vielmehr zu Substitutionen zwischen den einzelnen Ernährungsgütern.
Inhaltsfolie zu Kapitel 4:
Verlauf von Nachfragekurven
- Nachfragekurven
- Giffen-Güter und inferiore Güter
- Substitutions- und Einkommenseffekt eines gewöhnlichen Gutes
- Substitutions- und Einkommenseffekt eines Giffen-Gutes
- Diskussion von Giffen1)-Gütern
- Methodische Hauptströmungen der empirischen Nachfrageanalyse
- Preiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage
- Veränderung von Nachfrageelastizitäten im Zeitablauf für Deutschland
- Preiselastizität der wertmäßigen Nachfrage
- Zusammenhang zwischen wert- und mengenmäßiger Nachfrage
- Amoroso-Robinson-Relation
- Einkommens-Nachfragereaktion eines normalen Gutes
- Einkommens-Nachfragereaktion eines inferioren Gutes
- Diskussion inferiorer Güter
- Einkommenselastizität der mengenmäßigen Nachfrage
- Veränderung von Nachfrageelastizitäten im Zeitablauf für Deutschland
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Nachfragekurven
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nachfragekurven
Die Preis-Nachfragefunktion für ein „gewöhnliches Gut“ hat einen fallenden Verlauf.
Die Einkommens-Nachfragefunktion (Engelkurve) für ein „normales Gut“ hat einen ansteigenden Verlauf.
Giffen-Güter und inferiore Güter
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Substitutions- und Einkommenseffekt bei einem gewöhnlichen Gut
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Preisrückgang von Gut 1 bewirkt einen Anstieg der Nachfrage nach Gut 1 und einen Rückgang der Nachfrage nach Gut 2. Gut 1 ist ein „gewöhnliches“ Gut.
Substitutions-und Einkommenseffekt bei einem Giffen-Gut
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
einen Anstieg der Nachfrage nach Gut 2.
: Einkommenseffekt Gut 1 ist ein „Giffen“-Gut.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Diskussion von Giffen1)-Gütern
- Beispiel: Rückgang (Anstieg) des Kartoffelverbrauchs und Anstieg (Rückgang) des Fleischverbrauchs bei sinkenden (steigenden) Kartoffelpreisen.
- Bei sehr niedrigen Einkommen kann der Einkommenseffekt einer Preissenkung (eines Preisanstieges) bei Grundnahrungsmitteln in Bezug auf die Nachfrage nach Grundnahrungsmittel negativ (positiv) sein. Der positive (negative) Substitutionseffekt wird durch den negativen (positiven) Einkommenseffekt überkompensiert.
- In Bezug auf die Nachfrage nach höherwertigen Nahrungsmitteln kann der Einkommenseffekt einer Preissenkung (eines Preisanstieges) bei Grundnahrungsmitteln positiv (negativ) sein. Der negative (positive) Substitutionseffekt wird durch den positiven (negativen) Einkommenseffekt überkompensiert. (Anstieg des Fleischverbrauchs bei steigendem Realeinkommen).
1) Giffen: Nationalökonom des 19. Jahrhunderts
Methodische Hauptströmungen der empirischen Nachfrageanalyse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einfaktorielle Eingleichungsmodelle z.B. Xi=f(Y)
Mehrfaktorielle
Eingleichungsmodelle z.B.
Xi=f(Y,Pi,Pj,...)
Mehrgleichungssysteme z.B.
Xi=f(Y,Pi,Pj,...) Xj=f(Y,Pi,Pj,...)
Y=PiXi+PjXj
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Preiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage
Erfasst das Ausmaß der Beziehungen zwischen der nachgefragten Menge (X) und den Preisen (P)
Eigenpreiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kreuzpreiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Preiselastizität der wertmäßigen Nachfrage
Erfasst das Ausmaß der Beziehungen zwischen den Ausgaben für ein Gut (A) und den Preisen (P)
Eigenpreiselastizität der wertmäßigen Nachfrage:
Quotient aus relativer Ausgabenänderung für ein Gut und der sie bewirkenden relativen Änderung seines Preises
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kreuzpreiselastizität der wertmäßigen Nachfrage:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Zusammenhang zwischen wertmäßiger und mengenmäßiger Nachfrage
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Amoroso-Robinson-Relation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Einkommens-Nachfragereaktion bei einem inferioren Gut
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Einkommensrückgang bewirkt Absinken der Nachfrage nach beiden Gütern. Beide Güter sind „normale“ Güter.
Einkommens-Nachfragereaktion bei einem inferioren Gut
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Einkommensrückgang bewirkt einen Anstieg der Nachfrage nach Gut 1 und einen Rückgang der Nachfrage nach Gut 2. Gut 1 ist ein „inferiores“ Gut und Gut 2 ist ein „normales“ Gut.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Diskussion inferiorer Güter
- Beispiel: Bei sinkenden Einkommen Rückgang des Fleischkonsums (normales Gut) und Anstieg des Kartoffelverbrauches (inferiores Gut).
- Positiver (bzw. negativer) Einkommenseffekt bei Kartoffeln und negativer (bzw. positiver) Einkommenseffekt bei Fleisch als Folge von sinkendem (bzw. ansteigendem) Realeinkommen. Man beachte Parallelen zu der Diskussion von Giffen-Gütern.
- Die Nachfrage nach einem Gut kann bei steigendem Einkommen zunächst zunehmen (normal), um dann bei weiter steigendem Einkommen wieder abzunehmen (inferior).
- D.h., ob ein Gut ein inferiores oder normales Gut ist, hängt neben den Produkteigenschaften auch vom Einkommensniveau ab. Somit kann ein und dasselbe Gut abhängig vom Einkommensniveau des betrachteten Konsumenten (des Haushaltes, der Region, des Landes) sowohl normal als auch inferior sein.
Einkommenselastizität der mengenmäßigen Nachfrage
Erfasst das Ausmaß der Beziehungen zwischen der nachgefragten Menge (X) und dem Einkommen (Y)
Einkommenselastizität der mengenmäßigen
Nachfrage:
Quotient aus relativer Mengenänderung eines Gutes und der sie bewirkenden Einkommensänderung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Veränderung von Nachfrageelastizitäten im Zeitablauf für Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Wildner (2001), S. 280
Aktuellere Schätzungen: siehe Übungsaufgabe 14
Inhaltsfolie zu Kapitel 5:
Engel‘sches Gesetz
- Das „Engel‘sche Gesetz“
- Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel
- Erlöse der Landwirtschaft und Verbraucherausgaben
- Moderne Interpretation des Engel‘schen Gesetzes
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Das „Engel‘sche Gesetz“
„Je ärmer eine Familie ist, einen desto größeren Anteil von den Gesamtausgaben muss sie zur Beschaffung der Nahrung aufwenden. Je wohlhabender jemand ist, umso geringer ist der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel an den Gesamtausgaben.“
Ernst Engel:
Die Productions- und Consumptionsverhältnisse des Königreichs Sachsen. Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen
Ministeriums des Innern, Nr. 8 und 9, November 1857, S. 169.
Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel
Anteil am privaten Verbrauch (%)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen: Europäische Kommission (2000); Brosig, S. (1999); IFPRI (1996)
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Anteil der Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel an den Ausgaben für den privaten Verbrauch in Deutschland (in %)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Haushaltstyp 1: 2-Personen-Rentnerhaushalt
Haushaltstyp 2: 4-Personen-Haushalt von Angestellten und Arbeitern mit mittlerem Einkommen
Haushaltstyp 3: 4-Personen-Haushalt von Beamten und Angestellten mit höherem Einkommen
Quellen: E. Wöhlken (1991) und eigene Berechnungen mit Daten aus Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1997)
Aktuellere Daten: siehe Übungsaufgabe 16
Erlöse der Landwirtschaft und Verbraucherausgaben
Anteil der Verkaufserlöse der deutschen Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel inländischer Herkunft (%)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen: E. Wöhlken (1991) und Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Agrarberichte der Bundesregierung, versch. Jahrgänge
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Moderne Interpretation des Engel‘schen Gesetzes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Verbraucherausgaben für Nicht-Nahrungsmittel
- Verbraucherausgaben für komplementäre Dienstleistungen des Ernährungsgewerbes
- Verbaucherausgaben für landwirtschaftliche Produkte
Übungsaufgaben I
1. In der Ausgangssituation sei die Budgetgerade des Konsumenten gegeben durch m=p1x1 +p2x2, wobei m: Einkommen, p1: Produktpreis von Gut1, p2: Produktpreis von Gut 2, x1: Nachfragemenge von Gut1 und x2: Nachfragemenge von Gut 2.
a) Stellen Sie die Budgetgerade grafisch in einem Koordinatensystem dar.
b) Der Preis von Gut 1 verdreifache und der Preis von Gut 2 verfünffache sich. Gleichzeitig verdoppele sich das Einkommen. Beschreiben Sie die neue Budgetgerade mit Hilfe der Preise und des Einkommens der Ausgangssituation.
c) Das Einkommen und die Preise beider Güter verzehnfachen sich. Verändert sich damit auch die Budgetgerade? Begründen Sie Ihr Ergebnis!
d) Was passiert mit der unter a) dargestellten Budgetgeraden, wenn der Preis von Gut 2 ansteigt, der Preis von Gut 1 und das Einkommen sich hingegen
nicht verändern? Zeichnen Sie die neue Budgetgerade in das Koordinatensystem ein und erläutern Sie daran das Ergebnis.
2. Was bedeutet Transitivität der Konsumentenpräferenzen?
3. Veranschaulichen Sie das Konzept einer Indifferenzkurve anhand einer grafischen Darstellung für den Zwei-Güter-Fall. Verwenden Sie dabei auch Begriffe, mit denen die Präferenzordnung eines Konsumenten beschrieben werden kann.
4. Erklären Sie, warum die Grenzrate der Substitution zwischen zwei Gütern für ein Wirtschaftssubjekt gleich dem Preisverhältnis der Güter sein muss, damit das Wirtschaftssubjekt maximale Befriedigung erreicht.
5. Zeigen Sie anhand des Zwei-Güter-Falles, wie der Konsument bei gegebenem Einkommen (m), Preisen (p1,p2) und Präferenzen das optimale Konsumgüterbündel (x1,x2) bestimmen kann.
a) Fertigen Sie hierzu eine grafische Darstellung an und erläutern sie diese. Geben Sie dabei auch das Optimalitätskriterium an und erklären Sie, was unter der Grenzrate der Substitution (GRS) zu verstehen ist?
b) Der Preis von Gut 2 sinke gegenüber der in a) dargestellten Ausgangssituation. Wie verändert sich das optimale Konsumgüterbündel? Ziehen daraus Schlüsse für den Verlauf der Preis-Nachfragekurve!
c) Das Einkommen sinke gegenüber der in a) dargestellten Ausgangssituation Wie verändert sich das optimale Konsumgüterbündel? Ziehen Sie daraus Schlüsse für den Verlauf der Einkommens-Nachfragekurve (Engelkurve)!
6. Diskutieren Sie, ob und warum die Konsumenten wahrscheinlich schlechter gestellt werden, wenn ein von ihnen konsumiertes Gut rationiert wird.
7. Nehmen Sie an, dass Verbraucher X Butter und Margarine als gegeneinander vollkommen substituierbar ansieht.
a) Zeichen Sie eine Schar von Indifferenzkurven, die die Präferenzen von Verbraucher X zwischen Butter und Margarine beschreiben.
b) Wenn die Butter 8,40 €/kg und die Margarine 4,00 €/kg kostet und Verbraucher X ein Budget von jährlich 160 € für Butter und Margarine ausgeben will, welchen Warenkorb aus Butter und Margarine wird Verbraucher X wählen? Stellen Sie das Ergebnis graphisch dar.
8. a) Geben Sie einen Überblick über die Bestimmungsfaktoren der Agrargüternachfrage und diskutieren Sie deren Wirkungsweise. b) Aktualisieren Sie die Tabellen und Schaubilder zum Verbrauch und dessen Bestimmungsgründe auf den Seiten 24, 25, 26, 27, 30, 31, 53 und 54. c) Gibt es hierbei für die ersten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts wesentliche Veränderungen gegenüber den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts?
9. Was versteht man unter Giffen-Gütern und was sind inferiore Güter? Diskutieren Sie deren Vorkommen anhand von Beispielen.
Dr. Gerald Weber: Schulungsmaterialien zur Agrarökonomik
Übungsaufgaben II
10. Die Nachfrage für ein Agrargut in einem Land sei gegeben durch folgende Funktion:
X=2*P-0,1*Y0,4*B mit
X: Nachfragemenge des Agrargutes P: Preis des Agrargutes
Y: Pro-Kopf-Einkommen B: Bevölkerungszahl.
a) Wie hoch sind die Eigenpreiselastizität und die Einkommenselastizität der mengenmäßigen Nachfrage?
b) Der Preis steige um 4% an, die Pro-Kopf-Einkommen erhöhen sich um 2,5% und die Bevölkerung nehme um 1% ab. Wie hoch ist die prozentuale Veränderung der Mengennachfrage?
11. Der Wirtschaftsverband der Zuckererzeuger untersucht die ökonomischen Auswirkungen der Einführung einer effizienteren Herstellungstechnologie. Von der neuen Technologie wird eine Reduzierung der Stückkosten (Kosten je Tonne Zucker) um 10% erwartet. Die Kostensenkung soll teilweise an die Verbraucher weitergegeben werden, wodurch es zu einem Absinken der Verbraucherpreise um 5% kommen soll. Es interessieren unter anderem die Auswirkungen auf die mengenmäßige Nachfrage und die Verbraucherausgaben für Zucker.
In der Ausgangssituation werden X = 3.000.000 t Zucker verbraucht zu einem Preis von P = 790 Euro/t. Eine in Auftrag gegebene ökonometrische Studie hat ergeben, dass die Eigenpreiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage qX,P = -0,15 beträgt.
Berechnen Sie; um wie viel Mengeneinheiten sich der Zuckerverbrauch voraussichtlich verändert. Beantworten Sie auch die Frage, ob die Verbraucherausgaben für Zucker ansteigen oder sinkenwerden und wie hoch die Eigenpreiselastizität der wertmäßigen Nachfrage ist.
12. Die Eigenpreiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage nach Schnittrosen betrage qX,P = -2. Welches sind die Auswirkungen einer Erhöhung des Marktangebotes für SchnittrosenaufdieVerbraucherausgabenfürSchnittrosen?BegründenSieIhreAussage(Amoroso-Robinson-Relation)!
13. Die Eigenpreiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage für Schnittrosen betrage qX,P °=°-3. Das Marktangebot sinke um 40%, da zwei Hauptlieferländer aus unterschiedlichen Gründen Lieferschwierigkeiten haben. Untersuchen Sie die Auswirkungen auf Preise und Verbraucherausgaben. Gehen Sie anhand folgender Einzelfragen vor:
a) WirdderGleichgewichtspreisaufdemMarktfürSchnittrosenalsFolgedessinkendenMarktangebotesansteigenoderfallen?UndumwelchenProzentsatz?
b) Was versteht man unter „Grenzausgaben“ undwelches Vorzeichen haben diese indem obigen Beispiel?
c) WerdendieVerbraucherausgabenfürSchnittrosenansteigenodersinken?BegründenSieihreAussage!
14. Führen Sie ein Literaturrecherche durch. Gibt es neuere Schätzungen zu den Preis und Einkommenelastizitäten der Nachfrage nach Agrar- und Ernährungsgütern? UnterscheidensichdieWertedeutlichvondeneninderTabelleaufSeite50?Wennja,worankönntedasliegen?.
15. Wasverstehtmanuntereiner„Engel-Kurve“ undwas besagt das „Engel'scheGesetz“? Diskutieren Sie, inwieweit das Engel'sche Gesetz auch heute noch Gültigkeit besitzt.
16. Führen Sie eine Datenrecherche durch, um den Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel am privaten Verbrauch zu ermitteln. Schauen Sie sich dazu die Webseiten der amtlichen Statistik Ihres Landes oder von internationalen Institutionen an, zum Beispiel von Statistik Austria, Statistisches Bundesamt (DESTATIS - Deutschland), Bundesamt für Statistik (Schweiz), Institut national de la statistique et des études économiques (Frankreich), National Bureau of Statistics ofChina, Europäische Kommission - Eurostat, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Finden sie heraus, ob und wie sich geeignete Daten herunterladen lassen. Stellen Sie eine Tabelle zusammen, die für den Zeitraum von ca. 2000 bis heute den Anteil der Nahrungsmittelausgaben am privaten Verbrauch zeigt. Vielleicht finden sie auch geeignete Informationen auf den Webseiten von Fachministerien, Fachinformationsdiensten und ähnlichen Dienstleistern. Diskutieren Sie dieFrage 15 noch einmalvor dem Hintergrund Ihrerneuen Rechercheergebnisse.
Literaturhinweise
- Brosig, S. (1999) : Die private Nachfrage nach Nahrungsmitteln im Transformationsprozeß Tschechiens und Polens. Dissertation, Göttingen
- Henrichsmeyer, W.; Witzke, H.P. (1991): Agrarpolitik. Bd. 1: Agrarökonomische Grundlagen. UTB-Taschenbuch1651,KapitelIII,Abschnitt4
- Henze, A. (1994): Marktforschung - Grundlage für Marketing und Marktpolitik. (UTB 1792) Stuttgart-Hohenheim, Kapitel 6.3.1-6.3.4
- Kearney, J. (2010): Food consumption trends and drivers, Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 365, 2793-2807
- Regmi, A.; Seal Jr., J.L. (2010): Cross Price Elasticities of Demand Across 114 Countries, E United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Technical Bulletin Number 1925
- Schröck, R. (2013): Qualitäts- und Endogenitätsaspekte in Nachfragesystemen: Eine vergleichende Schätzung von Preis- und Ausgabenelastizitäten der Nachfrage nach ökologischem und konventionellem Gemüse in Deutschland. In: German Journal of AgriculturalEconomics,Number1,18-38
- Wildner, S.(2001):Quantifizierung derPreis- und Ausgabenelastizitäten für Nahrungsmittel in Deutschland:Schätzungeines LA/AIDS.Agrarwirtschaft50(2001, Heft5, S. 275-286)
- Wöhlken, E. (1991): Einführung in die landwirtschaftliche Marktlehre, UTB-Taschenbuch 793, Kapitel 2
Häufig gestellte Fragen zu "Die Nachfrage nach Agrarprodukten und Lebensmitteln"
Was sind die Hauptbestandteile der Agrargüternachfrage nach Art der Verwendung?
Die Agrargüternachfrage lässt sich nach Art der Verwendung in drei Hauptbestandteile unterteilen: als Vorleistung in der Landwirtschaft (direkt oder nach Weiterverarbeitung), als Nahrungsmittel (direkter menschlicher Verbrauch oder nach Weiterverarbeitung), und als Industrierohstoff und Energielieferant (z.B. nachwachsende Rohstoffe).
Wer sind die typischen Abnehmer für Agrargüter?
Zu den typischen Abnehmern für Agrargüter zählen Unternehmen (andere landwirtschaftliche Betriebe, Landhandel, Ernährungs- und Futtermittelindustrie, Ernährungshandwerk, Lebensmittelhandel, Gastronomie), Privathaushalte (Direktabsatz) und das Ausland (Exporte).
Welche Faktoren beeinflussen die Nachfrage nach Agrarprodukten und Lebensmitteln?
Die Nachfrage wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter Bevölkerungsentwicklungen, Einkommen, Preise, Gewohnheiten, Traditionen, Lebensstil, Gesundheits- und Umweltbewusstsein, Urbanisierung, Trends, das Kennenlernen anderer Esskulturen, Migration und Sondereinflüsse wie die Corona-Pandemie.
Was sind die grundlegenden Aussagen aus der Nachfragetheorie?
Einige grundlegende Aussagen sind, dass die Budgetgerade alle Güterbündel umfasst, die das verfügbare Einkommen ausschöpfen, Einkommensänderungen die Budgetgerade verschieben, Preisänderungen die Steigung der Budgetgeraden verändern, Indifferenzkurven die Präferenzen der Konsumenten widerspiegeln und die Grenzrate der Substitution die Steigung der Indifferenzkurve misst.
Was ist die Budgetgerade und wie wird sie beeinflusst?
Die Budgetgerade stellt alle Güterbündel dar, die sich ein Konsument bei gegebenem Einkommen und Preisen leisten kann. Einkommensänderungen verschieben die Budgetgerade parallel, während Preisänderungen die Steigung der Budgetgeraden verändern.
Was sind Indifferenzkurven und die Grenzrate der Substitution (GRS)?
Indifferenzkurven verbinden Güterbündel, die dem Konsumenten den gleichen Nutzen stiften. Die Grenzrate der Substitution (GRS) misst die Steigung der Indifferenzkurve und gibt an, wie viele Einheiten eines Gutes der Konsument bereit ist, für eine zusätzliche Einheit eines anderen Gutes aufzugeben, ohne dass sich sein Nutzenniveau ändert.
Wie maximiert ein Konsument seine Befriedigung?
Ein Konsument maximiert seine Befriedigung, indem er das Güterbündel auf der Budgetgeraden wählt, das auf der höchsten erreichbaren Indifferenzkurve liegt. In diesem optimalen Punkt entspricht die GRS dem Preisverhältnis der Güter.
Was passiert mit der Nachfrage, wenn sich Preise oder Einkommen ändern?
Bei einem normalen Gut führt ein Einkommenszuwachs zu einem Nachfrageanstieg. Bei einem gewöhnlichen Gut führt ein Preisanstieg zu einem Nachfragerückgang. Kreuzpreisreaktionen beschreiben, wie sich die Nachfrage nach einem Gut ändert, wenn sich der Preis eines anderen Gutes ändert.
Was sind Giffen-Güter und inferiore Güter?
Ein Giffen-Gut ist ein Gut, bei dem die Nachfrage steigt, wenn der Preis steigt (und umgekehrt). Ein inferiores Gut ist ein Gut, bei dem die Nachfrage sinkt, wenn das Einkommen steigt (und umgekehrt).
Was besagt das Engel‘sche Gesetz?
Das Engel'sche Gesetz besagt, dass der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel am Gesamteinkommen sinkt, wenn das Einkommen steigt.
Was ist die Preiselastizität der mengenmäßigen Nachfrage?
Sie erfasst das Ausmaß der Beziehung zwischen der nachgefragten Menge und den Preisen. Sie wird als Quotient aus der relativen Mengenänderung und der sie bewirkenden relativen Preisänderung berechnet.
Was ist die Einkommenselastizität der mengenmäßigen Nachfrage?
Sie erfasst das Ausmaß der Beziehung zwischen der nachgefragten Menge und dem Einkommen. Sie wird als Quotient aus der relativen Mengenänderung und der sie bewirkenden Einkommensänderung berechnet.
Was beschreibt die Amoroso-Robinson-Relation?
Die Amoroso-Robinson-Relation beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Preis, der Preiselastizität der Nachfrage und den Grenzausgaben.
- Quote paper
- Dr. Gerald Weber (Author), 2021, Die Nachfrage nach Agrarprodukten und Lebensmitteln. Ein Überblick über Theorie, Entwicklung und Bestimmungsfaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998507