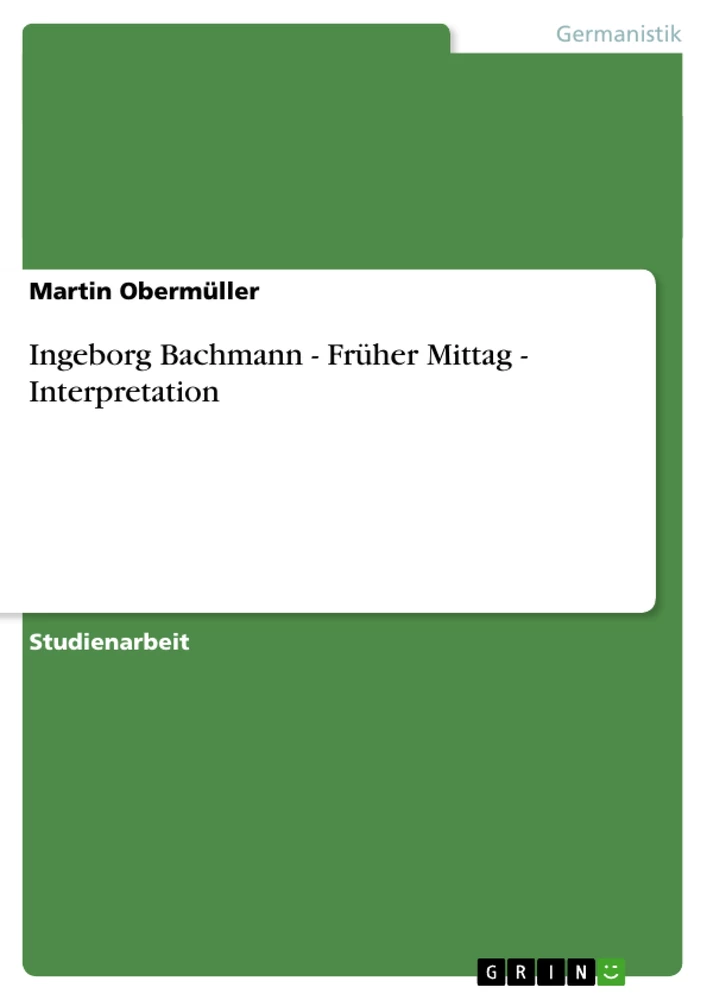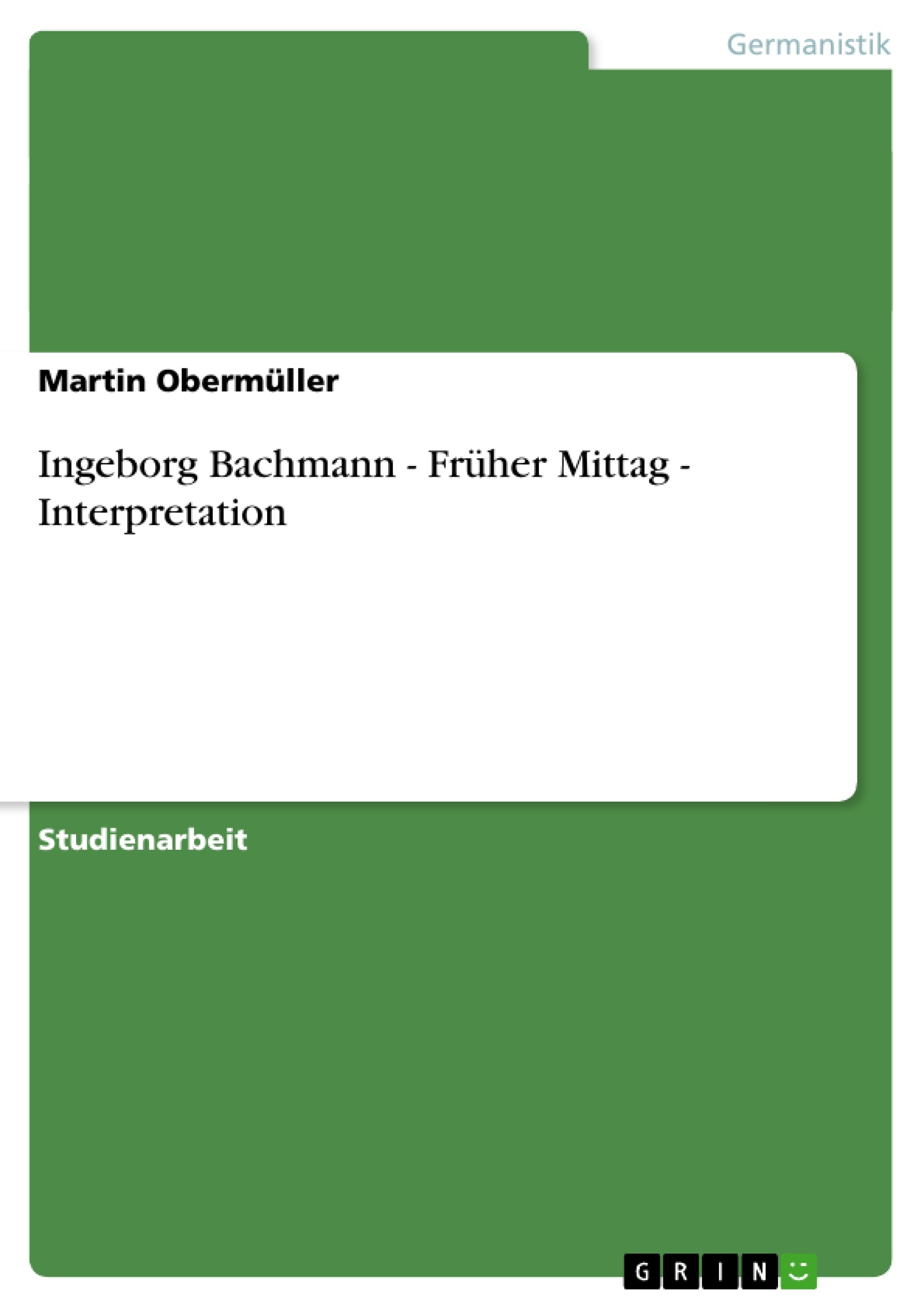Was geschieht, wenn die Schatten der Vergangenheit die Gegenwart verdunkeln und die Zukunft zu verschlingen drohen? In diesem Buch wird Ingeborg Bachmanns tiefgründiges Gedicht "Früher Mittag" seziert, ein Werk, das sich unerschrocken mit den Nachwirkungen des Nazifaschismus in Deutschland auseinandersetzt. Es ist eine Reise durch die Trümmer einer Nation, die versucht, sich neu zu erfinden, während die Geister der Vergangenheit an ihr zerren. Die Analyse enthüllt, wie Bachmann die deutsche Nachkriegszeit in ihren Versen verarbeitet und dabei die Frage aufwirft, ob ein wahrer Neubeginn überhaupt möglich ist, solange die Schrecken der Vergangenheit nicht vollständig aufgearbeitet sind. Das Gedicht entpuppt sich als ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verdrängung, der unterschwelligen Bedrohung durch ehemalige Täter und der fragilen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Der Leser wird mitgenommen auf eine sprachliche Entdeckungsreise, die die Bedeutung von Zeit, Symbolik und den subtilen Wandel in Bachmanns Tonfall ergründet. Es wird untersucht, wie die Dichterin mit den Mitteln der Sprache die "schlechte Sprache" der Vergangenheit überwinden und ein "Utopia der Sprache" erschaffen will. Die Analyse zeigt, wie Bachmanns Gedicht zwischen Anklage und Mahnung schwankt und den Leser dazu auffordert, sich der unbequemen Wahrheit zu stellen: Kann Deutschland seinem "uralten Traum von der Macht" entkommen, oder ist es dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen? Das Buch beleuchtet, wie Bachmann volksliedhafte Elemente und verstörende Bilder der Gegenwart kombiniert, um so das Vertraute zu verfremden und die Bewußtseinsinhalte des Lesers aufzurütteln. Es wird detailliert auf die korrespondierenden und kontrastiven Bezüge innerhalb des Gedichts eingegangen und die Frage untersucht, wie Bachmann durch die Deformation und Verfremdung der Sprache auf ein "Utopia der Sprache" hinarbeitet, welches die Überwindung der negativen Gegenwart ermöglichen soll. Die Analyse zeigt, dass "Früher Mittag" nicht nur ein Gedicht über die Vergangenheit ist, sondern auch eine Warnung vor den Gefahren der Gegenwart und eine Hoffnung auf eine Zukunft, in der eine neue Sprache gefunden werden kann, um das Unsägliche auszusprechen und so den Kreislauf der Geschichte zu durchbrechen. Es ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit Schuld, Vergebung und der transformativen Kraft der Sprache in einer Zeit des Umbruchs.
Gliederung
1 Einleitung
2 Ausgangspunkt der Dichtung
3 Die Bewältigung der Vergangenheit mittels der dichterischen Sprache
3. 1 Ingeborg Bachmann, Früher Mittag
3. 2 Zeitstruktur des Gedichts
3. 2. 1 Zeitwende: Auf- und Umbruch
3. 2. 2 Gegenwart: Deutschlands Traum von der Macht
3. 2. 3 Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
3. 3 Stiluntersuchungen
3. 3. 1 Korrespondierende und kontrastive Bezüge des Gedichts
3. 3. 2 Sprachbetrachtung
4 Abschließende Bemerkung
5 Anhang
5. 1 Anmerkungen
5. 2 Literaturverzeichnis
5. 3 Gliederung
1 Einleitung
"Daß Dichten außerhalb der geschichtlichen Situation stattfindet, wird heute wohl niemand mehr glauben ..."(BW 4, S.196). Was aber die Lyrik angelangt, so herrscht noch immer ein Dichtungsverständnis vor, das Innerlichkeit und Natur eher assoziiert als gesellschaftliche Wirklichkeit. Doch ist es gerade diese "gesellschaftliche Wirklichkeit", die in der modernen Lyrik nach 1945 eine so bedeutende Rolle spielt (Anm. 1).
Ingeborg Bachmann, die als eine der wichtigsten Vertreterinnen der modernen Lyrik gilt, weist den politisch - sozialen Zeiterscheinungen jedoch lediglich in "Die gestundete Zeit" große Bedeutung zu, während sie sich in dem 1956 erschienenen Gedichtzyklus "Anrufung des großen Bären" und vor allem in den noch später entstandenen Gedichten fast ausschließlich mit Sprachbetrachtung befaßt. "Die gestundete Zeit" nimmt also innerhalb des lyrischen Schaffens der Bachmann eine Sonderstellung ein, da sie sich in diesem Werk vor allem mit der politischen und sozialen Wirklichkeit der Nachkriegszeit auseinandersetzt, aber auch die Stellung des Dichters "in dürftiger Zeit" reflektiert. Sprachbetrachtung spielt dabei eine bedeutende - wenn auch sekundäre - Rolle. (Anm. 2)
2 Ausgangspunkt der Dichtung
Die Erfahrung der Negativität der Welt als sprachutopischer Impuls (Anm. 3) "Daß Dichten außerhalb der geschichtlichen Situation stattfindet, wird wohl heute niemand mehr glauben - daß es auch nur einen Dichter gibt, dessen Ausgangsposition nicht von den Zeitgegebenheiten bestimmt wird. Gelingen kann ihm, im glücklichsten Fall, zweierlei: zu repräsentieren, seine Zeit zu repräsentieren und etwas zu repräsentieren, für das die Zeit noch nicht gekommen ist" (BW 4, S. 196).
Diese Aussage Ingeborg Bachmanns, die den Frankfurter Vorlesungen entstammt, erhellt wie keine andere die Dichtungskonzeption der Autorin: Der Ausgangspunkt ihrer Dichtung ist die gesellschaftliche Wirklichkeit, doch erschöpft sich jene nicht in deren Reflexion, sondern weist über sie hinaus, auf "etwas (...), für das die Zeit noch nicht gekommen ist", dessen Wesen daher auch noch niemand kennt. Die Dichtung I. Bachmanns hat daher notwendigerweise einen utopischen, d. h. sprachutopischen Charakter.
"Die Literatur (...)", so die Dichterin, "die sich nur zu erkennen gibt als ein tausendfacher (...) Verstoß gegen die schlechte Sprache - denn das Leben hat nur eine schlechte Sprache - und die ihm darum ein Utopia der Sprache gegenübersetzt ,diese Literatur also, wie eng sie sich auch an die Zeit und ihre schlechte Sprache halten mag, ist zu rühmen wegen ihres verzweiflungsvollen Unterwegsseins zu dieser Sprache und nur darum ein Ruhm und eine Hoffnung der Menschen" (BW 4, S. 286). Aufgabe der Literatur, insbesondere der Lyrik, ist es also, ausgehend von der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit ihrer "schlechten Sprache" auf ein "Utopia der Sprache" hinzuarbeiten, dessen Verwirklichung die Schaffung einer neuen, besseren Welt bedingt. Dieser Anspruch der Poetikdozentin Bachmann bleibt keineswegs graue Theorie, die Dichterin Bachmann setzt ihn vielmehr konsequent in die Praxis um. Davon zeugt innerhalb der "Gestundeten Zeit" vor allem das Gedicht "Früher Mittag".
3 Die Bewältigung der Vergangenheit mittels der dichterischen Sprache
3.1. Ingeborg Bachmann, Früher Mittag
Früher Mittag
1 Still grünt die Linde im eröffneten Sommer,
2 weit aus den Städten gerückt, flirrt
3 der mattglänzende Tagmond. Schon ist Mittag,
4 schon regt sich im Brunnen der Strahl,
5 schon hebt sich unter den Scherben
6 des Märchenvogels geschundener Flügel,
7 und die vom Steinwurf entstellte Hand
8 sinkt ins erwachende Korn.
9 Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt,
10 sucht sein enthaupteter Engel ein Grab für den Haß
11 und reicht die Schlüssel des Herzens.
12 Eine Hand voll Schmerz verliert sich über den Hügel.
13 Sieben Jahre später
14 fällt es dir wieder ein,
15 am Brunnen vor dem Tore,
16 blick nicht zu tief hinein,
17 die Augen gehen dir über.
18 Sieben Jahre später,
19 in einem Totenhaus,
20 trinken die Henker von gestern
21 den goldenen Becher aus.
22 Die Augen täten dir sinken.
23 Schon ist Mittag, in der Asche
24 krümmt sich das Eisen, auf den Dorn
25 ist die Fahne gehißt, und auf den Felsen
26 uralten Traums bleibt fortan
27 der Adler geschmiedet.
28 Nur die Hoffnung kauert erblindet im Licht.
29 Lös ihr die Fessel, führ sie
30 die Halde herab, leg ihr
31 die Hand auf das Aug, daß sie
32 kein Schatten versengt!
33 Wo Deutschlands Erde den Himmel schwärzt,
34 sucht die Wolke nach Worten und füllt den Krater mit Schweigen,
35 eh sie der Sommer im schütteren Regen vernimmt.
36 Das Unsägliche geht, leise gesagt, übers Land:
37 schon ist Mittag.
(BW 1, S. 44f)
3. 2. Zeitstruktur des Gedichts
"Früher Mittag", eines der bekanntesten Gedichte der "Gestundeten Zeit", bezieht sich zweifelsohne auf die nazifaschistische Vergangenheit Deutschlands und deren Auswirkungen auf die Gegenwart (der Jahre 1952/53).
Doch wird im Verlauf des Textes deutlich, daß diese "Zeitgegebenheiten" nur die "Ausgangsposition" darstellt und das Gedicht auf etwas "hinausläuft" (dies ist - wie die Analyse zeigen wird - wörtlich zu nehmen), "für das die Zeit noch nicht gekommen ist", etwas, das in der Zukunft liegt. Die Zeit, d. h. die Trias Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft (im Sinne des utopischen Anspruchs), gliedert also das Gedicht "Früher Mittag".
Aus diesem Grund ist wohl auch eine ausführliche Behandlung der Zeit als dem inhaltlichen Strukturprinzip eher als Interpretationsansatz geeignet als eine eingehende Analyse des Gedichtes hinsichtlich seiner formalen Strukturelemente.
Bereits der Titel des Werkes "Früher Mittag" ist eine Zeitangabe: "Mittag" bezeichnet hier allerdings nicht so sehr eine Tageszeit als vielmehr den Höhe- und Wendepunkt einer zeitlichen Entwicklung. . Es handelt sich überdies um einen "frühen Mittag", einen "Mittag" also, dem man früher zu begegnen hat als erwartet. Dieses Motiv findet sich im Gedicht selbst an drei Stellen, formuliert in dem Satz: "schon ist Mittag" (Z. 3, Z. 33, Z. 37).
Untersucht man den jeweiligen Kontext, in dem diese Formel erscheint, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß sich ihre Bedeutung sowie ihr Ton im Verlauf des Gedichtes beinahe grundlegend ändern. Zudem wird man feststellen, daß dieser Bedeutungswandel eng verknüpft ist mit dem Wechsel der Zeitebenen, aufgrund deren man den Text in drei Teile untergliedern kann:
3. 2. 1 Zeitwende: Auf- und Umbruch
Im ersten Abschnitt, der die Zeilen 1 - 12 umfaßt, ist die Rede von einer Zeit des Auf- und Umbruchs, der eine grauenvolle Periode der Zerstörung vorangegangen ist. I. Bachmann setzt sich in diesen Versen mit der Entwicklung Deutschlands unmittelbar nach seinem Zusammenbruch 1945 auseinander. Sie tut dies, indem sie die Zeilen 1 -8 den Vorgängen in der Natur symbolhafte Bedeutung zuweist.
Der eröffnete Sommer (Z. 1), der sich im Brunnen regende Strahl (Z. 4), das erwachende Korn (Z. 8) - diese Bilder stehen für einen Neubeginn, der von einer stillen Hoffnung begleitet ist (Z. 1: "Still grünt die Linde ..."). Denn schon ist Mittag (Z. 3), schon steht eine langersehnte Zeitwende ins Haus, schon scheint sich das Blatt zum Guten zu wenden:
Unter den Scherben der Vergangenheit hebt sich der - wenn auch geschundene - Flügel des Märchenvogels, während "die vom Steinwurf entstellte Hand " ins erwachende Korn sinkt (Z. 5 - 8). Der Vers "die vom Steinwurf entstellte Hand" erinnert an das Bibelwort "Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein!", was den Schluß zuläßt, daß die Dichterin hier die Einstellung der Nachkriegsgesellschaft zur jüngsten deutschen Vergangenheit reflektiert:
Die positive Entwicklung der Gegenwart führt zur Verdrängung der für alle kompromittierenden Vergangenheit. Gegenseitige Schuldzuweisungen werden eingestellt, da jeder Täter und Opfer zugleich war (Anm. 4), die wahren Schuldigen an den Greueltaten des Dritten Reiches werden so aber entweder gar nicht oder nur unzureichend zur Verantwortung gezogen.
Die Zeitwende, der hoffnungsvolle Neubeginn, hat also eine Kehrseite, die darin besteht, daß die Schrecken der Vergangenheit gerade deshalb in der Gegenwart weiterwirken - dort sozusagen im Verborgenen blühen -, weil man es scheut, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, und daher bestrebt ist, die Erinnerung an sie aus der Jetzt - Zeit zu verbannen.
So sucht denn der "enthauptete Engel" (Z.10) - ein Opfer des Hasses, der Deutschland in das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg geführt hat - ein Grab für den Haß, mit dem es fertigzuwerden gilt, um eine erneute Katastrophe zu vermeiden. Jedoch, findet er es? Wohl kaum, doch "er reicht dir die Schüssel des Herzens" (Z. 11). Obgleich also der Haß fortbesteht, ist er willens, Frieden zu schließen, zu vergeben und zu verzeihen. Aber hat dieser "Friede" Zukunft? Ist er, da der Haß nicht zu besiegen ist, nicht lediglich ein Scheinfrieden und als solcher eine Selbsttäuschung?
Was bleibt, ist eine "Hand voll Schmerz" (Z. 12), Schmerz wohl ob der unbewältigten Vergangenheit. Doch er "verliert sich über den Hügel" (Z. 12), notwendigerweise, erschütterte er doch sonst den Neubeginn in seinen Grundfesten.
Allerdings: "Sieben Jahre später / fällt es dir wieder ein" (Z. 13f).
Sieben Jahre, nachdem man voller Hoffnung in eine vermeintlich bessere Zukunft aufgebrochen ist und aus Angst, diese zu gefährden, die Vergangenheit vergessen hat, muß man erkennen, daß die Gegenwart - die einem 1945 noch als die "bessere Zukunft" erschienen ist - nur die Reinkarnation der Vergangenheit ist.
3. 2. 2 Gegenwart: Deutschlands Traum von der Macht
Diese Gegenwart - das Jahr 1952 - ist in den Zeilen 13 - 27 thematisiert, die in drei fünfzeilige Strophen unterteilt sind. Sie stellen den Mittelpunkt des Gedichtes dar.
"In der Leichtigkeit des volksliedhaften Tons ist im ersten Fünfzeiler die ironisch gemeinte Warnung ausgesprochen, nicht zu tief in den Brunnen zu schauen, sich auf sein intensives und damit konsequenzenreiches Erinnern einzulassen" (Stuttgart 1978, S. 47).
Unfaßbares könnte man im Brunnen der Vergangenheit (Anm. 5), erblicken; der Schmerz, der sich einst über den Hügel verlor, würde sich wieder einstellen und einem die Augenöffnen, einen sehend machen für die ungeheuerlichen Vorgänge in der Gegenwart.
Denn die "Henker von gestern" (Z.20) sitzen in "einem Totenhaus" (Z. 19), das sie selbst geschaffen haben, zu Tisch und amüsieren sich: Sie trinken den "goldenen Becher" aus (Z. 21), seit Goethes "König in Thule" das Symbol des Erinnerns und der unverbrüchlichen Treue. In Goethes Gedicht besteht die Treue ja gerade im Erinnern.
Anders bei Ingeborg Bachmann: Sie verfremdet diese altbekannte Motiv der deutschen Lyrik, indem sie es einerseits zum Sinnbild des nur flüchtigen Gedankens an die Vergangenheit und des vorsätzlichen Vergessens ihrer Schrecken macht (nach: Stuttgart 1978, S. 47), ihm andererseits aber seinen Symbolgehalt als Sinnbild der Treue beläßt. Bei dieser "Treue" handelt es sich jedoch um das Fest- halten an althergebrachten Werten und Normen, was aber nur möglich ist, solange man vergißt, daß sie Deutschland zum "Totenhaus" haben werden lassen.
Nutznießer einer derartigen Einstellung zur Vergangenheit sind die ehemaligen Lakaien des Hitlerregimes, die "Henker von gestern", die im Zuge der Restauration der alten Ordnung zu den Potentaten von heute avanciert sind und sich nun im Glanz ihrer Macht und ihres Reichtums sonnen. Aber Menschen, die gestern innerhalb eines Werte- und Normensystems, das heute wieder Gültigkeit hat, Henker waren und heute die Macht in den Händen halten, sind die potentiellen Mörder von morgen. Die Augen dessen, der dies erkennen möchte, "täten sinken" (Z. 22).
Doch zugleich wäre er imstande zu sehen, daß erfahrenes Leid sich in ein erneutes Nationalbewußtsein verwandelt hat (nach: Stuttgart 1983/2, S. 64), das durch das Fortbestehen traditioneller martialischer Symbole genährt wird: "...in der Asche / krümmt sich das Eisen" (was U. M. Oelmann als Indiz der Wiederbewaffnung deutet; Stuttgart 1983/2, S. 64), "auf dem Dorn ist die Fahne gehißt "(Z. 23ff). Und "auf dem Felsen / uralten Traums bleibt fortan / der Adler geschmiedet" (Z. 25ff).
Deutschland träumt also immer noch seinen uralten, verhängnisvollen Traum von der Macht.
Wieder beginnt eine neue Zeit anzubrechen, denn "schon ist Mittag" (Z. 23). Deutschland ist wiedererstarkt und schickt sich an, seine verlorene Machtposition zurückzuerobern. Von Deutschland geht also erneut eine große Bedrohung für den Frieden in der Welt aus.
3. 2. 3 Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
Nur die Hoffnung kauert erblindet im Licht" (Z.28). Diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft gründet sich jedoch nicht wie die Hoffnung im ersten Teil des Gedichts auf das Vergessen und Verdrängen der Vergangenheit, sondern erwächst aus dem "Sehen" der Vergangenheit und dem sich daraus ergebenden Erkennen der Gefahr, die von der gegenwärtigen politischen Konstellation ausgeht. Daher ist sie auch nicht so makellos wie jene, sondern "erblindet" und ohne Selbstbewußtsein, gewissermaßen geduckt: Sie "kauert erblindet im Licht" (Z. 28). Es gilt, sich ihrer anzunehmen, ihr die Freiheit zu schenken, sie zu hegen und zu pflegen (Z. 29 - 32).
Das Wesen dieser Hoffnung ist in den darauffolgenden Versen näher bestimmt: Es handelt sich um die Hoffnung, die Vergangenheit mit Hilfe der ( dichterischen ) Sprache zu bewältigen, denn "Wo Deutschlands Erde den Himmel schwärzt, / sucht die Wolke nach Worten und füllt den Krater mit Schweigen, / eh sie der Sommer im schütteren Regen vernimmt" (Z.33 -35).
"Die dunklen Schatten der Vergangenheit machen die Suche nach Worten notwendig. Die Wolke - bei I. Bachmann ein häufig verwendetes Symbol für das dichterische Wort - ist regenarm. (Anm. 6) Sie füllt den Krater mit Schweigen, ehe sie im Sommer die ersten Worttropfen aus sich entläßt" (Stuttgart 1978, S. 48).
Die geschichtliche Katastrophe Deutschlands hat einen "Sturz ins Schweigen verursacht, weil die Vergangenheit mit der alten, "schlechten Sprache" nicht überwunden werden kann, da diese doch noch immer mit Worten durchsetzt ist (und Worte "transportieren" Bewußtseinsinhalte), die in diesen Schreckensjahren geprägt worden sind.
So "sucht die Wolke nach Worten", ehe sie im Sommer - es ist nicht derselbe Sommer, von dem im ersten Teil von "Früher Mittag" die Rede ist, es ist ein anderer, ein neuer - mit einer neuen Sprache zu hören ist, die leise das "Unsägliche" sagt: "schon ist Mittag" (Z. 37).
"Man wird es als eine warnende und zugleich hoffnungsvolle Botschaft verstehen müssen, als Hinweis darauf, daß der Kairos zur Bewältigung der Vergangenheit seinen Zenith erreicht hat" (Stuttgart 1978, S. 48f).
Demnach führt "Früher Mittag" in eine offene Zukunft; damit diese Zukunft nicht erneut zu einer Wiedergeburt der Vergangenheit führt, ist es an dem Dichter, "neue" Worte zu finden, die das "Unsägliche" auszudrücken vermögen. Denn nur wenn er in der Lage ist, die Grenzen, die ihm in der gegenwärtigen Sprache gesetzt sind, zu überschreiten, schafft er die Grundlagen für eine bessere Zukunft, die frei ist von Haß und Schmerz.
Die unbewältigte Vergangenheit (Zeilen 1 - 12) führt also in eine Zukunft (Z. 13 -27), die Gegenwart des Jahres 1952, in der sich die Schrecken der vergangenen Jahre wiederholen könnten, es sei denn, man bewältigte die Vergangenheit mit Hilfe einer neuen Sprache (Z. 28 - 37). Dann allerdings wäre eine glückliche Zukunft gesichert.
3. 3 Stiluntersuchungen
3. 3. 1 Korrespondierende und kontrastive Bezüge des Gedichts
Daraus geht hervor, daß insbesondere zwischen dem ersten und dem dritten Teil des Gedichtes inhaltlich wie formal korrespondierende und kontrastive Bezüge bestehen müssen.
Es korrespondieren die beiden Dreizeiler (Z. 9 - 11 und Z. 33 - 35), jedoch sprechen die Zeilen 9 11 von dem vergeblichen Versuch, die Vergangenheit durch Vergessen zu überwinden, während die Zeilen 33 - 35 die einzige Möglichkeit thematisieren, die Vergangenheit zu bewältigen: durch die Suche nach einer neuen Sprache.
Weiter läßt sich feststellen, daß Teil I des Gedichtes, dessen Gegenstand die unbewältigte Vergangenheit ist, sich mit Zeile 12 in den Mittelteil des Textes (Z. 13 -27), die Gegenwart, "verliert".
Zeile 28, der Auftakt von Teil III, führt dagegen aus ihm heraus und auf eine offene Zukunft hin, auf "etwas, für das die Zeit noch nicht gekommen ist", auf das "Utopia der Sprache", dem die Literatur durch "Verstöße gegen die schlechte Sprache" näherzukommen sucht.
3. 3. 2 Sprachbetrachtung
Ingeborg Bachmann bemüht sich in "Früher Mittag" zudem, mit Hilfe der Deformation und Verfremdung der "schlechten Sprache" - und somit der verhängnisvollen Bewußtseinsinhalte - auf das Utopia der Sprache hinzuarbeiten, das die Überwindung der negativen Gegenwart, in der die Vergangenheit latent fortwirkt, bedingte.
Dafür seien nur einige wenige Beispiele angeführt, die aber die Intention der Dichterin klar zum Ausdruck bringen:
Die beiden ersten Strophe von Teil III des Gedichtes haben den Klang des Volksliedes. Zitate aus Müllers "Am Brunnen vor dem Tore" (Z. 15) und Goethes "König in Thule" (s. o.) sind unschwer auszumachen. Bezeichnenderweise finden sich in diesen beiden Strophen auch die einzigen gereimten Verse des Gedichtes (Z. 14 / 16 und Z. 19 / 21).
Die Dichterin montiert diese Zitate aus altbekannten Volkslieder an Bilder des Schreckens, die der Gegenwart entstammen. Sie verbindet also zwei völlig verschiedene Bereiche und verfremdet somit das bisher Vertraute wechselseitig. Die Bewußtseinsinhalte, die an das alte deutsche Liedgut geknüpft sind, werden damit in Frage gestellt oder sogar zunichte gemacht.
Somit ist es auch nicht verwunderlich, daß der volksliedhafte Ton der Zeilen 13 - 16 und 18 - 21 jeweils durch die Schlußzeilen (Z. 17 bzw. Z. 22) aufgefangen, ja gewissermaßen jäh zerstört wird.
4. Abschließende Bemerkung
Ingeborg Bachmann - dies läßt sich abschließend feststellen - schreibt im Gedicht "Früher Mittag" nicht nur über die Bewältigung der negativen Gegenwart durch eine neue, bessere Sprache. Sie versucht dies auch formal durch Deformation und Verfremdung der alten Sprache und ihrer Bewußtseinsinhalte zu verwirklichen.
Form und Inhalt des Gedichtes entsprechen sich in einer Weise, wie sie es in nicht vielen anderen Gedichten tun, sie machen einfache Worte zum Kunstwerk.
Anhang
Anmerkungen
Anm 1
Die Rede ist von der sogenannten (konservativen) Restaurationsphase der noch jungen Bundesrepublik Deutschland, einer Periode der deutschen Nachkriegsgeschichte, die gekennzeichnet ist von der innenpolitischen und wirtschaftlichen Konsolidierung sowie der außerpolitischen Normalisierung. Damit eng verbunden ist der Name Konrad Adenauer, der am 15. September zum ersten deutschen Bundeskanzler gewählt wurde.
Anm. 2
Für den Gedichtband "Die gestundete Zeit" wurde I. Bachmann mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet. Ziel dieser losen Autorenvereinigung war die demokratische Elitebildung auf dem Gebiet der Literatur und Publizistik sowie die praktische Anwendung der Methode der Demokratie. Der demokratische Grundgedanke gab vor allem den Tagungen der Gruppe 47, bei denen Kritik, Unruhe und Auseinandersetzung wichtige Tagesordnungspunkte waren, ein unverwechselbares Gesicht. Einen bedeutenden Teil - bedeutend, weil publikumswirksam - machte die Verleihung des "Preises der Gruppe 47" aus, mit dem neben der oben genannten I. Bachmann auch u. a. H. Böll, I. Aichinger oder G. Eich ausgezeichnet wurden, also Dichterpersönlichkeiten, die die deutsche Nachkriegsliteratur nachhaltig beeinflußt und der Dichterkonzeption der Gruppe 47 stets Rechnung getragen haben. Die Gruppe 47 sah den Dichter als einen Wächter, der in Opposition zu den herrschenden Verhältnissen steht, ohne jedoch ideologisch voreingenommen zu sein.
"Die linken Intellektuellen und Schriftsteller", so der Naturwissenschaftler Ralf Schnell, "zogen sich (...) aus der Politik zurück in die Literatur, weil sie ihre Ohnmacht erfahren hatten. Zugleich aber bildete dieser Rückzug einen Gewinn: Er ging einher mit einer Konzentration auf die eigenständige ästhetische Kraft der Poesie, die von nun an ihrerseits zum steten Ärgernis und Spannungsfeld von Geist und Macht, Kunst und Politik werden sollte. Denn wie politisch - soziale Faktoren zu ihrer (gemeint ist die Gruppe 47) Entstehung beigetragen hatten, so blieben auch in der Folgezeit historische Entwicklungen von nationaler wie internationaler Bedeutung stets Anlässe für Gruppenmitglieder, sich engagiert und kritischöffentlich zu Wort zu melden." (Stuttgart 1986, S. 111)
Durch eine solche Haltung erregte die Gruppe 47 bezeichnenderweise das Mißtauen einiger Zeitgenossen: Man warf ihr u. a. vor, Meinungsterror" zu betreiben, und eine geheime "Reichsschrifttumskammer" zu sein.
Im Nachbarland Frankreich dagegen war ein politisch und sozial engagierter Dichter eine Selbstverständlichkeit. Nicht zuletzt war dort während des Zweiten Weltkriegs eine ebenso literarisch - weltanschauliche wie philosophisch Bewegung entstanden, der Existentialismus, deren Hauptvertreter die Dichter Jean - Paul Sartre und Albert Camus waren.
Nach A. Camus ist das Leben absurd, ohne Sinn. Der Mensch kann allerdings seiner Existenz durch soziales Handeln, das ihn zum "Heiligen ohne Gott" macht, einen gewissen Sinn geben, der jedoch stets fingiert ist.
Auch in J.-P. Sartres "ästhetischem Humanismus" gibt es keinen Sinn des Seins. Sartres Lehren zufolge erfährt sich der Mensch in der Angst auf das Nichts gestellt und daher zur Freiheit verurteilt, die als irrationaler Seinsgrund erscheint, da nie gefragt wird, wie Freiheit möglich ist und wozu der Mensch überhaupt frei sein soll. Diese völlige Sinnleere des Daseins kann aber - ähnlich wie bei A. Camus - durch die dynamische Hinwendung des Individuums zur Welt im sozialen Handeln zum Ursprung einer neuen, jedoch fingierten Sinnerfüllung der menschlichen Existenz werden.
Anm. 3
Diese Formulierung entstammt der Arbeit von Theo Mechtenberg: Utopie als ästhetische Kategorie, Stuttgart 1978, S. 1
Anm. 4
Hierzu Christa Bürger (in: München 1984, S. 10): "Die grammatische Struktur des Satzes und die vom Steinwurf entstellte Hand / sinkt ins erwachende Korn läßt nicht erkennen, ob der Satz aktiv oder passiv gelesen werden soll. Ist die Hand entstellt durch die Gewalt, die ihr angetan worden ist, oder durch die Gewalt, die sie zufügen will, ist sie die Hand eines Opfers oder eines Henkers?"
Ich bin der Meinung, daß der besagte Satz sowohl aktiv als auch passiv gelesen werden muß, daß es sich zugleich um die Hand eines Opfers und eines Täters handelt. Dieser Satz ist wohl gerade durch seine Mehrdeutigkeit mehr als eindeutig zu verstehen. Auf diese Deutung des Satzes stütze ich mich auch bei der Interpretation von "Früher Mittag".
Anm. 5
Auf die Bedeutung des Brunnens als Symbol für die Vergangenheit weist Ute Maria Oelmann auf Seite 64 ihrer Arbeit hin (Stuttgart 1983/2).
Anm. 6
"Das in der Lyrik I. Bachmanns häufig begegnende Bildwort "Wolke" als Symbol des dichterischen Wortes ist aus der jüdisch - christlichen Symbolsprache übernommen. Im Alten und Neuen Testament steht die Wolke für die sich im Wort offenbarende Gegenwart Gottes. Auch sonst zeigt die Lyrik I. Bachmanns Entlehnungen religiöser Symbole. Vergleiche in diesem Zusammenhang beispielsweise den Zyklus "Lieder von einer Insel" aus der "Anrufung der Großen Bären" " (Stuttgart 1978, S. 124)
Literaturverzeichnis
Literatur zum zeitgeschichtlichen Hintergrund
Ruhl, K.-J.
"Mein Gott, was soll aus Deutschland werden?" Die Adenauer - Aera 1949 - 1963; München 1985
Literatur zum Werk Ingeborg Bachmanns
Arnold, H (Hg.)
Ingeborg Bachmann. Sonderband der Reihe TEXT + KRITIK; München 1984
Bachmann, I.
Werke. Hg. von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum und Clemens Münster. Vier Bände; München / Zürich 1983 ( Zitiert als: BW 1 - 4)
Mechtenberg, T.
Utopie als ästhetische Kategorie. Eine Untersuchung zur Lyrik Ingeborg Bachmanns; Stuttgart 1978
Oelmann, U. M.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ausgangspunkt der Dichtung von Ingeborg Bachmann, wie im Text beschrieben?
Der Ausgangspunkt ihrer Dichtung ist die gesellschaftliche Wirklichkeit, die jedoch über deren Reflexion hinausweist und auf etwas deutet, "für das die Zeit noch nicht gekommen ist." Daher hat ihre Dichtung einen utopischen, sprachutopischen Charakter.
Was ist die Aufgabe der Literatur, insbesondere der Lyrik, laut Ingeborg Bachmann?
Ausgehend von der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit ihrer "schlechten Sprache" soll sie auf ein "Utopia der Sprache" hinarbeiten, dessen Verwirklichung die Schaffung einer neuen, besseren Welt bedingt.
Welche Bedeutung hat das Gedicht "Früher Mittag" im Kontext von Bachmanns Werk?
"Früher Mittag" bezieht sich auf die nazifaschistische Vergangenheit Deutschlands und deren Auswirkungen auf die Gegenwart (der Jahre 1952/53). Es läuft jedoch auf eine Zukunft hinaus, "für die die Zeit noch nicht gekommen ist".
Wie ist die Zeitstruktur des Gedichts "Früher Mittag" aufgebaut?
Das Gedicht gliedert sich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wobei die Zukunft im Sinne eines utopischen Anspruchs gesehen wird. Der Titel "Früher Mittag" bezeichnet den Höhe- und Wendepunkt einer zeitlichen Entwicklung.
Welche Rolle spielt die "Zeitwende" im Gedicht "Früher Mittag"?
Der erste Abschnitt (Zeilen 1-12) beschreibt eine Zeit des Auf- und Umbruchs nach einer grauenhaften Periode der Zerstörung, symbolisiert durch Vorgänge in der Natur. Dieser Neubeginn wird von Hoffnung begleitet, hat aber eine Kehrseite: die Verdrängung der Vergangenheit.
Wie wird die Gegenwart (1952) im Gedicht "Früher Mittag" dargestellt?
Die Gegenwart (Zeilen 13-27) zeigt, dass die vermeintlich bessere Zukunft nur die Reinkarnation der Vergangenheit ist. "Henker von gestern" sind an die Macht gekommen, und Deutschland träumt immer noch seinen "uralten, verhängnisvollen Traum von der Macht."
Welche Hoffnung besteht im Gedicht "Früher Mittag" auf eine bessere Zukunft?
Die Hoffnung (Zeilen 28-37) gründet sich nicht auf Vergessen, sondern auf das "Sehen" der Vergangenheit und das Erkennen der Gefahr, die von der gegenwärtigen Situation ausgeht. Diese Hoffnung besteht darin, die Vergangenheit mit Hilfe der Sprache zu bewältigen und "neue" Worte zu finden, um das "Unsägliche" auszudrücken.
Wie versucht Ingeborg Bachmann die "schlechte Sprache" in "Früher Mittag" zu überwinden?
Sie bemüht sich, durch Deformation und Verfremdung der "schlechten Sprache" auf das Utopia der Sprache hinzuarbeiten, das die Überwindung der negativen Gegenwart bedingt. Dies geschieht u.a. durch die Montage von Zitaten aus Volksliedern mit Bildern des Schreckens.
Was ist die abschließende Bemerkung über Ingeborg Bachmanns Gedicht "Früher Mittag"?
In "Früher Mittag" schreibt Ingeborg Bachmann nicht nur über die Bewältigung der negativen Gegenwart durch eine neue, bessere Sprache, sondern versucht dies auch formal durch Deformation und Verfremdung der alten Sprache und ihrer Bewusstseinsinhalte zu verwirklichen. Form und Inhalt des Gedichtes entsprechen sich in besonderer Weise und machen einfache Worte zum Kunstwerk.
- Quote paper
- Martin Obermüller (Author), 2000, Ingeborg Bachmann - Früher Mittag - Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99728