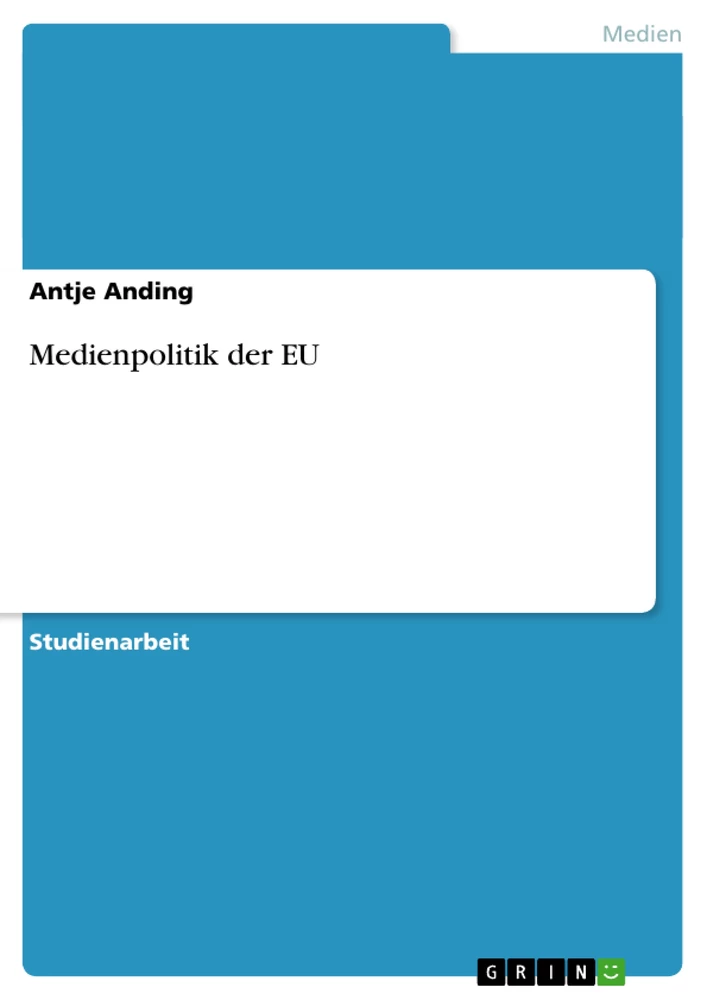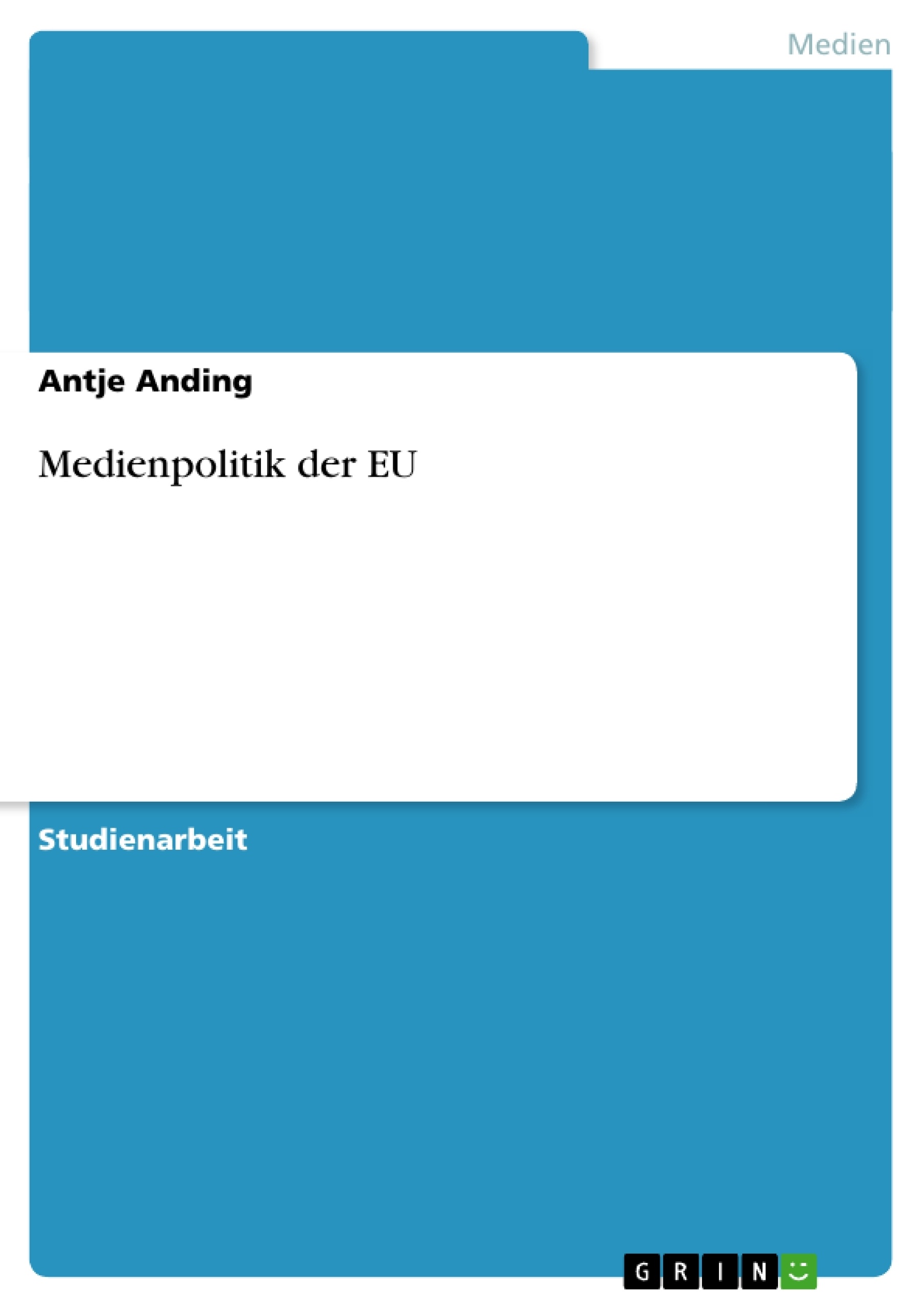INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. ENTSTEHUNG EINER EUROPÄISCHEN MEDIENPOLITIK
3. AKTEURE DER EU-MEDIENPOLITIK
4. FERNSEHRICHTLINIE
4.1 SENDESTAATSPRINZIP UND FREIER EMPFANG
4.2 QUOTENREGELUNG
4.3 WERBUNG
4.4 JUGENDSCHUTZ
4.5 GEGENDARSTELLUNG
5. GRUNDSÄTZLICHE KRITIK AN DER FERNSEHRICHTLINIE
6. WEITERE AKTIONSGEBIETE DER EU-MEDIENPOLITIK
6.1 URHEBERRECHT
6.2 MEDIENKONZENTRATION
6.3 FÖRDERUNG NEUER TECHNIKEN
6.4 MEDIA-PROGRAMM
7. SCHLUßBETRACHTUNG
LITERATURVERZEICHNIS
1. Einleitung
Im Rahmen der sich immer weiteröffnenden Grenzen in Europa ist es notwendig eine effektive Medienpolitik mit großer Tragweite, auch im Hinblick auf die Angleichung der vielen verschiedenen nationalen Medienvorschriften, zu entwickeln.
Die EU-Medienpolitik beinhaltet ”die politisch gewollten und gesetzten Rahmenbedingungen der Medien”1 in der EU.2 Meine Ausführungen beschränken sich, aufgrund der geringen Bedeutung des Hörfunks und der Presse in der EU, größtenteils auf die Tätigkeiten im audiovisuellen Bereich, insbesondere auf das grenzüberschreitende Fernsehen. Dies liegt unter anderem daran, daß erst im 1996 verfaßten Grünbuch von einer allgemeinen Kommunikationspolitik die Rede ist.
Mittelpunkt der europäischen Medienpolitik ist die Fernsehrichtlinie. Richtlinien sind für alle Mitgliedsstaaten nur hinsichtlich des vorgegebenen Ziels verbindlich. Form und Mittel für die Zielerreichung sind jedem EU-Staat freigestellt.
2. Entstehung einer europäischen Medienpolitik
Zu Beginn der achtziger Jahre eröffnete sich in Westeuropa die Möglichkeit zum gezielt grenzüberschreitend übertragbaren Fernsehen, bedingt durch neue Kabel- und Satellitentechniken. Dadurch war die Frequenzknappheit, die private Rundfunkveranstalter in Europa nicht zuließ, nicht mehr gegeben. Nach der Auflösung desöffentlich-rechtlichen Sendemonopols in den EU-Staaten drängten die privat-kommerziellen Veranstalter auf den gesamteuropäischen Markt. Aufgrund der verschiedenen nationalen Vorschriften ist eine Angleichung dieser Bestimmungen zur Gewährleistung des freien Binnenmarktes erforderlich.3
Der Europäische Gerichtshof bezeichnete 1974 den Rundfunk als Dienstleistung und unterstellte ihn somit dem freien Dienstleistungsverkehr im europäischen Binnenmarkt. Auf dieser Grundlage fühlte sich die EU, die laut EWG-Vertrag, eine Wirtschaftsgemeinschaft darstellt, für den Bereich Medienpolitik zuständig. Die erste Initiative ging vom Kulturausschuß des Europäischen Parlaments aus. Der CDU-Abgeordnete Wilhelm Hahn forderte 18.09.1980 in einem Entschließungsantrag eine gemeinschaftliche europäische Fernsehanstalt. 1982 plädierte er nicht mehr auf eine europäische Sendeanstalt, sondern wollte ein europäisches Gemeinschaftsprogramm, welches von den bestehenden europäischen Fernsehanstalten umgesetzt werden sollte. Dieser Ansatz zu einer europaweiten Regulierung der Fernsehtätigkeit wurde im gleichen Jahr vom Europäischen Parlament in den verabschiedeten Entschließungsvertrag aufgenommen. Nach dem Versuchsprogramm ”Eurikon” und einem 1986 gescheiterten ”Europa TV” trat die Idee eines kulturellen und integrativen Fernsehprogramms in den Hintergrund.
Im Juni 1984 legte die EU-Kommission ein ”Grünbuch über die Errichtung des gemeinsamen Marktes für den Rundfunk, insbesondere über Satellit und Kabel” unter dem Titel ”Fernsehen ohne Grenzen”4 vor, das stark wirtschaftlich geprägt war. Das Hauptanliegen war die Errichtung eines gemeinsamen Marktes für Fernsehsender und Zuschauer. Auf der/Grundlage des Grünbuchs erarbeitete die Kommission einen am 30.04.1986 veröffentlichten Vorschlag zu einer Richtlinie, die noch Bestimmungen zum Hörfunk und zum Urheberrecht enthielt.
Zeitgleich mit der Kommission erarbeitete der Europarat, dessen Anliegen die Einheit und Zusammenarbeit in Europa ist, das ”Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen”. Das Hauptziel dieser Konvention ist die ”Freiheit des Informationsflusses zwischen den Staaten des Europarats”.5
Im Dezember 1988 kreuzten sich die Wege von Europarat und der EU. Die EU-Kommission verpflichtete sich die Europaratskonvention in ihrem Richtlinienvorschlag zu berücksichtigen. Nach Verhandlungen zwischen den Vertretern der Mitgliedsstaaten im Ministerrat wurde vereinbart, die Hörfunktätigkeit und die Bestimmungen zu den Urheberrechten zu streichen und weitere Regelungen aus dem Richtlinienvorschlag deutlich zu entschärfen.6 Am 03.10.1989 wurde dann die ”Richtlinie des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten durch die Ausübung der Fernsehtätigkeit”7 vom Ministerrat der EU verabschiedet, die 1997 novelliert wurde.
1991 wurde im Maastrichter Vertrag erstmals eine Handlungsermächtigung der EU für den audiovisuellen Bereich festgelegt, die sich bis dahin nur von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ableiten ließ. Die Ziele der Wirtschaftsgemeinschaft wurden um den Bereich Kultur (Art. 128) ergänzt, in dem die audiovisuellen Medien ausdrücklich erwähnt werden.8
Nachdem die Europäische Union Anfang der 90er Jahre den Wandel zur Informationsgesellschaft ausgerufen hat, entwickelte die EU-Kommission einen ausführlichen Aktionsplan zu diesem Thema, der 1996 in dem Grünbuch ”Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft” zusammengefaßt wurde. Somit wurden die nur auf Fernsehen bezogenen Anstrengungen der EU um eine allgemeine, Rundfunk und Telekommunikation umfassende Kommunikationspolitik erweitert.9
2. Akteure der EU-Medienpolitik
In der EU wirken viele verschiedene medienpolitische Akteure zusammen. Das Europäische Parlament, das eine europäische Medienpolitik ins Leben rief, blieb in den entscheidenden Jahren untätig. Jetzt ist es wieder stärker beteiligt. Dagegen ist die EU-Kommission von hoher Bedeutung, die aber nur wirtschaftliche Belange fördert. Der Bereich Medienangelegenheiten ist innerhalb der Kommission in unterschiedlichen Generaldirektionen angesiedelt (vgl. folgende Abbildung). Dadurch entstehen vermehrt innerorganisatorische Konflikte zwischen den für verschiedene Aufgabenfelder zuständigen Kommissaren. Die Kommission verfügt jedoch über keinerlei Entscheidungsmacht.Schlüsselentscheidungen, wie zum Beispiel den Erlaß einer Richtlinie, werden von den Vertretern der Mitgliedsstaaten im Ministerrat gefällt.
Der Europäische Gerichtshof trägt mit seinen Rechtsprechungen zur Fernsehrichtlinie indirekt und sehr wirkungsvoll zur europäischen Medienpolitik bei. Diese haben erhebliche Auswirkungen auf die nationalen Medienordnungen in den Mitgliedsstaaten. Weiterhin sind der Europarat beteiligt, der eher kulturelle Interessen vertritt, sowie europäische Organisationen beispielsweise EUTELSAT und EBU.10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung: Einteilung der EU-Kommission in Bezug auf den Bereich Medienangelegenheiten
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Henle, Victor: Europäisierung der Medienordnungen und die Medienunternehmen. In: Henle, Victor (Hrsg.): Fernsehen in Europa. Strukturen, Programme und Hintergründe. München 1998, S. 13 und www.europa.eu.int./comm/commissioners/index_de.htm)
3. Fernsehrichtlinie
Das Grünbuch von 1984 ist die Voraussetzung für die am 03.10.1989 erlassene Fernsehrichtlinie, die ”ein kunstvoll gestricktes Kompromißwerk zwischen den einflußstärksten Staaten der [EU]”11 darstellt. Sie unterliegt dem zentralen Grundgedanken der föderalen Gemeinschaft, dem Subsidiaritätsprinzip, das erstmals im Maastrichter Vertrag ausdrücklich formuliert wurde. Es besagt, daß die EU in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig werden darf, wenn die Ziele und Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedsstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und die Umsetzung auf Gemeinschaftsebene besser erfolgen kann.12
Die Richtlinie wirkt nur teilharmonisierend, daß heißt den Mitgliedern steht es frei strengere Bestimmungen im Land für Fernsehveranstalter zu erlassen.
Die wichtigsten Regelungen der Fernsehrichtlinie sind das Sendestaaatsprinzip und freier Empfang, die Quotenregelung, die Werbung, der Jugendschutz und das Recht auf Gegendarstellung.
4.1 Sendestaatsprinzip und freier Empfang
Diese beiden Bestimmungen bilden eine wichtige Voraussetzung. Jeder Mitgliedsstaat ist dazu verpflichtet, den freien Empfang von richtlinien-konformen Fernsehsendungen zu gewährleisten. Er ist nicht berechtigt einem Sender beziehungsweise einem bestimmten Programm die Weiterverbreitung im Land zu verbieten. Eine derartige Aussetzung ist selbst dann unzulässig, wenn vom jeweiligen Mitgliedsstaat strengere Vorschriften für nationale Anbieter erlassen wurden und diese vom ausländischen Sender nicht eingehalten werden.
Des weiteren müssen die Mitgliedsstaaten dafür sorgen, daß alle inländischen Anbieter die Vorschriften der Fernsehrichtlinie einhalten. Da die Überwachungspflicht nur auf das eigene Land beschränkt ist, darf der Empfangsstaat aufgrund des Sendestaatsprinzips nicht mehr die Weiterverbreitung eines ausländischen Programms behindern. Hierbei gilt ebenfalls, daß für nationale Fernsehveranstalter strengere Vorschriften formuliert werden können.13
4.2 Quotenregelung
Diese Regelung enthält sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Aspekte. Die EU-Staaten sind verpflichtet ”den Hauptanteil der Sendezeit europäischen Werken [aus den Bereiche Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung] und zusätzlich mindestens 10% der Sendezeit oder der Programmittel unabhängigen Produzenten solcher Werke vorzubehalten”.14 Unter europäischen Werken versteht man nicht nur die Produktionen von EU-Mitgliedsländer, sondern auch Produktionen aus Staaten, die sich dem Europaratsabkommen gegenüber verpflichtet haben. Die Bestimmung zur Quotenregelung wurde von seiten Frankreichs initiiert, wo schon seit Jahren eine nationale Quotenpolitik praktiziert wird. Sie ist nicht rechtsverbindlich, sondern stellt lediglich eine politische Absichtserklärung dar.
Diese Quote soll jedes Land schrittweise versuchen zu erreichen, jedoch darf der Anteil an europäischen Produktionen nicht unter dem 1988, bei Griechenland und Portugal 1990, festgestellten Anteil liegen. Ab dem 03.10.1991 müssen die Mitgliedsstaaten alle zwei Jahre Rechenschaft in Form eines Berichts bei der Kommission ablegen.15
4.3 Werbung
Bei den Bestimmungen zur Fernsehwerbung wägte die EU-Kommission Marktinteressen gegenüber Verbraucherinteressen ab. Obwohl die Werbung eine Dienstleistung darstellt und deren Liberalisierung den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr fördern würde, gibt es zum Schutz der Verbraucher Beschränkungen zur Fernsehwerbung. In der Richtlinie sind quantifizierende Limits für die Werbung vorgegeben. Beispielsweise darf die Werbung ”[m]aximal Prozent der täglichen Sendezeit und maximal 20 Prozent pro Stunde”16 betragen. Dieses Limit kann bei Teleshopping auf 20 Prozent pro Sendetag angehoben werden, wobei Teleshopping nur maximal eine Stunde täglich gesendet werden darf.
Untersagt ist die Werbung für Zigaretten, Tabakerzeugnisse und verschreibungspflichtige Medikamente. Alkoholwerbung ist nur bedingt erlaubt und direkte Kaufappelle an Minderjährige sind verboten. Grundsätzlich muß die Werbung erkennbar sein und in Blöcken ausgestrahlt werden. Unterbrecherwerbung ist eingeschränkt, aber nicht verboten. Den Mitgliedsstaaten ist vorbehalten strengere Regelungen für nationale Fernsehveranstalter zu erlassen. Diese Begrenzungen der Werbezeiten sind laut Kleinsteuber sehr großzügig bemessen und er bewertet diese als symbolische Regulierungspolitik.17
4.4 Jugendschutz
Pornographische und Gewaltätigkeiten zeigende Filme [und Programme] sind [...] grundsätzlich verboten, [da sie] die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjährigen schwer beeinträchtigen können.”18 Dieses Verbot gilt nicht für Programme, die durch Wahl der Sendezeit beziehungsweise durch technische Maßnahmen (Verschlüsselung der Programme) normalerweise von Minderjährigen nicht gesehen werden können.
Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet diese Bestimmungen mit ”angemessenen Maßnahmen”19 zu gewährleisten und sie dürfen ebenfalls strengere Vorschriften im Inland festsetzen.
4.5 Gegendarstellung
Jeder in der EU ansässige Fernsehveranstalter hat ein Recht auf Gegendarstellung, wenn seine Interessen durch Behauptung falscher Tatsachen in Mitleidenschaft gezogen wurden sind. Dies gilt unabhängig von der Nationalität des Veranstalters.
Das Recht auf Gegendarstellung war im Richtlinienentwurf von 1986 noch nicht enthalten.20
4. Grundsätzliche Kritik an der Fernsehrichtlinie
Kritiker der Fernsehrichtlinie sehen keine eindeutige Handlungskompetenz der EU für den Bereich Rundfunk. Der EWG-Vertrag ermächtigt nur die Regelung wirtschaftlicher Sachverhalte. Gegner der Richtlinie, beispielsweise die deutschen Bundesländer, sehen den Rundfunk aber als eine ”originär kulturelle Veranstaltung”21, der in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fällt. Für die EU ist der Rundfunk ein Wirtschaftsgut mit kulturellen Aspekten. Dies begründet sie damit, daß ”jede unentgeltliche Tätigkeit ungeachtet ihres Inhaltes oder ihrer Bedeutung [...] eine Dienstleistung darstell[t]”.22
Die Gemeinschaft hat keine umfassende Kompetenz für den Bereich Rundfunk, sondern nur für bestimmte Teilgebiete. Der Europäische Gerichtshof betont in seiner ständigen Rechtsprechung, daß die Verbreitung von Fernsehsendungen eine Dienstleistung ist. Dennoch ist die Gemeinschaft nicht dazu berechtigt ein umfassendes Rundfunkregulierungsrecht für sich in Anspruch zu nehmen, da das bereits genannte Subsidiaritätsprinzip und die Kulturklausel (Artikel 128 des Maastrichter Vertrages) dies eindeutig unterbinden. Die Kulturklausel besagt, daß es keine eigene europäische Kulturpolitik geben wird und die EU in diesem Bereich nur unterstützend wirksam werden darf.23 Demzufolge muß eine Lösung gefunden werden, die beiden Seiten gerecht wird und die weder den wirtschaftlichen noch den kulturellen Aspekt überbetont.
Ein Kritikpunkt deröffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter ist, daß die EU-Medienpolitik, aufgrund der Betonung des Wettbewerbs, stark auf die Interessen der privat-kommerziellen Anbieter ausgerichtet ist. Die Sonderrolle deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird hierbei nicht berücksichtigt. Diese können durch den ihnen auferlegten Grundversorgungsauftrag schlecht beziehungsweise gar nicht am Wettbewerb teilnehmen. Zudem besagt der Artikel 92 des EG-Vertrages, daß ”staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen [...], die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar [...] sind”.24
5. Weitere Aktionsgebiete der EU-Medienpolitik
6.1 Urheberrecht
Die verschiedenen nationalen Bestimmungen zu den Urheberrechten können den freien Verkehr von Fernsehsendungen innerhalb der EU beeinträchtigen. Deswegen enthielt der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission von 1986 schon Bestimmungen zu den Urheberrechten enthalten, die aufgrund von heftiger Kritik seitens der Urheber in ganz Europa nicht mit in die Fernsehrichtlinie aufgenommen worden sind. Demzufolge plante die EU eine eigene Richtlinie, in der die Urheber mehr Rechte bekommen sollten. Diese ”Richtlinie des Rates zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung”25 wurde am 27.09.1993 verabschiedet.
Es basiert auf dem Urheberrechtssystem von Frankreich. Hier erhält der Autor als ”Schöpfer” des Films die ”absolute Befugnis an seinem Werk”.26 Somit können weder Produzenten noch Produktionsfirmen als Urheber fungieren. Der Autor kann seine Rechte den Verwertungsgesellschaften übertragen, so daß diese dann mit den Kabelunternehmen in Verhandlung treten können.
Kritik an der Richtlinie kamen von Großbritannien und den USA, da dort ein anderes Urheberrechtssystem die Grundlage ist. In diesen Ländern sind nur die Urheberrechte der Produzenten gesetzlich gesichert. Durch dieses ”moralische Rechtsverständnis [...] in Europa”27 fürchten die USA um Einkommensrückgänge für amerikanische Produzenten.
6.2 Medienkonzentration
Seitdem grenzüberschreitendes Fernsehen möglich ist, lösen sich die nationalen Fernsehmärkte auf und privat-kommerzielle Anbieter möchten ihr Programm vermarkten. Das Hauptanliegen dieser ist gewinnorientiertes Wirtschaften und nicht die Wahrung der Meinungsvielfalt. Um den Pluralismus weiterhin zu sichern müssen also Regelungen getroffen werden.
Auf Drängen des Europäischen Parlaments erarbeitete die EU-Kommission das Grünbuch ”Pluralismus und Medienkonzentration im Binnenmarkt”.28 Ziel ist es, den Informationspluralismus und die Meinungsvielfalt zu sichern, zum Beispiel könnte ein Zusammenschluß den Wegfall eines bestimmten Senders oder einer Zeitung bewirken und damit würde sich die Informationsvielfalt für den Bürger verringern.
Bei der Erarbeitung des Grünbuchs gelangte die Kommission zu dem Ergebnis, daß die Aufrechterhaltung des Medienpluralismus keinem Gemeinschaftsziel entspricht und damit Tatsache vertrat sie später die Position dieses Problem auf Gemeinschaftsebene lösen zu müssen. Die Generaldirektion XV startete dazu einen internen Richtlinienentwurf, der allerdings wieder zurückgezogen wurde.29
6.3 Förderung neuer Techniken
Die EU zeigte auch reges Interesse am hochauflösendem Fernsehen (HDTV) und der Ministerrat beschloß 1989 es in der EU einzuführen. Sie beteiligte sich an der Entwicklung einer einheitlichen europäischen HDTV-Norm namens HD-MAC, die sich weltweit etablieren sollte. Dieses Projekt enthielt auch die Förderung der Produktion von Fernsehgeräten im Format 16:9. 1992 verabschiedete der Ministerrat eine Richtlinie, welche die Übergangsnorm D2-MAC für alle Satellitendienste, die ab 1995 in Betrieb gehen, verbindlich vorschreibt. Diese Festlegung wurde von vielen Interessengruppen abgelehnt, insbesondere von den Fernsehanstalten und den Verbraucherverbänden, da die Einführung der MAC-Norm große finanzielle Ausgaben für neue technische Geräte mit sich bringen würde. Mittlerweile wurde in den USA eine digitale HDTV-Norm entwickelt, die technisch fortschrittlicher als die europäische Norm ist, die somit scheiterte.30
6.4 Media-Programm
Um die europäische Film- und Fernsehindustrie zu fördern, wurde im Dezember 1990 das Media-Programm verabschiedet. Hierbei handelt es sich um verschiedene Projekte zur Programmproduktion, die von der EU finanzielle Zuschüsse in Form von Krediten für bereits zur Hälfte vorfinanzierte Projekte erhalten. Die EU gewährleistet Unterstützung in Bereichen, wie zum Beispiel ”Planung, Produktion und Distribution von audiovisuellem Material [und] Entwicklung neuer Techniken”.31
6. Schlußbetrachtung
Die europäische Medienpolitik hat bis jetzt noch nicht ihr Ziel erreicht. Sie ist immer noch die Politik der einflußreichsten europäischen Mitgliedsstaaten und die Deklarationen sind lediglich die ”Addition nationaler Politiken”32. Deswegen beinhalten die bisherigen Regelungen der EU meist nur einen Kompromiß zwischen den Mitgliedsländern. Festlegungen der Fernsehrichtlinie sind sehr großzügig gestaltet, und infolge der nur teilharmonisierenden Wirkung kann jeder Mitgliedsstaat strengere Regelungen erlassen, so daß eine einheitliche europäische Medienpolitik nicht entsteht. Zudem existiert keine europäische Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung der getroffenen Bestimmungen überwacht.
Desweiteren muß die EU mehr Initiative in den Bereichen der Presse und des Hörfunks zeigen, die bisher von ihr vernachlässigt wurden.
Am Streit um die Handlungsermächtigung zwischen der EU und den maßgeblich beteiligten deutschen Bundesländern ist auch ersichtlich, daß auf dem Gebiet der Medienpolitik noch vieles unklar definiert ist.
Abschließend läßt sich feststellen, daß eine europäische Medienpolitik für das Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten sehr wichtig ist, aber die EU dieser Aufgabe noch nicht gewachsen ist.
Literaturverzeichnis
Astheimer, Sabine/ Moosmayer, Klaus: Europäische Rundfunkordnung. Chancen oder Risiko? In: Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 7/1994, S. 395-404
Borchert, Jens: Soziale Dimensionen der Medienentwicklung in Europa. Eine Analyse der Auswirkungen von Kommerzialisierung und Programmvermehrung. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990. S. 125-155
Degenhart, Christoph: Rundfunkordnung im europäischen Rahmen. In: Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 10/1992, S. 449-456
Gellner, Winand: ”Massenmedien”. In: Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Die EG-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte. Opladen 1992, S. 277-302
Glotz, Peter: Integration und Eigensinn: Kommunikationsraum Europa - eine Chimäre? In: Erbring, Lutz (Hrsg.): Kommunikationsraum Europa. Konstanz 1995, S. 17-26
Gruber, Barbara: Medienpolitik der EG. Konstanz 1995
Henle, Victor: Europäisierung der Medienordnungen und die Medienunternehmen. In: Henle, Victor (Hrsg.): Fernsehen in Europa. Strukturen, Programme und Hintergründe. München 1998, S. 9-79
Kleinsteuber, Hans J./ Thomaß, Barbara: Europäische Perspektiver der Medienpolitik. In: Jarren, Otfried (Hrsg.): Medienwandel - Gesellschaftswandel? Berlin 1994, S. 51-68
Kleinsteuber, Hans J./ Wiesner, Volkert/ Wilke, Peter: Einleitung: Medienpolitik in der Europäischen Gemeinschaft. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990, S. 1-5
Kleinsteuber, Hans J.: Europäische Medienpolitik am Beispiel der EG-Fernsehrichtlinie. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990. S. 35-53
Kleist, Thomas: Europäische Medienpolitik aus Sicht der Bundesländer. In: Erbring, Lutz (Hrsg.): Kommunikationsraum Europa. Konstanz 1995, S. 56-63
Antje Anding - Medienpolitik der EU III
Peters, Bettina. Fernsehen in Europa. Die Bedeutung für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990. S. 55-95
Sonnenberg, Urte: Programmangebote und Programmproduktion in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990. S. 97-124
Wilke, Peter: Medienmarkt Europa. Ein vergleichender Überblick. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990. S. 7-34
www.europa.eu.int./comm/commissioners/index_de.htm
[...]
1 Kleinsteuber, Hans J.: Europäische Medienpolitik am Beispiel der EG-Fernsehrichtlinie. In: Kleinsteuber, Hans J. (Hrsg.): EG-Medienpolitik. Fernsehen in Europa zwischen Kultur und Kommerz. Berlin 1990, S. 35
2 Um einen einheitlichen Begriff zu wählen, vernachlässige ich die Bezeichnung Europäischen Gemeinschaft (EG) und verwende stattdessen den Begriff der Europäischen Union (EU), da sich die EG seit dem Maastrichter Vertrag (09./ 10.12.1991) so nennt.
3 vgl. Gruber, Barbara: Medienpolitik der EG. Konstanz 1995, S. 23, 196
4 Kleist, Thomas: Europäische Medienpolitik aus Sicht der Bundesländer. In: Erbring, Lutz (Hrsg.): Kommunikationsraum Europa. Konstanz 1995, S. 57
5 Gruber, Barbara: a.a.O., S. 28
6 vgl. Kleist, Thomas: a.a.O., S. 58; vgl. Gruber, Barbara: a.a.O., S. 29, 38
7 Gruber, Barbara: a.a.O., S. 36
8 vgl. Kleist, Thomas: a.a.O., S. 62
9 vgl. Henle, Victor: Europäisierung der Medienordnungen und die Medienunternehmen. In: Henle, Victor (Hrsg.): Fernsehen in Europa. Strukturen, Programme und Hintergründe. München 1998, S 15-16
10 vgl. Kleinsteuber, Hans J./ Thomaß, Barbara: Europäische Perspektiven der Medienpolitik. In: Jarren, Otfried (Hrsg.): Medienwandel - Gesellschaftswandel? Berlin 1994, S. 65; vgl. Henle, Victor: a.a.O., S. 13, 23
11 Kleinsteuber, Hans J./ Thomaß, Barbara: a.a.O., S. 55
12 vgl. Kleist, Thomas: a.a.O., S. 62
13 vgl. Kleinsteuber, Hans J./ Thomaß, Barbara: a.a.O., S. 55; vgl. Gruber, Barbara: a.a.O., S. 40-41
14 Henle, Victor: a.a.O., S.17
15 vgl. Kleinsteuber, Hans J.: a.a.O., S. 40-41; vgl. Gruber, Barbara: a.a.O., S. 42-44
16 Kleinsteuber, Hans J.: a.a.O., S. 40
17 vgl. Kleinsteuber, Hans J.: a.a.O., S. 40; vgl. Gruber, Barbara: a.a.O., S. 45-48
18 Gruber, Barbara: a.a.O., S. 49
19 ebd.
20 ebd., S. 50
21 Degenhart, Christoph: Rundfunkordnung im europäischen Rahmen. In: Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 10/1992, S. 449
22 Gruber, Barbara: a.a.O., S. 199
23 vgl. Astheimer, Sabine/ Moosmayer, Klaus: Europäische Rundfunkordnung. Chancen oder Risiko? In: Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 7/1994, S. 397; vgl. Degenhart, Christoph: a.a.O., S. 453; vgl. Henle, Victor: a.a.O., S. 11
24 Astheimer, Sabine/ Moosmayer, Klaus: a.a.O., S. 400
25 Gruber, Barbara: a.a.O., S. 165
26 ebd., S.164
27 ebd., S.167
28 Kleist, Thomas: a.a.O., S. 60
29 vgl. Henle, Victor: a.a.O., S. 30-32
30 vgl. Glotz, Peter: Integration und Eigensinn: Kommunikationsraum Europa - eine Chimäre? In: Erbring, Lutz (Hrsg.): Kommunikationsraum Europa. Konstanz 1995, S. 24; vgl. Gruber, Barbara: a.a.O., S. 209-210
31 Kleinsteuber, Hans J.: a.a.O., S. 48
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der europäischen Medienpolitik, insbesondere im Hinblick auf das grenzüberschreitende Fernsehen. Es behandelt die Entstehung einer europäischen Medienpolitik, die Akteure, die Fernsehrichtlinie und weitere Aktionsgebiete wie Urheberrecht, Medienkonzentration und die Förderung neuer Techniken.
Wie entstand die europäische Medienpolitik?
Die europäische Medienpolitik entstand aufgrund der Möglichkeit des grenzüberschreitenden Fernsehens durch neue Kabel- und Satellitentechniken. Dies führte zur Notwendigkeit, nationale Medienvorschriften anzugleichen, um den freien Binnenmarkt zu gewährleisten. Der Europäische Gerichtshof stufte den Rundfunk als Dienstleistung ein und unterstellte ihn dem freien Dienstleistungsverkehr.
Wer sind die wichtigsten Akteure der EU-Medienpolitik?
Zu den wichtigsten Akteuren gehören das Europäische Parlament, die EU-Kommission (mit verschiedenen Generaldirektionen), der Europäische Gerichtshof, der Europarat und europäische Organisationen wie EUTELSAT und EBU. Die EU-Kommission fördert hauptsächlich wirtschaftliche Belange, während der Europarat kulturelle Interessen vertritt.
Was ist die Fernsehrichtlinie und was sind ihre wichtigsten Regelungen?
Die Fernsehrichtlinie ist ein Kompromiss zwischen den EU-Mitgliedstaaten und unterliegt dem Subsidiaritätsprinzip. Sie wirkt nur teilharmonisierend. Die wichtigsten Regelungen sind das Sendestaatsprinzip und freier Empfang, die Quotenregelung für europäische Werke, Bestimmungen zur Fernsehwerbung, Jugendschutz und das Recht auf Gegendarstellung.
Was bedeutet das Sendestaatsprinzip?
Das Sendestaatsprinzip besagt, dass jeder Mitgliedsstaat verpflichtet ist, den freien Empfang von richtlinienkonformen Fernsehsendungen zu gewährleisten. Der Empfangsstaat darf die Weiterverbreitung eines ausländischen Programms nicht behindern, auch wenn seine nationalen Vorschriften strenger sind.
Was beinhaltet die Quotenregelung?
Die Quotenregelung verpflichtet die EU-Staaten, den Hauptanteil der Sendezeit europäischen Werken vorzubehalten und zusätzlich mindestens 10% der Sendezeit oder der Programmmittel unabhängigen Produzenten solcher Werke. Diese Quote ist nicht rechtsverbindlich, sondern eine politische Absichtserklärung.
Welche Beschränkungen gibt es für Fernsehwerbung?
Die Fernsehrichtlinie legt quantifizierende Limits für die Werbung fest. Beispielsweise darf die Werbung maximal 20% der täglichen Sendezeit und maximal 20% pro Stunde betragen. Untersagt ist die Werbung für Zigaretten, Tabakerzeugnisse und verschreibungspflichtige Medikamente. Alkoholwerbung ist nur bedingt erlaubt.
Welche Jugendschutzbestimmungen gibt es?
Pornographische und Gewalt tätigkeiten zeigende Filme sind grundsätzlich verboten, da sie die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können. Dieses Verbot gilt nicht für Programme, die durch Wahl der Sendezeit oder technische Maßnahmen normalerweise nicht von Minderjährigen gesehen werden können.
Was ist das Recht auf Gegendarstellung?
Jeder in der EU ansässige Fernsehveranstalter hat ein Recht auf Gegendarstellung, wenn seine Interessen durch Behauptung falscher Tatsachen in Mitleidenschaft gezogen wurden sind.
Welche Kritik gibt es an der Fernsehrichtlinie?
Kritiker sehen keine eindeutige Handlungskompetenz der EU für den Bereich Rundfunk, da der EWG-Vertrag nur die Regelung wirtschaftlicher Sachverhalte ermächtigt. Der Rundfunk wird aber als originär kulturelle Veranstaltung betrachtet, die in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fällt. Zudem wird kritisiert, dass die EU-Medienpolitik stark auf die Interessen der privat-kommerziellen Anbieter ausgerichtet ist und die Sonderrolle deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht berücksichtigt.
Welche weiteren Aktionsgebiete der EU-Medienpolitik gibt es?
Weitere Aktionsgebiete sind das Urheberrecht, die Medienkonzentration, die Förderung neuer Techniken (wie HDTV) und das Media-Programm zur Förderung der europäischen Film- und Fernsehindustrie.
Was beinhaltet das Urheberrecht in der EU-Medienpolitik?
Die EU hat eine Richtlinie zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung verabschiedet. Diese basiert auf dem französischen Urheberrechtssystem, das dem Autor als "Schöpfer" des Films die "absolute Befugnis an seinem Werk" gibt.
Was ist das Ziel des Grünbuchs zur Medienkonzentration?
Das Grünbuch "Pluralismus und Medienkonzentration im Binnenmarkt" zielt darauf ab, den Informationspluralismus und die Meinungsvielfalt zu sichern. Ein Zusammenschluss von Medienunternehmen könnte den Wegfall eines bestimmten Senders oder einer Zeitung bewirken und damit die Informationsvielfalt für den Bürger verringern.
Was ist das Media-Programm?
Das Media-Programm wurde 1990 verabschiedet, um die europäische Film- und Fernsehindustrie zu fördern. Es handelt sich um verschiedene Projekte zur Programmproduktion, die von der EU finanzielle Zuschüsse in Form von Krediten erhalten.
- Quote paper
- Antje Anding (Author), 2000, Medienpolitik der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99718