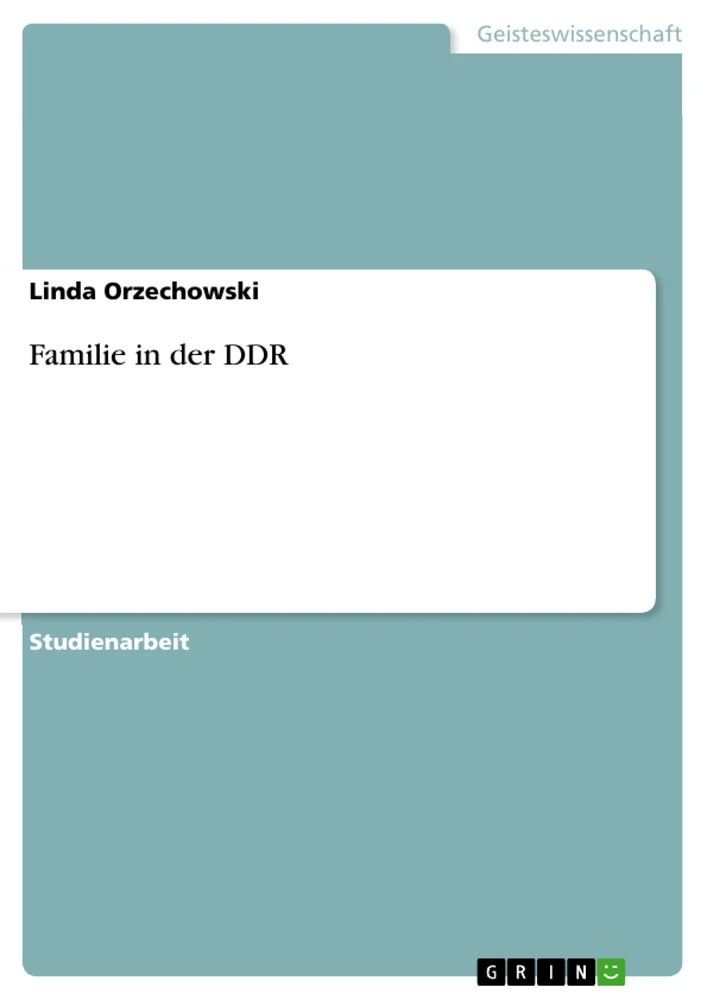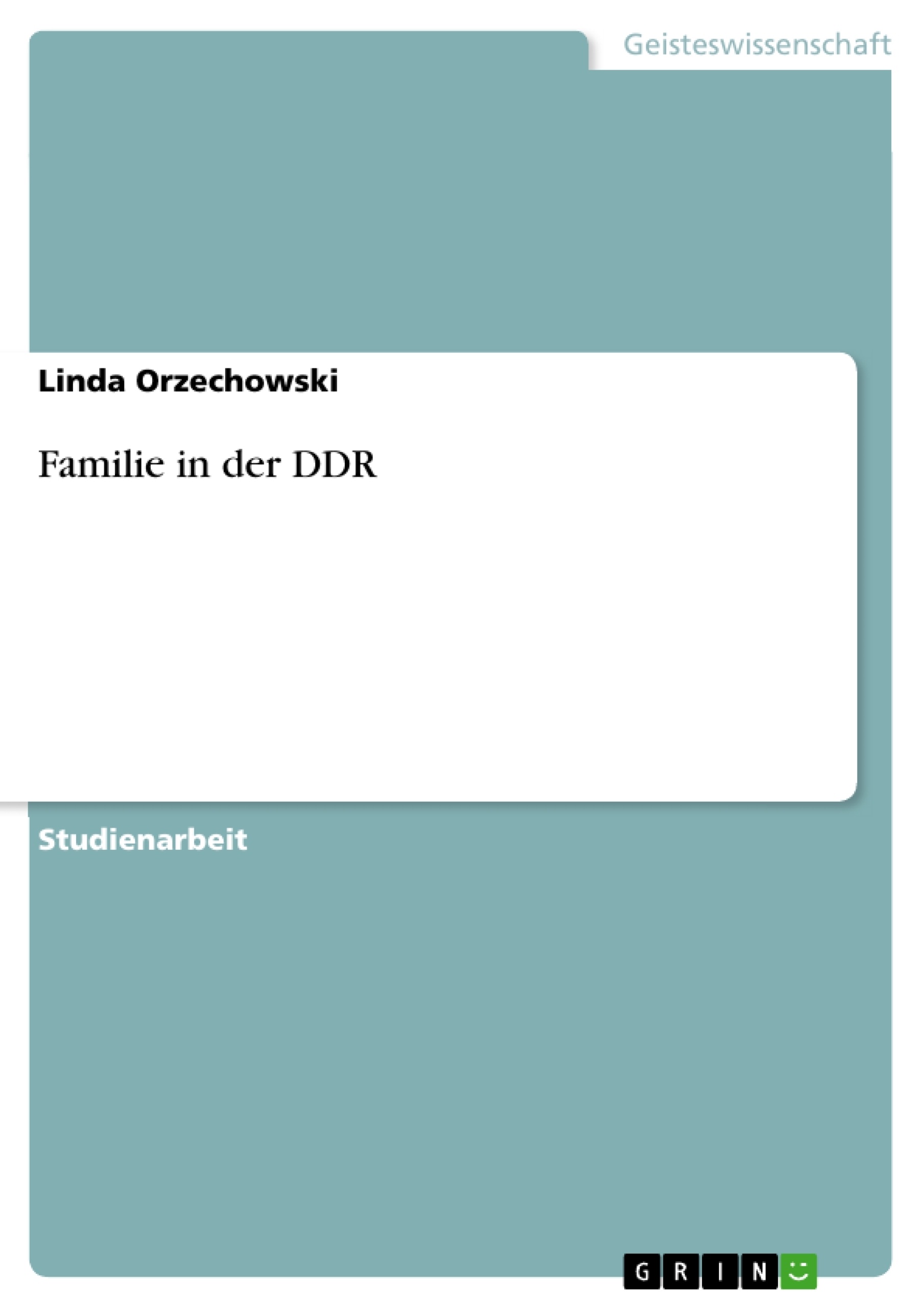In meiner Hausarbeit habe ich mich mit dem Thema Familie in der ehemaligen DDR beschäftigt. Der wichtigste Aspekt ist die Entwicklung der Frau als Mensch und damit resultiert sich der Stellenwert sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft. Meine Recherchen beruhen auf Informationen, die seit der Gründung der DDR bis zur Vereinigung durch empirische Studien gesammelt wurden. Bevor ich zu meinem Hauptthema übergehe, definiere ich den Begriff Familie und seinen historischen Wandel.
Zunächst erkläre ich die Herkunft und die Geschichte der Familie. Die Familie als Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich die Gesamtheit der Dienerschaft und Gesindes. Über die Familie wurde schon immer philosophiert und es gab verschiedene Vorstellungen, was eine Familie überhaupt sei. Die griechische Philosophie stützte sich auf Aristoteles und seine Auffassung von Familie und Ehe. Das heißt: dass der Staat die Summe vieler selbständiger Gemeinschaften sei. Sowohl in der Ehe als auch in der Leitung des Hauses kommt nur dem Mann von Natur die Rolle zu.
Familie in der DDR
Einleitung
In meiner Hausarbeit habe ich mich mit dem Thema Familie in der ehemaligen DDR beschäftigt.
Der wichtigste Aspekt ist die Entwicklung der Frau als Mensch und damit resultiert sich der Stellenwert sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft. Meine Recherschen beruhen auf Informationen die seit der Gründung der DDR bis zur Vereinigung , durch empirische Studien gesammelt wurden.
Bevor ich zu meinem Hauptthema übergehe, definiere ich den Begriff Familie und seinen historischen Wandel.
Familiendefinition
Zunächst erkläre ich die Herkunft und die Geschichte der Familie.
Die Familie als Begriff kommt aus dem lateinischen und bedeutet eigentlich die Gesamtheit der Dienerschaft und Gesindes. Über die Familie wurde schon immer philosophiert und es gab verschiedene Vorstellungen was eine Familie überhaupt sei.
Die griechische Philosophie stützte sich auf Aristoteles und seine Auffassung von Familie und Ehe heißt: dass der Staat die Summe vieler selbständiger Gemeinschaften sei. Sowohl in der Ehe als auch in der Leitung des Hauses kommen nur der Mann von Natur die Rolle zu.
Auch die Idee von der Familie als Keimfamilie des Staates, dass die Familie ursprünglich und unentbehrlicher sei als der Staat, findet sich bei Aristoteles.
Einige Stroiker hingegen erklärten Ehe und Familie zur Staatsbürgerlichen Pflicht.
Die jüdisch-christliche Tradition der Ehe- und Familien-Auffassung ist keineswegs einheitlich oder von Anfang an voll ausgebildet. Das mag zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass Ehe und Familie zumal noch dem Alten Testament gegenüber Stämmen, Sippen und Gentilverfassungen noch nicht im heutigen Sinne verselbständigte soziale Einheiten waren.
So finden sich auch im Alten Testament keine strengen Monogamievorschriften, sondern nur Hinweise auf eine entsprechende Tendenz. Jesus nahm Stellung zur Ehe und ihrer Unauflöslichkeit, nicht zur Familie; die Theologische Reflexion über Ehe und Familie geht im wesentlichen von Paulus aus. Die enge Verbindung von Haus Gottes, Familie und christliche Gemeinde wird im Neuen Testament mehrmals angesprochen und wirkte unmittelbar auf Leben und Lehre der Urkirche. Zur breiteren Durchsetzung des christlichen Ehe- und Familienideals kam es erst zur Zeit der Reformation, besonders durch das Lebenswerk von M.Luther.
Das Familienleben wurde zum Ausgangspunkt des christlichen Lebens sowie einer neuen Arbeits- Berufs-Auffassung. Die seit dem Konzil von Trient festgeschriebene unterschiedliche Eheauffassung der beiden Konfessionen wurde überlagert durch das sich allgemeine durchsetzende Ideal der christlichen Hausgemeinschaft. Die Naturrechtslehren der Aufklärung und die Romantik führten zusammen mit tief greifenden sozialen Wandlungen zu Änderungen der Familienauffassung. Man ging jetzt von der Natur der Menschen, seiner Autonomie und Vervollkommnungsfähigkeit aus. Die Romantik verstärkte diesen Trend insofern, als sie für die Familiengründung das innige Liebesverhältnis von Mann und Frau zur Voraussetzung machte. Die christliche Haushaltsfamilie war die Hausgenossenschaft. Sie umfasste darin Hausherr mit Frau und Kinder, die Blutsverwandten die zum Haus gehörten sowie das Personal, Gesinde, Gesellen und je nach Größe undökonomische Basis des Hauses andere Personen. In dieser Art der Familie liegen wichtige Wurzeln des christlich- abendlichen Kultur- und Zivilisationsprozesses.
Bis weit in die Mitte des 20.Jahrhunderts blieb das Familienleben christlich geprägt; Hochzeit, Geburt, Taufe, Konfirmation und Tod, aber auch die Feste des Jahreslaufs waren mit vielfältigem, zum Teil erhalten gebliebenem Volksbrauchtum, verbunden. Im Alltagsleben war die der Geschlechtsvormundschaft des Hausvaters untergeordnete Frau für Haus und Herd sowie die Kinder und deren Gesundheit verantwortlich. Mit der sich aus dem 18.Jahrhundert durchsetzenden bürgerlichen Familie zerbrach die christliche Haushaltsfamilie. Es begann die Entwicklung zur Kleinfamilie. In der bürgerlichen Familie mit ihrer Sphäre größerer Privatheit erfolgte allmählich eine Differenzierung von außerhäuslichen Erwerbsarbeit des Mannes und Hausarbeit der Frau. In Folge der Pädagogisierung der Kinder- und Jugendphase seit Ende des 18.Jahrhunderts, die ihrerseits die Rolle der Hausfrau und Mutter mitprägte, kam es zur Ausbildung einer eigenständigen Kindersphäre.
Die gegenwärtige Entwicklung der Kleinfamilie fing Ende des Zweiten Weltkrieges an. 1945 haben sich fundamentale Wandlungen entwickelt.
Die Technisierung des Haushalts erleichtert die Hausarbeit und führte zur Reduktion der für die bürgerlichen Familien typischen Hauspersonals.
Die Zahl der Kinder reduzierte sich erheblich. Dadurch fanden Veränderungen in der Siedlungsweise und den Wohnverhältnissen, die verlängerten Schul- und Ausbildungszeiten der Kinder, der Zuwachs an Tages und Wochenendfreizeit, statt. Auch die Durchsetzung des Ideals der partnerschaftlichen Ehe und Familie und der außerhäusliche Erwerbsarbeit für die Frau, führte zur Änderungen in den Auffassungen über Familie und die Formen des Familienlebens.
Durch die Hohe Lebenserwartung ist die nachelterliche Phase erheblich länger geworden. Immer mehr Menschen erleben ihre Urenkel, die Beziehungen der verschiedenen Generationen untereinander haben sich gegenüber früheren Zeitabschnitten qualitativ deutlich verändert. Nach wie vor haben jedoch verwandtschaftliche Bindungen eine große Bedeutung für die gegenseitige Unterstützung. Die Mehrzahl der Eltern lebt in leicht erreichbarer Entfernung zu zumindest einem Großelternteil, und oftmals übernehmen die Großeltern oder andere Verwandte die Betreuung und Versorgung der kleinen Kinder.
Trotz der Veränderungen im Laufe der Geschichte, ist die Familie auch heute noch Ursprung und Ziel einer kaum überschaubaren Fälle ethischer Normen und sittlicher Grundüberzeugung.
Jetzt komme ich zu der eigentlichen Definition der Familie.
Familie ist die Gemeinschaft der in einem fortdauernden Ehrverhältnis lebenden Eltern und ihrer Kinder. Gelegentlich wird unter Familie auch die Gruppe der Blutsverwandten verstanden. Im Deutschen wurde der Begriff Familie meist durch die Formel „Weib und Kind“ oder das Wort „Haus“ ersetzt.
Der moderne Familienbegriff beschränkt sich auf die Einheit der verwandtschaftlich verbundenen Menschen. Ermeint heute eine soziale Gruppe die mindestens aus Mann und Frau mit ihren unverheirateten und unmündigen Kindern besteht, den Lebensunterhalt miteinander teilt und getrennt von der übrigen Verwandtschaft zusammenwohnt.
Im Laufe der Geschichte haben sich die Familienformen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsverfassung geändert. Entscheidend waren dabei die Wandlungsmöglichkeit von mutterrechtlichen zu vaterrechtlichen Familienorganisationen, die Liberalisierung rechtlicher Beschränkungen bei der Familiengründung und die Tendenz von Groß- zu Kleinfamilien.
Dennoch wird gegenwärtig in der Soziologie ein allgemeines „Kontraktionsgesetz“ das eine Entwicklung von weitesten zu immer engeren Familienformen annimmt, abgelehnt, da dies eine Verallgemeinerung darstellet, die aus dem Formwandel erweiterter Familien der Oberschichten gewonnen wurde. Kernfamilien lassen sich in allen Gesellschaftssystemen nachweisen; ihr gegenwärtiges Gewicht in Industriegesellschaften ergab sich als Prozess der Schrumpfung erweiterter Familien im Verlauf zunehmender industrieller Arbeitsteilung. Daneben wird Familie als wichtige gesellschaftliche Institution angesehen, deren Hauptfunktion- außer in der Regelung der Geschlechtsbeziehungen- in der Sozialisation besteht, da sich im Verlauf dieses Prozesses die ersten Persönlichkeitsmerkmale des Kindes ausbilden. Durch die Identifikation des Kindes mit den Eltern vollzieht sic darüber hinaus die Aneignung gesellschaftlichen Rollenverhaltens. Gleichzeitig werden dem Kind auch die Werte und Normen der sozialen Schicht vermittelt, der die Eltern angehören, vor allem Sprachvermögen, Moral, Autorität, Leistungsmotivation.
Familie in der DDR
Die ehemalige DDR ( Deutsche Demokratische Republik) wurde als ein Sozialistischer Staat gegründet mit dem großen Einfluss der damaligen Sowjetunion. Ein sozialistischer Staat hat eine andere Grundeinstellung zur Staatsführung. Ein Unterschied liegt darin, dass für die Bildung der Familie, dem Sozialismus Faktoren wichtig sind wie:
Liebe, gegenseitige Hilfe und Kameradschaft, im gegensatt dazu sind Faktoren wieökonomische Abhängigkeit der Frau vom Mann, oder auch religiöse Einflüsse, die heutzutage stark abgenommen haben, nicht als wichtiger Punkt für die Gründung und Stabilität der Familie.
Der Gesetzgeber sieht die Familie und ihren Rang in der Gesellschaft so:
„Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Sie beruht auf der für das Leben geschlossene Ehe und auf den besonders engen Bindungen, die sich aus den Gefühlsbeziehungen zwischen Mann und Frau und den Beziehungen gegenseitiger Liebe, Achtung und gegenseitigen Vertrauens zwischen allen Familienmitgliedern ergeben. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in der ehemaligen DDR waren die feste Grundlage für die sozial gesicherte Existenz der Familie. Mit dem Aufbau des Sozialismus entstanden gesellschaftliche Bindungen, die dazu führten, die Familienbeziehungen von den Entstellungen und Verzerrungen zu befreien, die durch die Ausbeutung des Menschen, die gesellschaftliche und rechtliche Herabsetzung der Frau, durch materielle Unsicherheiten und andere Erscheinungen der Bürgerlichen Gesellschaft bedingt waren. Mit der sozialistischen Entwicklung in der damaligen DDR entstanden Familienbeziehungen neuer Art. Die von Ausbeutungen freier schöpfenden Arbeit, die auf ihr beruhenden kameradschaftlichen Beziehungen der Menschen , die gleichberechtigte Stellung der Frau auf allen Gebieten des Landes und die Bildungsmöglichkeiten für alle Bürger sind wichtige Voraussetzungen , die Familie zu festigen und sie dauerhaft und glücklich zu gestallten .
Harmonische Beziehungen in Ehe und Familie haben einen großen Einfluss auf die Charakterbildung der heranwachsenden Generation und auf das persönliche Glück und die Lebens- und Arbeitsfreude des Menschen...“ (Plat, Wolfgang, 1973, S.382,Zitat) Aus diesen Zitat lässt sich schließen , dass die Familie und auch die Frau einen hohen Stellenwert hatte. Seit den Anfängen der DDR galten Gesetze in Bezug auf Familie und die Förderung der Emanzipation. 1947 deklarierte die Länderverfassung der damaligen sowjetischen Besetzungszone den uneingeschränkten Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter. 2 Jahre später gingen die Grundrechte des Schutzes der Familie und der Gleichberechtigung von Mann und Frau genauso in die 1.Verfassung der DDR ein wie auch in das Grundgesetz der Bundes Republik Deutschland.
Die Familienpolitik hatte sich aber unterschiedlich in den beiden deutschen Staaten entwickelt. Das lag daran , dass der Gesetzgeber Jahr für Jahr immer neue rechtliche Schritte und praktische Maßnahmen mit großer Konsequenz vornahm, während in der BRD die rechtlichen Schritte nur außerordentlich zögernd unternommen wurden. Bis 1968 hatten die Gesetzgeber und die Gesellschaft, auf dem großen Gebiet des Familienrechtes und der Förderung der Frau im Sinne ihrer Gleichberechtigung als produktive Kraft und Staatsbürgerin, nichts geändert, bis auf die Deklaration der Grundrechte. In der ehemaligen DDR hat der Gesetzgeber dafür gesorgt , dass die Frau jeden Beruf ausüben konnte den sie wollte. Es wurde in Betrieben kontrolliert ob die Förderung der Frau wirklich statt fand. Dazu kam auch das Gesetz , dass unabhängig von Geschlecht für gleiche Arbeit gleicher Lohn zu zahlen sei. Für die Frauen in der damaligen DDR war es unvorstellbar, einen geringeren Lohn zu erhalten, trotz gleicher Arbeit. In der BRD dagegen gab es für die Frauen sogenannte Leichtlohngruppen. Die Frauen hatten ein geringeres Gehalt für die gleiche Arbeit erhalten als die Männer. Das sind die wesentlichen Punkte die, die Entwicklung der Familie in der ehemaligen DDR von der BRD unterschieden. Die Frau hatte endlich den gleichen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen.
Der Grundgedanke des Gesetzgebers für die Förderung der arbeitenden Frau, ist die Vorstellung, dass die Gleichberechtigung der Frau in der sozialistischen Gesellschaft durch die Teilnahme am Arbeitsprozess und die Mitwirkung an der Leitung von Staat und Wirtschaft voll verwirklicht wird. (Plat, Wolfgang, 1973, S.378) Das bedeutet , dass die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau in der sozialistischen Gesellschaft im wesentlichen außerhalb der Ehe und Familie gesehen wurde.
Entscheidend ist die Stellung der Frau im gesellschaftlichen Produktionsprozess. Die Talente und Fähigkeiten der Frauen sollen organisch und planmäßig als integrierender Bestandteil derökonomischen, sozialen , geistigen und kulturellen Aufgaben der Gesellschaft zur vollen Wirkung gebracht werden. Dieser Grundgedanke stützt sich auf der Theorie von Marx und Engels. Die Theorie lautet: „Alle körperlichen und intellektuellen Eigenschaften der Menschen haben sich im Verlauf großer Zeiträume durch Aneignung der Natur mit Hilfe immer vollkommener Arbeitsinstrumente entwickelt. Wer an dieser Entwicklung nicht mit all seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten , die ihm durch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft gegeben wurden, aktiv teilnimmt, wird kein vollkommender Mensch und damit in diesem Sinne niemals sein in jeder Hinsicht gleichberechtigtes Mitglied der menschlichen Gemeinschaft sein. Die Beschränkung der Frau auf das magische Dreieck von Küche Bet und Wiege hat zur Verkrüppelung der Anlagen dieses Teils der menschlichen Gesellschaft geführt.“ (Plat, Wolfgang, 1973, S. 379, Zitat) Das ist der sozialistische Gedanke, an dem sich die Gesetzgeber der DDR stützen . Man war sich auch im klaren , dass eine schematische Gleichbehandlung der Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen im Arbeitsprozess unter gar keinen Umständen dem Grundgedanken der Gleichberechtigung dienen würde.
Im Kommentar zum Gesetzbuch der Arbeit hieß es : „Es kommt also darauf an , die Gleichstellung der Frau als allseitige Forderung der sozialistischen Entwicklung im Arbeitsprozess, ihr Grundrecht auf Arbeit in seiner neuen Qualität und nicht mehr allein aus der Sicht der Verwirklichung individueller Rechte der Frau durch zusetzen. Selbstverständlich müssen dabei die Voraussetzungen, die der Frau erst ihre Tätigkeit- die Verbindung der Arbeit mit ihren Häuslichen Pflichten - ermöglichen, geschaffen und die Fülle der mit der Einbeziehung der Frau in den Arbeitsprozess auftretenden Probleme, die von der Erziehung der Kinder über die Entlastung im Haushalt bis zur Verbesserung der Dienstleistungen reichen, im Interesse der Frau und damit der Gesellschaft gelöst werden. „(Plat. Wolfgang, 1973, S.379, Zitat)
Um die formulierten Ziele zu erreichen, wurden dei Leiter der Betriebe zur Schwerwiegenden Pflichten herangezogen, die im Gesetzbuch der Arbeit verankert sind, Die Leiter der Betriebe wurden verantwortlich gemacht, dass sie bei ihrer Leitungstätigkeit die Belange der werktätigen Frauen berücksichtigen, besonders im Bereichen in den Technik die Arbeitsplätze der ungelernten oder angelernten Frauen übernahm, und auch dort, wo es Unterschiede in Qualifikationsniveau zwischen männlichen und weiblichen Werktätigen gab.
Der Leiter ist verpflichtet gewesen die Frauen so zu qualifizieren und zu befähigen , dass sie zunehmend im mittleren und leitenden Funktionen sowie neuen Berufszweigen mit großer Entwicklungsmöglichkeit eingesetzt werden können.
Die Arbeitsbedingungen mussten auch so gestaltet werden, dass alle physischen und psychischen Möglichkeiten und Besonderheiten des weiblichen Geschlechtes berücksichtigt wurden. Ein Beispiel dafür ist die Umstellung der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft.
Die landwirtschaftlichen Maschinen wurden komplett umgestaltet . Es wurden neue Sitze und eine Kräftesparende Hydraulik so eingesetzt, dass die Maschinen auch von Frauen bedient werden konnten. Das erklärt die Tatsache , dass immer mehr mittlere und leitende Funktionen in Staat und Gesellschaft von Frauen übernommen werden, sowie der steigende Frauenanteil an den Ingenieur- und Technikschulen. In der elektronischen Datenverarbeitung , in der Chemie, in der Feinmechanik und im Bereich der Mess- und Regelungstechnik.
Die Frau hatte auch hohe Positionen erreicht wie in der Volksvertretungen auf Kreis- und Bezirksebene und in der Volkskammer. Jede dritte Frau hatte einen Abgeordneten Posten .Jede vierte Schule hatte eine Direktorin und 13% aller Bürgermeister waren Frauen. Das hohen Engagement des Staates für die Ausbildungsförderung lag auch daran dass über 50% der Bevölkerung Frauen waren. Die Folge war, dass 40% der Fachschulstudenten Frauen waren. Zum Zeitpunkt der sechziger Jahren war das ein gewaltiger Fortschritt.
Man hatte die Frauen der DDR und der BRD befragt zur Einstellung zum Beruf. Es ergaben sich sehr große Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten. Denn 80% der Frauen aus der BRD übten einen Beruf nur aus als Übergang bis zur Ehe, und gingen auch davon aus, dass sie in einer EHE nicht mehr arbeiten müssen . Die Frauen aus der DDR dagegen, haben sich einen Beruf ausgesucht und sahen es als selbstverständlich trotz einer Ehe und Kinder in ihrem Beruf weiterhin tätig zu sein.
Natürlich hab es auch in der DDR Wiederstände, bornierte Ansichten und Vorstellungen bei Männern, die überwunden werden mussten . Dafür war der Betriebsleiter zuständig. Bei der Umfassenden Eingliederung des weiblichen Geschlechts im Produktionsprozess hat der Gesetzgeber der besonderen Schutz der Frau und der Frau als Mutter berücksichtigt.
Schwere körperliche Arbeit die, die Gesundheit der Frau schädigen könnte wurde verboten.
Schwangere und stillende Mütter durften keine Arbeit ausführen, die nach Gutachten des Betriebsarztes oder des Arztes der Schwangererberatung, die Gesundheit der Mutter oder des Kindes gefährden würde. Unter Umständen muss die Frau für diese Zeit einer Leichteren Arbeit im Betrieb zugewiesen werden . Sei dürfen auch keine Überstunden oder Nachtdienste ausführen. Erleidet die Frau durch einen notwendigen Arbeitsplatzwechsel eine Lohneinbuße, so muss der Betrieb den Differenzbetrag als Ausgleich zuzahlen.
Bei Vorlage der Stillbescheinigung steht jeder Mutter bis zum sechsten Monat zwei Stillpausen täglich von je 45 Minuten zur Verfügung. Für die 11/2 Stunden erhält die stillende Mutter eine Ausgleichzahlung in Höhe des Durchschnittsverdienstes. Die Mutter unterliegt einem Kündigungsschutz bis zum sechsten Monat nach der Geburt und jeder Mutter steht ein einjähriger Mutterschaftsurlaub zu. In diesem Jahr wird die Betriebszugehörigkeit nicht unterbrochen. Die Frau hat das Recht auf ihren alten Arbeitsplatz. Im Falle einer Erkrankung des Kindes legt der Gesetzgeber einen großen Wert darauf , dass eine Gleichberechtigung von Mann und Frau stattfindet. Es kann unter den Eltern vereinbart werden , wer sich um das kranke Kind sorgen wird. Der Betrieb muss eine Beurlaubung vom Mann genau wie von der Frau akzeptieren. Falls keiner von den Elternteilen in der Lage war sich zu beurlauben gab es eine dritte Lösung. Es wurden spezielle Kinderkrankenhäuser vomörtlichen Organen der Staatsmacht und den Betrieben errichtet.
Die zweite Überlegung bei der notwendigen Qualifizierung der Frauen geht auf die Forschungsergebnisse von DDR- Soziologen zurück. Es wurde in der DDR erwiesen, dass der Wunsch , eine berufliche Tätigkeit auf die Dauer nicht auszuüben , ist vor allem bei ungelernten und angelernten oder solchen Frauen groß , die in ihrer Jugend einen Beruf ergriffen haben, der sie auf die Dauer nicht erfüllt.
Aus diesem Grunde verpflichtet das Gesetz auch der Arbeit die Betriebsleiter, zusammen mit den Betriebsgewerkschaftsleitungen und vor allem unter Mitwirkung der Frauenausschüsse in den Betrieben Frauenförderungspläne zu entwickeln und zu verwirklichen. Bei den Frauenförderungsplänen handelt es sich keineswegs um irgendwelche unverbindliche Papiere. In den Jahren 1969/70 ließ der Ministerrat der DDR durch Kommissionen in über 2000 Betrieben die Einhaltung der Frauenförderungspläne kontrollieren. Insbesondere die Aus- und Weiterbildung von Frauen für bestimmte technische Berufe und den planmäßigen Einsatz von Frauen in leitenden Tätigkeiten. Die Frauenausschüsse wurden im Betrieb und in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft von Frauen gewählt. Fast die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder der damaligen DDR waren Frauen.
Durch einen Auszug aus dem Familiengesetzbuches wird deutlich wie wichtig die Familie für den Staat war. Denn laut dem Gesetz existierte nicht die Gesellschaft an sich , sondern wie jede andere Gesellschaftsordnung sich aus Klassen , Schichten und Gruppen zusammensetzt. Nach der sozialistischen Weltanschauung sind es vor allem zwei Gemeinschaften , die in Bezug auf das Leben und die Entwicklung des Menschen als die wichtigsten angesehen werden. Die Familie und die Gruppe von Menschen, in der , der einzelne Täglich arbeitet . Beiden Gruppen wird der größte Einfluss auf die Herausbildung der Persönlichkeit im sozialistischen Sinne zugesprochen. Dabei wird berücksichtigt, dass im Gegensatz zum Arbeitskollektiv die Familie eine Selbstständige Gemeinschaft darstellt und die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander nur von ihnen selbst und nicht von außen her gestaltet werden können. Einfluss vom Staat und Gesellschaft soll lediglich indirekt über die Veränderungen der Lebensbedingungen der Gesellschaft und über die Veränderungen im Bewusstsein des einzelnen Menschen wirksam werden. (Plat, Wolfgang, 1973,S383,Zitat) In einer Ehe sind beide Ehepartner verpflichtet die Beziehung so zu gestallten , dass beide ihre Begabungen und Fähigkeiten voll entfalten können und dass sie sich dabei auch gegenseitig unterstützen. Dadurch viel die traditionelle Arbeitsteilung innerhalb der Ehe weg, dass der Mann alleine für den Lebensunterhalt zuständig war und die Frau für die Wohnung, Küche und Kinder. Die Auswirkung des Grundsatzes konnte man deutlich erkennen. Viele Väter holten ihre Kinder vom Kindergarten ab , gingen einkaufen und fuhren die Kinder im Kinderwagen spazieren. Das war ein Bild, was damals in der Bundesrepublik selten zufinden war. Die Gleichberechtigung wirkte sich auch darin aus , dass der Mann und die Frau im gegenseitigen Einverständnis Angelegenheiten des gemeinsamen Lebens klärten wie z.B. Erziehungsrecht, Pflege des Kindes und die Führung des Haushaltes. Im Gesetz ist festgelegt , dass die Frau das Recht hat über ihre berufliche Tätigkeit selbst zu entscheiden und wenn einer der beiden Ehegatten sich zur Weiterbildung entscheidet, muss der andere ihn dabei unterstützen und auf ihn Rücksicht nehmen.
Die Aufwendung der Haushaltführung und der Kindererziehung ist der Aufwendung der beruflichen Arbeit gleich, Das bedeutet , dass die Frau einen Teil des Gehaltes des Mannes erhielt um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Die Ehe wird von der sozialistischen Weltanschauung auch als ein Bund fürs Leben gesehen. Das Gesetz fordert die Ehrewilligen dazu auf die gegenseitigen Charaktereigenschaften, Auffassungen und Interessen genau vor einer Eheschließung zu untersuchen, ob die Voraussetzung für eine dauerhafte Ehe vorhanden ist. Eine Eheschließung kann nur durchgeführt werden, wenn eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Leiter des Standesamtes vorgetragen wird.
Die Gleichberechtigung kömmt auch bei der Wahl des Familiennamens zum Ausdruck.
Die Ehegatten suchen sich einen gemeinsamen Nachnamen aus, den auch die Kinder übernehmen. Die Wahl ist ihnen überlassen ob sie den Nachnamen der Frau, des Mannes oder eine Doppelnamen wählen. In der ehemaligen DDR lag in den 80er Jahren eine hohe Familienorientierung vor.
Das war aber nicht in erster Linie Ausdruck einer besonderen Wertschätzung der Institution Familie, sondern das Fehlen von Alternativen und Gestaltungsmöglichkeiten imöffentlichen Leben . die Familiengründung war nicht immer das Synonym für Selbstverwirklichung und sinnstiftende Privatheit. Dazu trug stark bei , dass die Familie nicht unbeeinflusst von der staatlichen und Gesellschaftlichen Kontrolle - und Überwachungsbemühungen blieb. Sie war nicht der private Rückzugsraum, in dem sich die Menschen individuell entfalten konnten, sondern eine von strukturellen Rahmenbedingungen und staatlichen Einflussversuchen in erheblichem Umfang durchdrungene Lebensphase. Die für staatssozialistische Gesellschaften typische Verregelungen von Verhaltensmustern reichte weit in das Privatleben und ihre Befolgung wurde durch ein eng geknüpftes Netz formeller und informeller sozialer Kontrollen zu überwachen versucht. Arbeitskollektive und Haushaltsgemeinschaften, staatliche Eingriffsversuche und die Antizipation die Folgen nicht normgerechten Verhaltens haben in vielfältiger Weise das Familienleben beeinflusst und verhindert. Dass sich Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten im Familien - und Privatbereich unabhängig entwickeln konnten. Die sorgsam gehütete Intimsphäre war einem hohen Anpassungsdruck ausgesetzt, der aus der engen Rückkoppelung mitöffentlichen und halböffentlichen Lebensbereichen resultierte. (Schneider, Norbert F., Tölke, Angelika, 1995, S.7) Die Familiengründung erfolgte in der damaligen DDR deutlich früher als im Westen, was auf einen anderen Status von Familie im Lebenslauf hinweist. Im Osten deutete die Familiengründung den Einstieg in ein „eigenes Leben“ außerhalb gesellschaftlicher Lenkung.
Im Westen dagegen war die immer spätere und immer häufige ausbleibende Familiengründung der Preis für eine individuelle Lebensführung. Die westliche moderne Gesellschaft fordert den Verzicht auf Kinder.
„Beck (1986,191) schrieb, dass heute in dem zu Ende gedachten Marktmodell der Moderne die familien- und ehelosen Gesellschaft unterstellt wird, in der das den Bedürfnissen der Erwerbssphäre angepasste Subjekt das alleinstehende , nicht partnerschafts- , ehe- oder Familien „behinderte“ Individuum „ist. „Familienbehinderung“ ist zudem verbunden mit erheblichen materiellen Belastungen und Benachteiligungen der Familie gegenüber Nicht- Familienhaushalten. Unter den Bedingungen individualisierter Lebensläufe ist Familie in der Bundesrepublik eine vor allem für Frauen zunehmende Belastung und damit unattraktive biographische Option geworden.
In der DDR ist Ende der achtziger Jahre eine vordergründige Modernisierung der Familien erreicht worden, zumindest was die Kombination von Familie und Beruf bei Frauen angeht.
(Schneider, Norbert F., Tölke, Angelika, 1995,S.31)
Häufige Lebensformen bei jungen Erwachsenen im Westen waren Singlehaushalte im Osten dagegen ein koppelberufstätiges Paar mit Kind.
Auch das Alter für Familiengründung war unterschiedlich. Im westen lebten 2/3 Erwachsener zwischen 25-29 Jahren ohne Kinder, im Osten waren nur 1/3 aller Erwachsenen zwischen 21-25 Jahren Kinderlos.
Man ist sich einig das die Familie in der ehemaligen DDR sowohl aus der Sicht des Staates und der Sicht der Bevölkerung einen großen Stellenwert besaß. Als Begründung dafür ließen siech eine ganze Reihe Hypothesen aufstellen.
1.Es könnte an der staatlichen verbreitenden Normen liegen, die spätestens seit den 60er Jahren das Leben in er Ehe und der klassischen Kleinfamilie mit mindestens zwei Kindern bevorzugten und propagierten.
2.Die frühe Familienbildung , fand bei einem allgemeinen Teil der Bevölkerung die Zustimmung, und der eintritt in diese Art „Gemeinschaft“ war das, was von der Gesellschaft abverlangt wurde.
3.Frühe Familiengründung könnte auch der Ausdruck des starken Verweises der DDR- Bevölkerung auf das Private Leben sein. Die Trennung des Privaten Lebens von der formellen Struktur der DDRöffentlichkeit mag danach ausgeprägter gewesen sein, als es für Westdeutschland angenommen werden kann. Die Familie war die Basis für ein persönliches Engagement , das nie gesellschafts-öffentlich werden durfte.
4.Die begrenzte Vielfalt an Lebensmöglichkeiten förderten die Frühzeitige Familiengründung. Die entwürfe individueller Lebensgestaltung, in denen Familie und Kinder eher als Hemmnis und Hinderungsmoment zu betrachten gewesen wären, stießen auf ein besonders kleines Angebot in der Gesellschaft. Die beschränkten Reisemöglichkeiten und Konsumangebote mögen hier nur als plakatives Beispiel genannt worden.
5 Die frühe Familiengründung im „Kalkül“ individueller Lebensplanung spielte eine große Rolle und war mit der Tatsache verbunden , dass junge Erwachsene früh eine große Sicherheit im bezug auf die Existenz der Familie hatten.
6.Die Ehe und der Start in die Elternschaft wurde als Mittel eingesetzt, um sich den Zugang zu wichtigenöffentliche Gütern wie z.B. Wohnung zu sichern, sich finanzielle Ressourcen für die Ausstattung der Wohnung zu erschließen oder auch einen willkommenen zwischenzeitigen Ausstieg aus der Erwerbsarbeit zu erreichen.
Dies sind aber nur Hypothesen die nicht empirisch überprüfbar sind.
Es wurde aber auch Geheiratet weil es Vorteile mit sich brachte. So kommt nämlich eine relativ hohe Heiratsquote bei den Hochschulabsolventen während des Studiums vor. Etwa 60% der Studierenden heirateten während des Studiums. Die Begründung dafür ist, dass ein Paar so gemeinsam ein einem Wohnheim leben konnten und bekamen dafür auch eine gesetzliche Garantie. Die Ehe war auch dann wichtig, wenn man nach dem Studium beabsichtigte zusammen zuleben. Denn nur durch eine Eheschließung konnte verhindert werden, dass man nach dem Studium an verschiedenen Orten beruflich eingesetzt wurde. Der Familienalltag muss stets unter den Anforderungen , die Beruf und Familie stellen , organisiert werden. Es wurde eine Befragung bezüglich der Verknüpfung von Beruf und Familie in Ostdeutschland und in Bayern durchgeführt.
Es wurden verschiedene Aussagen zur Erwerbstätigkeit von Frauen vorgelegt, zu denen die Befragten den Grad ihren Zustimmung bzw. Ablehnung angeben sollten . Bei der Frage ob sich eine Mutter, die ganztags arbeitet, sich zu wenig um ihre Kinder kümmert, so stimmten 62% der bayrischen Frauen zu . In der DDR stimmten lediglich nur 42% der Aussagen zu. Umgekehrt verhält es sich bei denjenigen Aussagen, die für eine Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit von Frauen und Müttern stehen. Die beiden Fragen „Eine Mutter , die arbeitet, hat zu wenig Zeit für ihre Kinder, beschäftigt sich aber intensiver mit ihnen“ und „Auch eine Frau, die arbeitet, kann sich genügend um den Haushalt kümmern“ erfuhren von den ostdeutschen eine höhere Zustimmung als von den bayerischen Frauen.
Die Aussage „Nur eine berufstätige Frau ist wirklich selbständig in der Ehe und Partnerschaft“ stimmten im Osten über 70% der befragten Frauen voll bzw. überwiegend zu, während dies in Bayern lediglich knapp 30% taten. Die Zustimmung zu dieser Aussage Weist auf die Bedeutung der Berufstätigkeit und die damit verbundene finanzielle Unabhängigkeit für Frau in der DDR. Insgesamt wird deutlich , dass die Lebensvorstellungen von Frauen in Bayern in stärkerem Maße von einer Entscheidung zwischen Beruf und Familie ausgehen, während für Frauen in der DDR Familie und Beruf viel selbstverständlicher nebeneinander existieren. Diese Differenzen können mit den unterschiedlichen Lebenserfahrungen von Frauen in den beiden Gesellschaften erklärt werden. Die Erfahrung einer finanziellen Absicherung durch eigene Erwerbstätigkeit, eines garantierten Arbeitsplatzes und einer in der Regel gesicherten Kinderbetreuung, aber sicherlich auch der Einfluss der staatlich bevorzugten Norm einer hohen Erwerbsintegration der Frau haben dazu geführt, dass das Modell der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Osten als wünschenswert angesehen wurde.
Die Ablösung von der Herkunftsfamilie und das entsprechend frühe binden an einem Partner bzw. Familiengründung fand früh statt. Die Ursachen dafür können hier nur unvollständig diskutiert werden. So wird vermutet , dass die Kürzeren Ausbildungszeiten und der Übergang vom Ausbildungs- in das Beschäftigungssystem, die relative Sicherheit des Arbeitsplatzes, die staatliche bzw. auf Betriebsebene organisierten Formen der Kinderbetreuung , die Freiräume, die Müttern im Beruf für die Haushaltsführung und Kinderbetreuung geboten wurden einer der Gründe ist.
Die allein erziehenden Mütter hat eine große Unterstützung für sich und das Kind erhalten.
Sie sollte problemlos in den Arbeitsprozess eingeführt werden. Das selbe galt auch für unverheiratete Paare. Die Mutter konnte trotzdem die gleichen Förderungen erhalten als wenn sie alleinerziehend wäre. Sie konnte sich bezahlt Freistellen , wurden bei der Vergabe von Kindergartenplätzen bevorzugt. Der Vater eines unehelichen Kindes wurde entweder durch Anerkennung der Vaterschaft oder durch gerichtliche Entscheidung festgestellt. Als Vater kann festgestellt werden , wer innerhalb der Empfängniszeit mit der Mutter geschlechtlich verkehrt hat. Ist die Vaterschaft eines anderen Mannes wahrscheinlicher, kann das Gericht diesen als Vater feststellen. Das Gericht trifft seine Entscheidung nach der Einholung eines Blutgruppengutachtens und, wenn das nicht ausreicht, eines erbbiologischen Gutachtens. In extremen Fällen, in denen das Beweisergebnis so wenig aussagekräftig ist, dass die Vaterschaft von 2Männern gleichermaßen wahrscheinlich ist, wurde vom Gericht als Vater Festgestellt, wer von der Mutter des Kindes verklagt worden ist. Dabei ging der Gesetzgeber davon aus , dass das Interesse des Kindes Vorrang haben muss vor allen anderen Interessen. Das Familiengesetzbuch kannte deshalb die Einrede des Mehrverkehrs nicht Einer musste auf jeden Fall zahlen.
Ein Kind dessen Eltern bis seiner Geburt nicht mit einander verheiratet sind , erhielt den Familiennamen der Mutter. Wenn die Eltern nach der Geburt des Kindes heirateten, bekam das Kind den Familiennamen , den die Eltern führten.
Mit neuen erbrechtlichen Bestinnungen hat das Familien Gesetzbuch jegliche Zurückstellung außerehelicher Kinder auch in vermögensrechtlicher Hinsicht beseitigt. Ein Kind , das außerhalb der Ehe geboren wurde, erbte beim Tode seines Vaters oder seiner Gr0ßeltern väterlicherseits wie ein während der Ehe geborenes Kind. Dies allerdings mit der Einschränkung, dass das Kind noch minderjährig war. Aber auch seinen Vater, wenn es unterhaltsbedürftig war , wenn der Vater bis zur Volljährigkeit das Erziehungsrecht hatte oder wenn das Kind während der Minderjährigkeit überwiegend im Haushalt des Vaters gelebt hatte. Hinterlässt der Vater ein Testament, so hat das Kind einen Pflichtteilanspruch gegen die Erben des Vaters.
In der ehemaligen DDR hat man seit 1949 versucht gegen die Diskriminierung der unverheirateten Mütter anzukämpfen . Und das auch mit Erfolg . Denn in der damaligen DDR gab es eine hohe Rat an unverheirateten Paaren mit Kindern . Es wurde eine Untersuchung durchgeführt zu dem Aktivitätsstatus von Männern und Frauen der vier Kohorten (Kohorten , damit sind die Geburtenjahrgänge der Eltern gemeint. 1929-31, 1939-41, 1951-53, 1959-61 siehe auch Diagramm nächste Seite) zur Zeit der Geburt des ersten Kindes. Es ist angegeben, mit welchen Anteilen die Männer und Frauen zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes erwerbstätig, in Ausbildung oder weder erwerbstätig noch in Ausbildung gewesen sind. Dabei wurde jemand nur dann als nichterwerbstätig und nicht in Ausbildung befindlich klassifiziert, wenn dieser Zustand mindestens sieben Monate andauerte. Kürzere Unterbrechungsphasen wurden damit von vornherein ausgeschlossen. Der Anteil der Frauen, Die während einer Ausbildung zum ersten mal Mutter werden , steigt über die Kohorten hin an und ist im Vergleich zu Westdeutschland zum Schluss bemerkenswert hoch. Dieses Verhalten ist nicht nur momentaner vorteile oder Absicherungen geschuldet, sondern nur möglich, wenn man schon zu diesem Zeitpunkt auch über stabile Zukunftserwartungen verfügte, die das langfristige Risiko einer Elternschaft minimal erscheinen ließen.
Überraschend ist aber, welch hoher Anteil der befragten Frauen der jüngsten der von uns befragten Kohorten im Zusammenhang mit der Geburt des ersten Kindes für einen Zeitraum den Erwerbsprozess verlassen haben , der über den gesetzlichen Schwangerschafts- und Wochenurlaub hinausgeht der mindestens acht Monate beträgt. Der Anteil beträgt bei den weiblichen Befragten der Kohorte 1959-61 fast 50%. Dieser hohe Anteil von Frauen mit einer Erwerbsunterbrechung von mehr als sieben Monaten ist nicht auf die Inanspruchnahme des Babyjahres für erste Kinder zurückzuführen, die erst seit 1986 möglich war. Die durchschnittliche Dauer der registrierten Unterbrechungen ist in diese Kohorte allerdings im Unterschied zu den früheren Jahrgängen insgesamt sehr gering. Man kann feststellen, dass die Unterbrechungsraten mit dem Ausbildungsniveau nicht sehr entscheidend zurückgehen . Mit dem Bildungsniveau nimmt jedoch der Anteil erster Geburten während der Ausbildung stark zu . Er lag bei den Hochschulabsolventen/- innen der jüngsten der befragten Kohorten zwischen 35% und 45%. Das wäre in Westdeutschland undenkbar gewesen.
Es ergebt sich die Frage , wodurch der doch relativ hohe Anteil der Frauen in den jüngeren Kohorten, die , die Erwerbstätigkeit über die Zeit des gesetzlichen Schwangerschafts- und Wochenurlaubs hinaus verlassen haben, bedingt gewesen sein mag. Ein Grund dürfte die zu Anfang der Achtziger Jahre doch noch relativ lückenhafter Versorgung der Kleinkinder mit Krippenplätzen gewesen sein . 1980 war der Bedarf, allerdings nicht allein bezogen auf erste Kinder gemessen , zu etwa 65% gedeckt. Danach muss man davon ausgehen, dass ein relativ großen Teil der ohnehin nicht sehr lang andauernden Ausstiege dadurch bedingt war, dass für das Kind kein Krippenplatz zur Verfügung stand. Immerhin dürfte auch ein Teil der Frauen eine unbezahlte Freistellung in Anspruch genommen haben, weil sie eine so frühzeitige Unterbringung der Kinder in einer Kinderkrippe nicht befürworteten. In beiden Fällen erhielten verheiratete Frauen jedoch keinen finanziellen Ausglich!
Kommen wir zurück zu der Frage, ob sich nicht hinter den hohen Nichtehelichenquoten eine Orientierung auf die Chance eines risikolosen, zeitweiligen Ausstiegs aus der Erwerbstätigkeit verbirgt, konnten doch unverheiratete Mütter unter bestimmten Bedingungen bezahlt den Beruf für eine Zeit bis zu drei Jahren verlassen. Das könnte eine Motivation sein. Doch die Untersuchung widerlegte dies. Es wurde der Aktivitätsstatus von Frauen der Kohorten1951-53 und 1959-61 bei der Geburt des ersten Kindes noch einmal danach unterschieden, ob die Geburt des Kindes ehelich oder nichtehelich war, und bei nichtehelichen Geburten, ob die Geburt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft erfolgt oder nicht. Nichtverheiratete Frauen verlassen den Beruf für eine Zeit, die über den gesetzlichen Schwangerschafts- und Wochenurlaub hinausging, weniger häufig als verheiratete Frauen. Der Anteil war bei Frauen, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten, etwas hoher als bei unverheirateten Singles . Bei den verheirateten Frauen in der Kohorte 1959-61 lag er dagegen bei fast 60%. Man kann daher kaum von einer „Instrumentalisierung“ der nichtehelichen Mutterschaft für die berufliche Lebensplanung ausgehen. Das Krankengeld als Lohnersatz dürfte bei Singles auch kaum gereicht haben und daher keinen Anreiz auf finanzielle Unterstützungen angewiesen. Wenn sie nicht erwerbstätig bleiben konnten. Diese gab es zum Beispiel aus dem Elternhaus oder vom Partner, wenn die Frauen in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft gelebt haben.
Mütter nichtehelicher Kinder haben auch ihre Bevorzugung bei der Krippenvergabe genutzt, Ihre Kinder gingen häufiger und länger in die Krippe als Kinder von verheirateten Frauen. Danach hat die Motivation zu einem bezahlten ausstieg and der Erwerbstätigkeit die Nichtehelichenquote wohl nicht befördert. Gleichwohl, zu einer Zeit , da man mit einem fehlenden Krippenplatz rechen musste, war man erheblich im Vorteil gegenüber verheiratete Frauen, zumal wenn man mit einem Partner zusammenlebte. So war es aus dieser Sicht in gewisser Weise optimal, eine Familien im Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu gründen. Die Heirat wurde fast immer nach wenigen Jahren nachgeholt.
Die Gründung einer eigenen Haushalts ist teil des Übergangs in ein sozial undökonomisch eigenständiges Leben. Ein wichtiger Faktor ist dabei die eigene Wohnung.
Wohnungen waren in der DDR bis zuletzt knapp und wurden zu großen Teil gemäss einer Prioritätenregelung nach der individuellen Bedarfslage und persönlichen Verdiensten zugewiesen. Eine eigene Wohnung konnte ab dem 18 Lebensjahr beantragt werden.
Auch wenn im Verglich zum westen der Anteil von jungen Frauen und Männern, die während einer Ausbildung oder vor dem Start einer Erwerbstätigkeit einen eigenen Haushalt gründeten, eher gering war , war der wirtschaftliche Status nicht das entscheidende Kriterium bei der Zuteilung von Wohnungen. Man kann davon ausgehen, dass eine Heurat bzw. eine Familiengründung eine sehr wichtige Voraussetzung war , um gute Chancen für die Zuteilung einer eigenen Wohnung zu haben . Junge Ehepaare gehörten zu einer bevorzugten Zielgruppe bei der Wohnungsvergabe. Die besondere staatliche Fürsorge für alleinstehende Mütter sorgte dafür, dass auch im Fall der geburt eines Kindes, ob mit oder ohne Eher , sich die Chance für eine eigene Wohnung beträchtlich vergrößerten, wenn auch zu einem deutlich geringeren Grad als bei der Ehe, wie entsprechende Schätzungen zeigen. IN jedem fall ist die These , wonach der frühe Start in eine Ehe und in die Elternschaft in der DDR auch h mit einer Vergabepraxis von Wohnungen zu tun hat, die traditionelle Lebensformen bevorzugt hat, überaus plausibel. Das gilt im übrigen bis in die frühen siebzigen Jahre hinein auch für die Alte Bundehrrepublik. Natürlich sind in der DDR eine Vielzahl anderer Faktoren bei der Wohnungsvergabe wichtig gewesen. So darf man zum Beispiel nicht vergessen, dass es eine zum Teilenge Kopplung zwischen beruflicher und regionaler Mobilität gegeben hat. Auch bei der Erstwohnung dürften Zugangschancen durch betriebliche Angebote verbessert worden sein.
Die Familienpolitik spielt in der Gründung einer Familie eine große Rolle. Denn damit sind die Leistungen des Staates verbunden die, die Existenz der Familie fördern. In der damaligen DDR , anders als in der BRD, gehörten zur Familienpolitik das Recht auf Arbeit und das Recht auf einen Arbeitsplatz genauso dazu wie die Steigerung des Lebensstandards, durch die Entwicklung der Wirtschaft und die Außenpolitik.
Es gab aber auch Familienpolitik als solches. Dazu zählte ein großer Teil deröffentlichen Erziehung der Kinder und die Maßnahmen des Staates zur Förderung von kinderreichen Familien. Mit den Einrichtungen von Krippen, Kindergärten und Schulhorten stieg der Anteil deröffentlichen Erziehung des Kindes gegenüber der Erziehung durch die Eltern sehr stark. Schon 1949 wurden ¾ Millionen Krippen und Kindergartenplätze geschaffen.
Die Kindergartenplätze wurden vom Staat getragen. Die Zuschüsse für den Kindergarten und das Essen im Hort reichen weit über eine Million hinaus. Die Eltern mussten nur einen Beitrag von 1.40 DM für die Krippe , 0.35 DM für den Kindergarten zahlen. Dieser Beitrag wurde noch reduziert wenn die Familie 3 oder mehr Kinder in den Kindergarten einschrieb. Die niedrigen Kindergarten Beiträge trugen auch dazu bei , dass viele Frauen trotz Kind ihren Beruf ausüben konnten.
Der DDR-Staat stellte erhebliche Mittel bereit, um den Kinderreichtum zu fördern.
Bei der Geburt des ersten Kindes gab es 1970 eine einmalige staatliche Zuwendung von 500DM , die sich bis zum dritten Kind auf 700DM , beim vierten Kind auf 850DM und bei jedem weiteren Kind auf 1000DM erhöhte. Außerdem gab es eine monatliche staatliche Unterstützung zwischen 20 und 70DM. Man muss bei den Beträgen bedenken , dass es vor 30 Jahren war und der Betrag mit den Jahren auch gestiegen ist. Das Kindergeld für eine Familie mit 6.Kindern betrug in der Zeit 3480DM im Jahr. Kinder aus Kinderreichen Familien , die studieren wollten, erhielten höhere Stipendien . Kinderreiche Familien wurden bei der Vergabe von Wohnungen der Kindergartenplätze oder Ferienplätzen in Erholungsheimen bevorzugt.
Die Betriebe haben Kindergärtenplätze Gegründet für die Mitarbeiter, so dass jedes Kind eines Angestellten ein Kinderplatz bekam. Es wurden auch Betriebsfreizeiten für Kinder organisiert. Diese Freizeit war günstig so dass jeder Mitarbeiter sich das leisten konnte seine Kinder in den Urlaub zu schicken . Es hatte auch noch den Aspekt , dass sich die Angestellten erholen konnten und dadurch auch effektiver arbeiten konnten. Um das Arbeitsklima zu verbessern wurden regelmäßig Ausflüge vom Betrieb veranstaltet . Wie ich schon vorher erwähnt habe, wurde im Gesetzbuch der Arbeit von 1961 im §129 hervorgehoben , dass die Ausübung schwerer körperlichen Arbeit für die Frau nicht erlaub sei. Sowie die Gleichberechtigung der Frau im Betrieb , das bezeiht sich auf den gleiche Lohn, die Förderung der Frau durch den Betrieb sowie die Ausübung jeglichen Berufes.
Im Familiengesetz §2 wird betont, dass sich der Charakter der Familie durch die Gleichberechtigung von Mann und Frau sich erst richtig bildet. Die Ehepartner sind verpflichtet ihre Beziehung so zu gestallten, dass beide ihre Begabung und Fähigkeit vollentfallen können und dass sie sich dabei auch unterstützen. In der Arbeitspolitik wurde nicht nur die Bildung der Frau im Betrieb gefördert , sonder auch die Mutter. Als Schwangere Mutter konnte sie einen leichtere Arbeit für die Zeit der Schwangerschaft ausüben und die Differenz beim Lohn wurde ihr auch ersetzt.
Eine alleinerziehende Mutter hatte noch besondere Unterstützung bekommen.
Es wurde ein Gesetzt speziell für die alleinerziehende Mutter errichtet. Diese Regelungen sollten sichern , dass auch alleinstehende Mütter problemlos im Arbeitsprozess integriert bleiben konnten Aus familienpolitischer Sicht widersprechen sie eher dem seit Mitte der sechziger Jahre offiziell propagierten Bild eines im Grunde bürgerlichen Familienideals. Zu den Regelungen gehörten:
Seit 1972 bestand die Möglichkeit einer bezahlten Freistellung von der Berufstätigkeit für den Fall , dass man keinen Krippenplatz für das Kind fand oder das Kind krippenuntauglich war. Als Bezahlung bekam man das gesetzliche Krankengeld, mindestens aber 250DM bei einem Kind. Eine entsprechende, wenn auch nicht gleichwertige, Möglichkeit wurde für verheiratete Frauen erst 1986 mit dem „Babyjahr“ schon für das erste Kind eingeführt.
Die Kinder alleinstehender Mütter wurden bei der Vergabe von Krippenplätzen bevorzugt berücksichtigt. Seit 1967 gab es die Möglichkeit für alleinerziehende Mütter , auch im Fall längerer Krankheit des Kindes zu dessen Betreuung zu Hause zu bleiben , wobei dafür Krankengeld für die Mutter gezahlt wurde zwischen 65% und 90% des Nettoverdienstes, ja nach Kinderzahl. Für verheiratete Mütter gab es eine entsprechende Regelung erst ab 1984 und dann auch nur für Mütter mit drei oder mehr Kindern. Es gab ein höheres Kindergeld für alleinstehende Mütter . Allerdings nur 25DM mehr. Seit 1972 gab es besondere materielle und immaterielle Unterstützungsleistungen für Mütter, die sich noch in der Ausbildung befanden.
Dies sind bestimmt nicht alle politische Förderungen die es vom Staat gab , aber es sind die , die mir bekannt s
Fazit
Der Staat hatte eine Ideologie in der die Familie einen Hohen Stellenwert hatte und nicht nur die Familie sonder auch die Frau. Das lässt sich aus den einzelnen Punkten die ich im Text aufgeführt habe schließen. Z. B die Umstellung der Landwirtschaftlichen Maschinen für eine leichter Bedienung . Dann wurden Frauenförderungspläne entwickelt, die durch Kommissionen des Ministerrates überprüft wurden. Dazu wurde ein Frauenausschuss in jedem Betrieb und in jeder Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen gegründet.
Der Schutz der Frau und der Frau als Mutter wurde im Gesetz stark betont. Und sie bekam Unterstützung durch den Staat bei Kinderbetreuung durch Kindergartenplätze und Krippen. Und auch Erziehungsgeld in den ersten Monaten nach der Geburt. Sie hatte auch die Kündigungsschutz und wenn sie nach der Beurlaubung wieder Arbeiten wollte stand ihr ihre alte Arbeitsstelle wieder zur Verfügung. Man brauchte sich keine Gedanken zu machen das man Arbeitslos wurde und seine Familie nicht unterhalten konnte. Denn dafür sorgte der Staat. Denn jeder hatte ein Recht auf arbeit und bekam sie auch . Man konnte ohne Bedenken eine Familie Gründen ohne die Ausbildung beendet zu haben , weil man vom Staat eine Wohnung zur Verfügung bekam . Was für alleinstehende schwieriger war eine Wohnung zu erhalten. , und für den Arbeitsplatz war auch gesorgt. Durch den geringen Freiheiten die in der DDR wie zum Beispiel Reiseeinschränkung, oder Versammlungsfreiheit. Sowie beschränkte Informationen und dadurch begrenzte Entfaltung des Individuums , war die Familiengründung oft eine der einzigen Lösungen die den jungen Menschen blieb. Denn sogar beim Studium konnte man nur als Paar im Wohnheim wohnen wenn man verheiratet war.
Und wenn man schon sich für die Familie entschied dann musste man nicht auf die Berufskarriere verzichten, was ja für viele in der BRD ein Argument war die Familiengründung zu verzögern oder gar keine Familien zu gründen. Im Grunde genommen war die Hohe Förderung der kinderreichen Ehen eine Entwicklung die in den 60er Jahren weiter fortgeschritten war als in der DDR. Also auch ein gutes Beispiel dafür , dass nicht alles im Sozialismus schlecht war.
Stellungnahme zum Text
Ich habe mich mit diesem Thema befasst , weil ich mir meine eigene Meinung über den Sozialismus in der DDR bilden wollte. Denn es wird viel schlechtes über den Sozialismus gesprochen. Ein Hauptargument war , dass der Sozialismus die Familie zerstört. Ich glaube dass damit die hohe Arbeitsaktivität der Frau gemeint wurde. Denn dadurch wurden die Kinder sehr früh in eine Kinderkrippe gegeben. Das Kind hatte dadurch nicht lange einen innigen Kontakt zu Mutter. Ich weiß nicht was für Auswirkungen das auf das Kind und die Entwicklung hat . Denn das wurde noch nicht richtig erforscht , was es für Unterschiede zwischen dem Verhalten der West- und der Ostdeutschen gibt.
Ich glaube dass die Kinder zu früh in die Krippe geschickt worden sind, den in den ersten zwei bis drei Jahren ist die Bindung zur Mutter oder Vater sehr wichtig . Wenn das Kind täglich in so jungen Jahren , mit vielen Menschen zutun hat , zu den es keine Persönliche Beziehung hat , dann fehlt ihm was. Was aber gut war , das sind die vielen Kindergärten gewesen. Denn jeder konnte sich einen Kindergartenplatz leisten und dadurch seinen alten Beruf nachgehen. Fürs Kind ist es in meinen Augen auch wichtig das Kind im Kindergarten anzumelden . Denn dadurch wird es sozialer erzogen. Der Staat hatte großes Interesse daran , dass alle Kinder einen Kindergarten besuchten . Deshalb hat er auch die Kosten getragen. Denn der Sinn des Kindergartens war: Neben der infrastrukturellen Unterstützung und politischen Förderungen der Gleichzeitigkeit von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit kontrollierte und übernahm der Staat in der DDR in den Betreuungseinrichtungen auch Sozialisationsfunktionen. Eine der Staatsaufgaben zielte auf die Erziehung von Kindern zur „Sozialistischen Persönlichkeit“ ab. Aus diesem doppelten Interesse heraus, nämlich Einbeziehung der Mutter in den Arbeitsprozess und Kontrolle über die Erziehung der nachwachenden Generation, war es eine politische Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit, dass der Staat entsprechende Möglichkeiten bereitstellte.(Schneider, N, Tölke, A.,Nauck, B., 1995, S.2)
Durch die begrenzten Möglichkeiten die der Staat bot und die Reisebeschränkungen war die Kontrolle von der Seite des Staates sehr wichtig.
Die Lebensmittel und andere Güter waren sehr beschränkt zu erwerben . Es gab keine große Auswahl . Viele politische Bücher wurden verboten , sowie die Westdeutschen Medien. Denn wie das Sprichwort sagt: „was er nicht weiß , macht ihn nicht heiß“. Es sollten so wenig wie möglich Informationen aus den westlichen Ländern strömen . Was nur relevant war , das waren die Informationen aus dem Ostblock. Denn die Gefahr währe viel zu groß dass das Volk auswandern könnte und das würde die Auflösung des Staates bedeuten . Dadurch gab es die Beschränkungen.
Die Unzufriedenheit der Bürger stieg in der letzten Jahren der DDR enorm .
Denn die Errichtung vieler Kindergärten , Horten , Krippen, und Kinderkrankenhäuser wurde vom Staat finanziert. Genau wie wie sie die Kosten jedes einzelnen Kindes das in diesen Institutionen untergebracht wurde trugen. Das führten im Laufe der Jahren zur hoher Belastung der Staatsgeldes. Ein weiterer Grund war die Einstellung jedes einzelnen berufsfähigen Bürgers. Da im Gesetz deutlich gemacht wurde , dass jeder ein Recht auf einen Arbeitsplatz hat wurden für jeden auch Arbeitsplätze geschaffen . Dadurch entstanden viele Arbeitsplätze die unnötig waren . Er wurde auf die Entwicklung der Technik verzichtet , weil das zuviel Arbeitsplätze kosten könnte. Also blieb man bei veralterten Technologien. Leider entfernte sich der Staat dadurch um so mehr von der fortschrittlichen Entwicklung. Die DDR war nicht mehr Erfolgreich auf dem Internationalen Markt und dadurch schrumpfte laufend der Geldbeutel des Staates. Das Land hatte kein Geld mehr um sich weiter zu entwickeln . Mit den Geldproblemen stieg auch die Staatskontrolle , was auch verständlich wurde.
Die DDR hatte gut Idee mit der hohen sozialen Leistungen . Das Leben war gesichert. Man brauchte sich keine Gedanken zu machen , dass man morgen arbeitslos werden konnte.
Nicht wie bei der heutigen Marktwirtschaftlichen Konkurrenz. Dort hatte jeder eine Reale Chance in der Ausbildung und im späteren Arbeitslauf. Man musste nicht konturieren. Das gute an dieser Staatsführung war auch , die Förderung der Familie. Der Staat hatte vieles geleistet um das Familienleben schmackhaft zu machen . Durch die Bevorzugung bei der Wohnungswahl fing dies schon an . Denn jeder der verheiratet war und ein Kind hatte , bekam eine Wohnung. Das war ein großen Vorteil denn in der DDR gab es keinen freien Wohnungsmarkt . So wie die Heirat während des Studiums , damit man im Wohnheim zusammen wohnen konnte, und bei der Vergabe von Arbeitsplätzen hatte man dadurch die Sicherheit , dass man nicht an verschiedene Orte vermittelt wurde. Ich finde , dass die Familie sehr wichtig ist und der Zusammenhalt , genau wie die Gründung der Familie.
Ich gehe davon auch aus , dass Ehepaare ohne Kinder , die sich auch kein Kind wünschen kein erfülltes Leben führen. Natürlich bestreiten sie dass, doch wieso schaffen sich viele solcher Paare eine Hund an . Das ist doch nur um jemanden zu haben dem man etwas beibringen kann und um Verantwortung zu übernehmen. Ich sehe es all Bequemlichkeit keine Kinder im Haushalt zu haben . Denn Kinder ist keine leichte Sache und es eine Verantwortung fürs Leben. Doch meistens wird man auch irgendwann belohnt für die Mühe der Erziehung. Dann hat man jemanden der sich um einen kümmert beim älter werde. Es gibt auch solche Paare die auf die Karriere nicht verzichten wollen, deswegen treffen sie die Entscheidung auf die Kinder zu verzichten. Das ist auch verständlich denn es muss sowieso nur die Frau im so einem Falle , auf die Karriere verzichten. Und wer will sich schon nur mit einem kleinen Beruf begnügen wenn ein anderes Ziel anstrebte. In der BRD war die Frau lange Zeit sehr unterdrückt gewesen. Was man von der DDR nicht behaupten kann. Denn der Sozialismus hat das Ziel Männer und Frauen gleich zu behandeln. Dieser Gedanke wurde von Marx und Engels formuliert. Sie gingen davon aus dass jeder Mensch egal ob Männlich oder Weiblich , an der körperlichen geistigen Entwicklung teilnehmen muss. Sonst wird er kein vollkommender Mensch und kann sich dadurch nicht in die Gemeinschaft fügen. Die Beschränkung der Frau auf das Magische Dreieck von Küche, bett und Wiege hat zur Verkrüppelung der Anlagen dieser Teils der menschlichen Gesellschaft geführt. (Plat, Wolfgang, 1973,S.379, Satzzitat). Dieser Satz ist sehr wichtig für die Entwicklung der Frauenrechte gewesen.
Die Durchführung dauerte sehr lange. Wenn man überlegt dass über 150 Jahren die Gleichberechtigung der Frau mit dem Mann gefordert wurde. Die liberale bürgerliche Frauenbewegung, genau wie die bürgerliche Demokratie forderten die Gleichberechtigung, doch nur der Sozialismus hat konsequent dies gefordert und auch das Ziel erreicht.
Die DDR hat , u die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau durchzusetzen, allein in den ersten 10 Jahren Ihres Bestehens, Milliardenbeiträge für die Bildung der Frau, für Mütter- und Kinderschutz und für dieöffentliche Erziehung der Kinder aufgewendet. In der BRD wurden zwar auch Gesetze errichtet zur Gleichberechtigung , doch er wurde nicht wirklich unternommen um dieses Gesetz zu stützen. Denn freiwillig würde nichts passieren. Keiner der Betriebe in BRD würde freiwillig Frauenförderungspläne entwickeln.
Alle Frauen die in der DDR wohnten konnten sich glücklich schätzen das sie alle so unterstütz wurden .
Der Fortschritt war meiner Meinung auch die hohe Akzeptanz der allein erziehenden Mütter in der Gesellschaft, sowie die nichteheliche Partnerschaft. In der BRD war das bis in den 80er Jahren selten und auch nicht gut anzusehen wenn die Mütter alleinerziehend waren oder Paare Kinder hatten aber nicht heirateten. In der DDR waren in den 80er Jahren viele nichteheliche Kinder und Tendenz für Partnerschaft ohne Ehe stieg. Sie war zu dem Zeitpunkt höher als in Westdeutschland. Ich glaube das dies auch etwas mit der Religion zutun hatte. Denn in den Sozialistischen Staaten wurde die Religion sehr untergegraben. Eine Ausnahme ist Polen gewesen. Es wurden durch den Staat andere Riten eingeführt die den Riten der christlichen Religion sehr ähnelten. Die Taufe wurde beibehalten, und statt Konfirmation gab es Jugendweihe. Dadurch das die Religion nicht mehr im Vordergrund stand war das heiraten für viele nicht mehr wichtig. Denn heiraten ist eine Tradition die sich auf den Glauben beruht, und von Gesetz übernommen wurde. Doch laut Gesetz ist es nicht Pflicht zu heiraten also haben es viele Leute auch gelassen. In der BRD fand die Ablösung von der Kirche erst in den 80ern statt. Seit dem häufen sich die verschiedensten Lebensformen, die es gibt. Viele Menschen vergessen die guten Seiten des Sozialismussees und haben nur vor Augen wie schlecht die Wirtschaft mit den Jahren wurde und das es wo anders immer besser sei als dort wo man lebt. Jetzt klagen viele Ostdeutschen darüber , dass sie es in der DDR besser hatten. Also da sieht man das wieder . Man konnte ein gutes Leben in der DDR führen wenn man sich politisch gefügt hatte . Man durfte seine Meinung nicht in deröffentlichkeit gegen das Politische Regime äußern . Doch was man dachte , das musste keiner wissen. Also wenn man sich der Gesellschaft fügte, dann hatte man ein Gutes gesichertes Leben geführt.
Wie man sieht kann man nicht behaupten , dass das Konzept auf dem sich die Staatsführung stützte , gut oder schlecht war . Denn das wäre eine Schwarz-Weiß Malerei , dabei gab es zu viele Grautöne. Ich finde die Grundidee die von Marx und Engels entwickelt wurde sehr gut. Die Förderungen war eine sehr interessante Entwicklung gewesen, doch leider hat es nicht so geklappt wie sollte.
Dafür gab es viele Gründe . Die Menschen waren aber daran Schuld. Es hat auch nirgendwo auf der Welt geklappt einen sozialistischen Staat aufrechtzuerhalten. Das ist eine Überlegung , denn wieso es nicht funktionierte , dafür gab es viele verschiedene Gründe. Es fängt mit den Wirtschaftlichen Problematiken die sich im laufe der Zeit entwickelten , Finanzieller Mangel des Staates, dadurch die Freiheitsraubung. Aber auch jeder einzelne führte zur Unzufriedenheit der Gesamtheit bei. In der DDR funktionierte fast alles nur noch durch Beziehungen. Es fing bei einfachen Einkäufen an. Da vieles begrenzt war haben viele Leute sich Schlupflöcher gesucht , wie sie besser an die Waren herankommen konnten. „Vitamin B“ war das wichtigste, auch in der Karriere. Wenn man Beziehungen hatte, konnte man schneller an bestimmte Stellungen heran als ohne. Man wurde bevorzugt behandelt. Nicht jeder Mensch war vor dem Gesetz gleich , wie es eigentlich sein sollte . Es gab gleiche Menschen und es gab welche , die gleicher waren. Also ich schließe daraus das die Menschen nicht reif für so eine Staatsführung sind. Vielleicht wird die Menschheit das irgendwann begreifen.
Quellen
Brockhaus Enzyklopädie
Meyer Pädagogisches Lexikon
Claessens, D., Milhoffer, P., Familiensoziologie , Ein Reader als Einführung, (1973), Frankfurt am Main,
Nauk, B., Schneider, N., Tölke, A., Familie und Lebensverlauf im gesellschaftlichen Umbruch, (1995), Stuttgart,
Familie und Gesellschaft
Wintersemester 1999/2000
FH NON
FB Sozialwesen
Hausarbeit zum Thema:
Familie in der DDR
Linda Orzechowska
Häufig gestellte Fragen zu "Familie in der DDR"
Was ist das Hauptthema der Hausarbeit "Familie in der DDR"?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Familie in der ehemaligen DDR, wobei der Fokus auf der Entwicklung der Frau als Mensch und ihrem Stellenwert in Familie und Gesellschaft liegt. Die Recherche basiert auf empirischen Studien von der Gründung der DDR bis zur Wiedervereinigung.
Wie wird der Begriff Familie definiert?
Die Arbeit beleuchtet die Herkunft und Geschichte des Begriffs "Familie" aus dem Lateinischen und die verschiedenen philosophischen und historischen Auffassungen von Familie, von Aristoteles bis zur modernen Kleinfamilie. Die moderne Definition beschränkt sich auf eine soziale Gruppe, bestehend aus Mann und Frau mit ihren unverheirateten Kindern, die zusammenleben und ihren Lebensunterhalt teilen.
Wie unterschied sich die Familienpolitik in der DDR von der in der BRD?
In der DDR wurde die Gleichberechtigung der Geschlechter durch Gesetzgebung und praktische Maßnahmen konsequent gefördert. Frauen hatten das Recht, jeden Beruf auszuüben und wurden bei der Qualifizierung unterstützt. In der BRD verliefen diese Schritte zögerlicher, und es gab bis 1968 kaum Änderungen im Familienrecht.
Welche Rolle spielte die Frau in der sozialistischen Gesellschaft der DDR?
Die Gleichberechtigung der Frau wurde in der DDR durch die Teilnahme am Arbeitsprozess und die Mitwirkung an der Leitung von Staat und Wirtschaft verwirklicht. Die Talente und Fähigkeiten der Frauen wurden als integraler Bestandteil derökonomischen, sozialen, geistigen und kulturellen Aufgaben der Gesellschaft gefördert.
Welche Schutzmaßnahmen und Förderungen gab es für arbeitende Mütter in der DDR?
Schwere körperliche Arbeit, die die Gesundheit der Frau schädigen konnte, wurde verboten. Schwangere und stillende Mütter erhielten besonderen Schutz und durften keine gesundheitsgefährdenden Arbeiten ausführen. Es gab Mutterschaftsurlaub, Stillpausen, Kündigungsschutz und Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
Wie wurde die Gleichberechtigung in Ehe und Familie in der DDR umgesetzt?
Beide Ehepartner waren verpflichtet, die Beziehung so zu gestalten, dass beide ihre Begabungen und Fähigkeiten voll entfalten konnten und sich dabei gegenseitig unterstützen. Die traditionelle Arbeitsteilung wurde aufgehoben, und sowohl Mann als auch Frau beteiligten sich an der Haushaltsführung und Kindererziehung.
Wie beeinflusste die staatliche Kontrolle das Familienleben in der DDR?
Die Familie war nicht der private Rückzugsraum, in dem sich die Menschen individuell entfalten konnten, sondern eine von staatlichen Einflussversuchen durchdrungene Lebensphase. Arbeitskollektive, Haushaltsgemeinschaften und staatliche Eingriffe beeinflussten das Familienleben und verhinderten, dass sich Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten im Familien- und Privatbereich unabhängig entwickeln konnten.
Welche Unterschiede gab es in der Familiengründung zwischen Ost- und Westdeutschland?
In der DDR erfolgte die Familiengründung deutlich früher als im Westen, was auf einen anderen Status von Familie im Lebenslauf hinweist. Im Osten deutete die Familiengründung den Einstieg in ein "eigenes Leben" außerhalb gesellschaftlicher Lenkung. Im Westen war die spätere Familiengründung oft der Preis für eine individuelle Lebensführung.
Welche Hypothesen gibt es für den hohen Stellenwert der Familie in der DDR?
Mehrere Hypothesen werden genannt, darunter die staatliche Propagierung der Ehe und Kleinfamilie, die frühe Familienbildung als gesellschaftliche Norm, die Trennung des Privaten Lebens von der Öffentlichkeit, die begrenzte Vielfalt an Lebensmöglichkeiten, die frühe Sicherheit in Bezug auf die Existenz der Familie und der Zugang zu öffentlichen Gütern wie Wohnungen.
Welche Rolle spielte die Familienpolitik bei der Gründung einer Familie in der DDR?
Die Familienpolitik umfasste das Recht auf Arbeit, die Steigerung des Lebensstandards und dieöffentliche Erziehung der Kinder. Es gab erhebliche staatliche Zuwendungen für kinderreiche Familien, wie einmalige finanzielle Hilfen und monatliche Unterstützung.
Wie wurden allein erziehende Mütter in der DDR unterstützt?
Allein erziehende Mütter erhielten besondere Unterstützung, um problemlos in den Arbeitsprozess integriert zu bleiben. Sie konnten bezahlt freigestellt werden, wurden bei der Vergabe von Kindergartenplätzen bevorzugt und erhielten Krankengeld bei Krankheit des Kindes.
Was war das Fazit der Hausarbeit?
Der Staat hatte eine Ideologie, in der die Familie und die Frau einen hohen Stellenwert hatten. Der Staat sorgte für die Kinderbetreuung, Kündigungsschutz und die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der Beurlaubung. Im Gegenzug war die Familiengründung oft eine der wenigen verbleibenden Optionen für junge Menschen angesichts von Reisebeschränkungen und begrenzten Freiheiten in der DDR.
- Quote paper
- Linda Orzechowski (Author), 2001, Familie in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99714