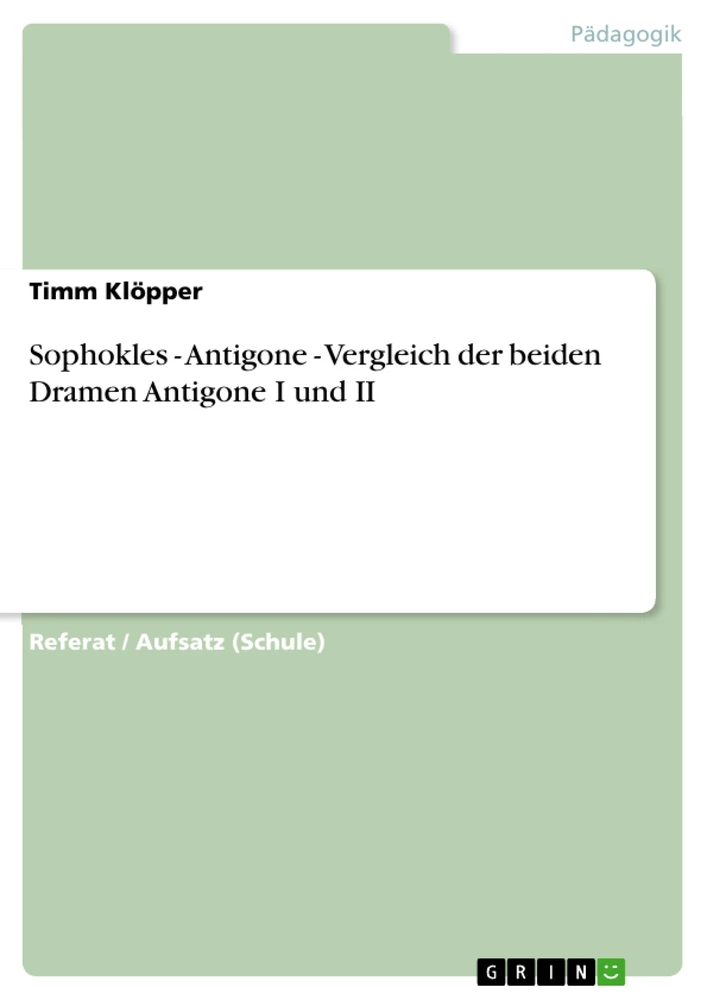Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht und vergleicht die beiden Dramen "Antigone" von Jean Anouilh (1942) und Sophokles (442 v. Chr.), wobei der Fokus auf den sprachlichen, stilistischen und inhaltlichen Unterschieden liegt. Das Ziel ist es, die Modernisierung und Interpretation des antiken Mythos durch Anouilh zu analysieren und mit der klassischen Version von Sophokles zu kontrastieren.
Der Vergleich der beiden Dramen beginnt mit einer klaren Differenzierung zwischen dem antiken Werk von Sophokles und der Neuinterpretation von Jean Anouilh. Anouilh modifiziert bewusst die Handlung und den Stil, um das Stück zu modernisieren.
Die Untersuchung der Dialogführung zeigt, dass Sophokles durch lange Repliken und Stichomythie (Schlagabtausch) gekennzeichnet ist, während Anouilh einen ausgeglicheneren Dialogstil aufweist. Sophokles schafft durch dialektische Konflikte und Monologe eine dramatische Spannung, während Anouilh eher auf Überzeugungsgespräche setzt.
Die Bühnenhandlung und Sprachanalyse offenbaren weitere Unterschiede. Sophokles präsentiert eine geschlossene Bühnenhandlung mit emphatisch-pathetischer Kunstsprache, die emotionale Resonanz beim Publikum hervorrufen soll. Anouilh dagegen verwendet eine Umgangssprache mit individuellen Ausdrucksweisen und einer situativen Sprachwahl.
Die Argumentationsweisen der Figuren differieren ebenfalls. Sophokles' Charaktere beziehen sich auf göttliche Gebote und übergeordnete Normen, während Anouilh eine Verständnislosigkeit und persönliche Sturheit zwischen den Figuren zeigt, ohne klare Verweise auf Werte oder Ordnungen.
Im zweiten Teil der Arbeit wird auf den Inhalt und die Figuren der Dramen eingegangen, wobei die gesellschaftlichen Rollen, moralischen Normen und psychologischen Dimensionen der Charaktere analysiert werden, um die Unterschiede zwischen den Interpretationen herauszuarbeiten.
Untersuchung und Vergleich der beiden Dramen ,,Antigone" von Jean Anouilh (1942) und Sophokles (442 v. Chr.)
Einleitend ist klarzustellen, dass es sich beim Drama von Jean Anouilh um eine Wiederaufführung des Stückes ,,Antigone" handelt. Da das Original von Sophokles 2000 Jahre früher geschrieben wurde ist es verständlich, dass sich die beiden Dramen in Sprache, Stil und teils Inhalt unterscheiden. Wobei man anmerken muss das Anouilh seine Version bewusst verändert hat um sie zu modernisieren.
Während beim Drama von Sophokles sich die Dialogführung einerseits durch lange Repliken anderseits durch den ständigen Schlagabtausch (Stichomythie) auszeichnet, ist im Drama von Jean Anouilh die Dialogführung bzw. die Länge der Repliken ausgeglichener.
Durch Verhöre vom König Kreon und Botenberichte erzeugt der Verfasser beim älteren Stück lange Dialoge (teils Monologe). Er schafft einen Konfliktaufbau durch eine dialektische Gegenüberstellung der Position von Protagonist und Antagonist. Dieses erzeugt ein ständiges hin und her von Rede und Gegenrede (Konfliktaustragung), man spricht allgemein von einem aktionistischen Dialog. Im neueren Drama vom Verfasser Anouilh ist jedoch keine klare Gliederung nach der Einleitung zu erkennen Es handelt sich nicht um eine dialektische Gegenüberstellung der Positionen und es ist keine Konfliktzuspitzung, wie bei Sophokles, zu erkennen. In diesem Drama handelt es sich eher um ein Überzeugungsgespräch und nicht um einen aktionistischen Dialog.
Die Bühnenhandlung (Handlungsebene) ist beim älteren Stück insgesamt geschlossen, selbst die Bemerkung des Chorführers richtet sich nicht, wie sonst üblich, ans Publikum. Das Stück von Anouilh hingegen wird durch die Einleitung und den Gebrauch eines Sprechers in der Handlungseben aufgebrochen, da er sich in der Funktion eins Erzählers direkt an das Publikum wendet. Gleichzeitig findet in diesem Stück jedoch auch eine Distanzierung zum Publikum statt.
Bei der Sprachanalyse handelt es sich beim altertümlichen Stück um ein rhetorische Kunstsprache mit einem emphatisch-pathetischen Ton. Es ist auf keinen Fall ein individuelle Sprache. Der Ton soll die Zuschauer zu Emotionen erregen und ein Einfühlen in die Figuren ermöglichen. In der Sprachabsicht ist keine Situationsabhängigkeit zu erkennen. Beim modernen Antigone hingegen ist die Sprachwahl hauptsächlich Umgangs -und Alltagssprache. Besonders auffällig ist die individuelle und situationsabhängige Sprach -und Wortwahl der Figuren (z.B. die Wächter untereinander im vergleich zum König Kreon gegenüber).
Auch die Argumentationsweisen der Dialogpartner in den beiden Dramen unterscheiden sich. Während bei Sophokles die Thesen und Forderungen dominieren und sich die Argumente hauptsächlich auf verbindlich gehaltene Werte beziehen (z.B. die göttlichen Gebote von Zeus und Dike) ist es bei Anouilh' s Antigone schwer eine Argumentationsstruktur festzustellen. In Anouilh' s Stück herrscht eine Verständnislosigkeit zwischen Antigone und Kreon, dass resultiert aus der Sturheit und Naivität Antigones die sich nicht auf Kreon's Überredungsversuche einlässt. Hierbei gibt es ein Parallele zum ältern Stück, wo sich beide eigentlich über die Sichtweise des anderen im Klaren sind, jedoch nicht bereit sind aufeinander zuzugehen und einzulenken. Außerdem ist klarzustellen, dass in Anouilh's Stück sich keiner der Charaktere auf Werte oder verbindliche Ordnungen beruft. Im zweiten Teil des Vergleiches der beiden Dramen wird mehr auf den Inhalt und die Figuren des Dramas eingegangen.
Im ersten Text ist die Beziehung der Dialogpartner sehr stark durch ihre gesellschaftlichen Positionen und die damit verbundenen Machtverhältnisse geprägt. Die Personen sind Handlungsträger, deren Identität lediglich aus der Zugehörigkeit zu ihrem Stand und ihrem Stellenwert in der religiösen Ordnung resultiert. Sie sind sehr stark an den Mythos gebunden und handeln nach übergeordneten Normen und Moralvorstellungen. In Sophokles´Antigone geht es nur um die gesellschaftliche Rollenverteilung nach denen sich die Personen konform verhalten. Kreon fühlt sich durch die Götter und die Rangordnung gezwungen in einer bestimmten Art und Weise zu handeln, da es halt so zu sein hat. In dem Dialog fehlt es an Menschlichkeit besonders Kreons und das Fehlen der psychologischen Dimension macht eine persönliche Beziehung der Personen unmöglich. In dem ersten Dialog wird sich sehr stark auf die handelnden Personen konzentriert und der Wächter beispielsweise wird nur auf seine Funktion reduziert.
Im zweiten Dialog hingegen wird sich sehr stark an einer persönlichen Beziehung orientiert statt an der gesellschaftlichen Stellung und religiösen Normen und Werten. Trotzdem wird kein gegenseitiges Verstehen erreicht. Die Personen haben nun keinen klaren Bezugspunkt mehr sondern handeln aus Menschlichkeit. Es besteht keine so starke Bindung mehr zu dem Mythos sondern die Dialogpartner besonders Kreon handeln nach eigener Meinung und Überzeugung. Kreon übernimmt eine Art Vaterrolle, da er Antigone als kleines Mädchen bezeichnet und sie nicht ernst nimmt. Er hält sie für naiv und möchte sie vor einer Strafe bewahren. In dem Dialog besitzen auch die Nebenfiguren eine größere Bedeutung, da sie mit ihren Interessen und Beziehungen dargestellt werden.
Im ersten Text haben die Protagonisten feste Motive die an ihre gesellschaftliche und religiöse Stellung gebunden sind. Kreon fühlt sich von höherer Stelle verpflichtet so zu handeln wie er es tut und hält sich lediglich strikt an die damaligen Moral- und Wertvorstellungen. Er bestraft eine damals als Sünde angesehene Tat, da das vom Volk und den Göttern erwartet wird. Antigone handelt aus purem Familienstolz und besitzt eine vom Volk leicht abweichende Weltvorstellung. Ihr ist allerdings bewusst, dass sie bestraft werden muss, gesteht aber dennoch die Tat.
Im zweiten Dialog betrachtet Antigone es als ihre Pflicht ihren Bruder zu beerdigen um den Stolz ihrer Familie zu bewahren. Obwohl Kreon aus rein menschlichen Motiven handelt und Antigone vor einer Strafe bewahren möchte besteht sie darauf als die Schuldige zu gelten und bestraft zu werden. Kreon versucht Antigone zu beeinflussen und ihr die Taten auszureden. Sie besteht sogar noch weiterhin darauf ihren Bruder zu beerdigen um ihren und den Stolz ihres Bruders zu wahren. Kreon versucht sogar Antigone den Glauben an den Götterritus auszureden, hat damit allerdings keinen Erfolg.
Der Dialog Anouilh´s wirkt um einiges lebendiger als der Text von Sophokles, da es sich um einen Dialog mit sehr viel Rede und Gegenrede handelt, der als Konfliktaustragung selbst Handlung ist. Beim zweiten Dialog handelt es sich um ein offenes Drama während Sophokles´ Antigone ein geschlossenes Drama ist. Er ist länger, da er nicht an den Mythos und das damalige Weltbild gebunden ist. Hier steht der Konflikt, also die Rede und Wiederrede im Vordergrund, während der erste Text durch das Gesellschaftsbild und die gesellschaftliche Rollenverteilung geprägt ist. Somit gibt es im ersten Dialog kaum eine Diskussionsgrundlage, da ja alles vorbestimmt ist und sich an die übergeordneten Werte und Normen gehalten wird. Aus der unterschiedlichen Darstellung des Kreons resultiert ein Teil der Länge des zweiten Textes. Es gibt, wie schon erwähnt, viele kürzere Statements die das Drama abwechslungsreich gestalten.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse der Dramen "Antigone" von Jean Anouilh und Sophokles?
Die Analyse vergleicht die beiden Dramen "Antigone" von Jean Anouilh (1942) und Sophokles (442 v. Chr.) hinsichtlich Sprache, Stil, Inhalt, Dialogführung, Bühnenhandlung, Argumentationsweisen und der Beziehung der Dialogpartner.
Welche Unterschiede gibt es in der Dialogführung zwischen den beiden Dramen?
Sophokles' Drama zeichnet sich durch lange Repliken und Stichomythie aus, während Anouilhs Drama eine ausgeglichenere Dialogführung mit weniger dialektischer Gegenüberstellung und Konfliktzuspitzung aufweist. Anouilhs Stück ist eher ein Überzeugungsgespräch.
Wie unterscheidet sich die Bühnenhandlung in den beiden Stücken?
Sophokles' Stück hat eine geschlossene Bühnenhandlung, während Anouilhs Stück durch die Einleitung und den Gebrauch eines Sprechers aufgebrochen wird, der sich direkt an das Publikum wendet.
Was sind die Unterschiede in der Sprachanalyse?
Sophokles verwendet eine rhetorische Kunstsprache mit emphatisch-pathetischem Ton, um Emotionen zu erzeugen. Anouilh verwendet hauptsächlich Umgangs- und Alltagssprache, wobei die Sprachwahl der Figuren individuell und situationsabhängig ist.
Wie unterscheiden sich die Argumentationsweisen der Dialogpartner?
Bei Sophokles dominieren Thesen und Forderungen, die sich auf verbindlich gehaltene Werte beziehen (z.B. göttliche Gebote). Bei Anouilh's Antigone ist es schwer, eine klare Argumentationsstruktur festzustellen; es herrscht Verständnislosigkeit zwischen Antigone und Kreon.
Wie werden die gesellschaftlichen Positionen und Machtverhältnisse in den Dialogen dargestellt?
Im Drama von Sophokles prägen die gesellschaftlichen Positionen und Machtverhältnisse die Beziehungen stark. Die Personen sind Handlungsträger, deren Identität aus ihrem Stand und ihrer religiösen Ordnung resultiert. In Anouilhs Drama orientiert man sich eher an einer persönlichen Beziehung statt an gesellschaftlichen Normen. Kreon übernimmt eine Art Vaterrolle und unterschätzt Antigone.
Wie unterscheiden sich die Motive der Protagonisten?
In Sophokles' Drama sind die Motive der Protagonisten an ihre gesellschaftliche und religiöse Stellung gebunden. Kreon fühlt sich verpflichtet, nach den damaligen Moral- und Wertvorstellungen zu handeln. Antigone handelt aus Familienstolz. In Anouilh's Drama möchte Kreon Antigone aus menschlichen Gründen vor einer Strafe bewahren, während Antigone auf ihrer Bestrafung besteht, um den Stolz ihrer Familie zu wahren.
Inwiefern ist Anouilh's Dialog lebendiger als der von Sophokles?
Anouilh's Dialog ist durch Rede und Gegenrede gekennzeichnet, die als Konfliktaustragung selbst Handlung ist. Es handelt sich um ein offenes Drama, während Sophokles' Antigone ein geschlossenes Drama ist.
Welche zentralen Unterschiede werden zwischen den beiden Texten festgestellt?
Trotz der gleichen Rahmenhandlung werden diverse Unterschiede in den Motiven der Personen, Handlungselementen und deren Darstellung festgestellt. Die unterschiedliche Darstellung des Kreons ist hierbei ein zentrales Merkmal.
- Quote paper
- Timm Klöpper (Author), 2000, Sophokles - Antigone - Vergleich der beiden Dramen Antigone I und II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99708