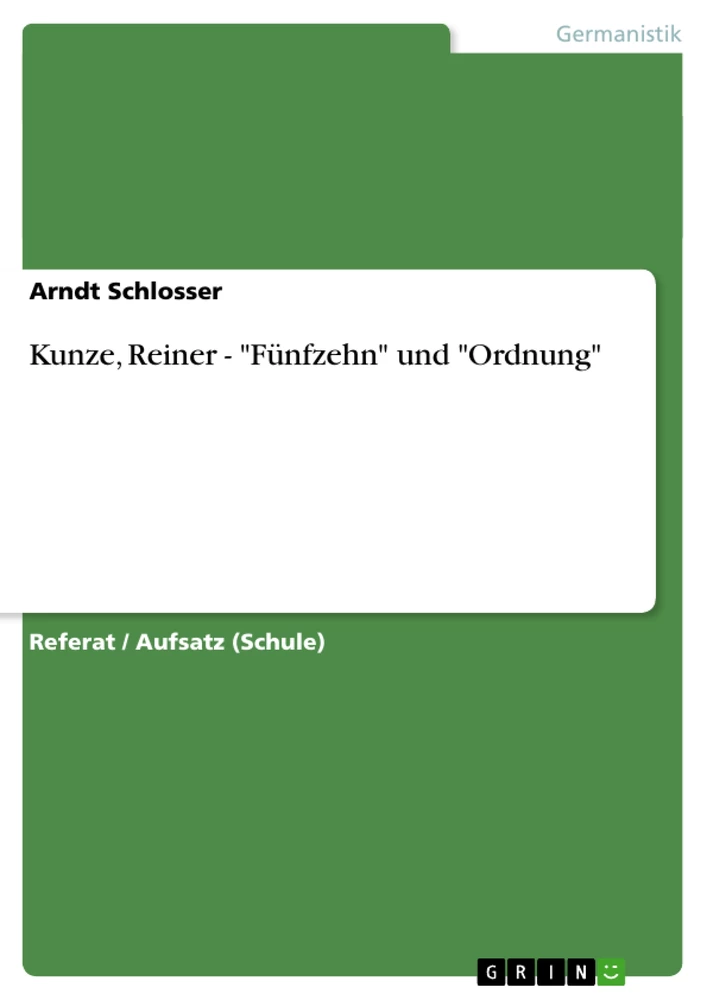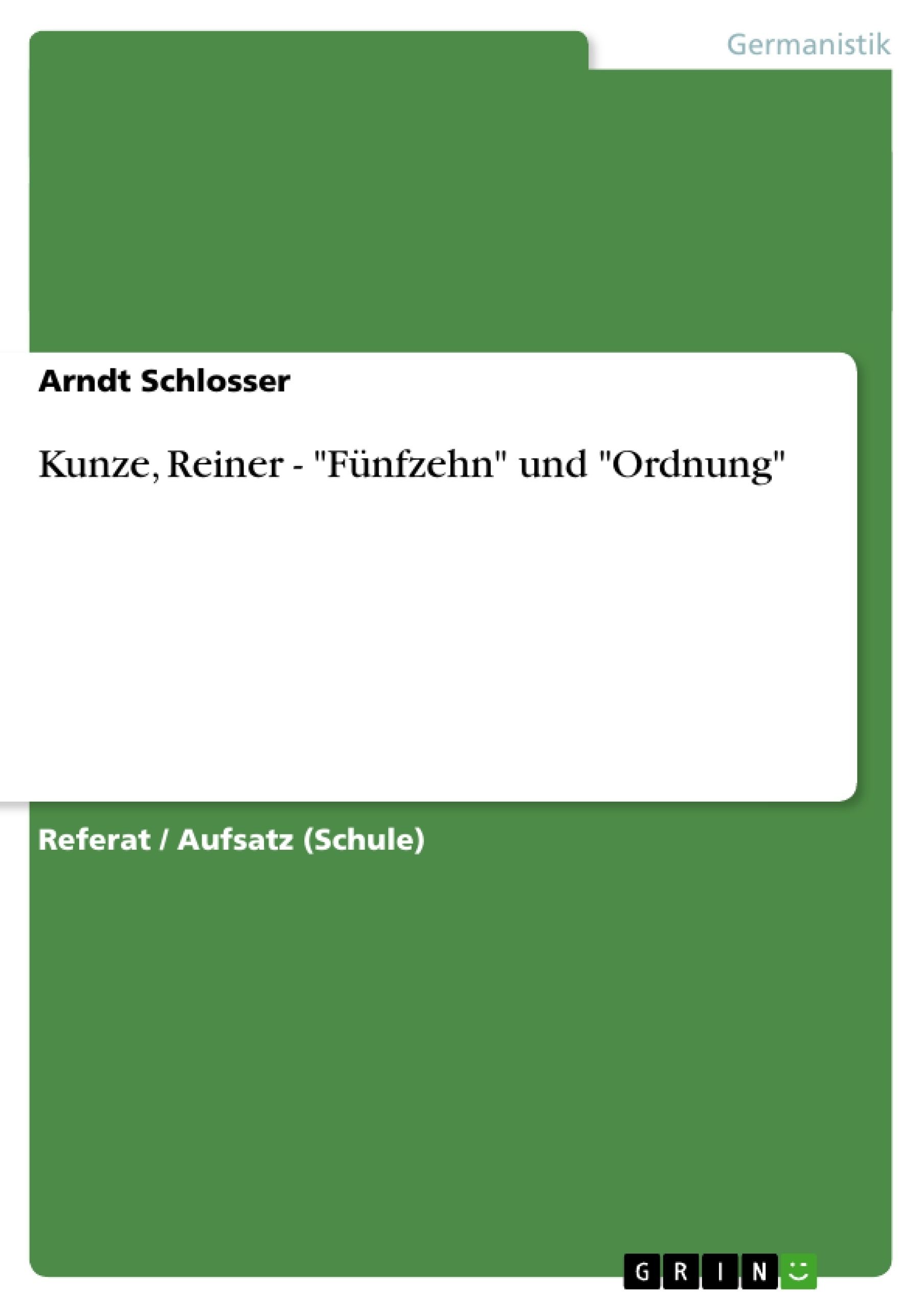Was bedeutet Ordnung wirklich? Ist es die starre Disziplin eines Überwachungsstaates oder die chaotische, aber ehrliche Selbstentfaltung eines Teenagers? Diese Frage durchdringt die vergleichende Analyse von Reiner Kunzes Kurzgeschichten "Fünfzehn" und "Ordnung", zwei Texte, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten und doch im Kern eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Freiheit, Konformität und dem Widerstand gegen gesellschaftliche Normen darstellen. "Fünfzehn" entführt uns in das rebellische Universum eines jungen Mädchens, dessen unordentliches Zimmer und provokanter Kleidungsstil zum Ausdruck einer inneren Freiheit werden, während ihr Vater, ein liebevoller Beobachter, zwischen Verständnis und dem Wunsch nach Konvention hin- und hergerissen ist. Im Kontrast dazu steht "Ordnung", eine beklemmende Schilderung von Jugendlichen, die nach einem Jazzkonzert in einem Bahnhof auf ihren Zug warten und Opfer einer überzogenen Staatsgewalt werden, die jede Abweichung von der Norm mit Härte bestraft. Kunze verwebt meisterhaft stilistische Mittel und subtile Kritik, um die Atmosphäre der DDR einzufangen und die Mechanismen der Unterdrückung aufzuzeigen. Die Gegenüberstellung dieser beiden Erzählungen enthüllt nicht nur die Vielschichtigkeit des Begriffs "Ordnung", sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die Bedeutung von Individualität und Widerstand in einer Gesellschaft, die Konformität fordert. Tauchen Sie ein in diese literarische Analyse, die sowohl Kennern der DDR-Literatur als auch neuen Lesern tiefgreifende Einblicke in Kunzes Werk und die bleibende Relevanz seiner Themen bietet. Entdecken Sie, wie Kunze durch scheinbar einfache Geschichten komplexe Fragen nach Freiheit, Autorität und den Preis der Anpassung verhandelt, und lassen Sie sich von der subtilen Kraft seiner Prosa fesseln. Diese Interpretation lädt dazu ein, über die Bedeutung von Ordnung im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext nachzudenken und die subtilen Mechanismen der Machtausübung zu erkennen, die unser Leben prägen. Kunzes Erzählungen sind ein Spiegelbild der Zerrissenheit zwischen individuellem Freiheitsdrang und dem Zwang zur Anpassung, ein Konflikt, der auch heute noch von erschreckender Aktualität ist und zum Nachdenken anregt.
Reiner Kunze - ,,Fünfzehn" und ,,Ordnung"
- Eine vergleichende Interpretation
Als ich die Texte "Fünfzehn" und "Ordnung" - beides Kurzgeschichten von Reiner Kunze - das erste Mal gelesen hatte, hatten sie in mir ganz unterschiedliche Empfindungen hervorgerufen.
Beide Texte thematisieren die Frage der Ordnung, jedoch von unterschiedlichen Perspektiven aus.
"Fünfzehn" handelt von einem fünfzehnjährigen Mädchen, das die Moralvorstellungen der Erwachsenenwelt ablehnt. Ihren Protest bringt sie zum einen durch auffallende Kleidung, zum anderen durch ein unordentliches Zimmer und laute Musik zum Ausdruck. Der Erzähler berichtet von seinen erfolglosen Versuchen, das Mädchen zu mehr Ordnung zu bewegen.
Dieser Text hat mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht, da ich - wie wahrscheinlich viele andere Jugendliche auch - das im Text Beschriebene nur allzu gut an mir selbst wiedererkennen kann.
Im Gegensatz zu diesem ersten Text löste "Ordnung" bei mir ausschließlich negative Gefühle aus.
Dieser Text handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die nach einem Jazz-Konzert in einem Bahnhof ermüdet auf ihren Zug warten und dabei einschlafen. Als sie dem Befehl einer Streife, sich ab sofort gerade hinzusetzen, nicht folgen, werden sie einige Minuten später des Bahnhofs verwiesen.
Auf mich hat die Art und Weise, auf die Polizisten ihre Gewalt hier benutzen, um die Ordnung durchzusetzen, bedrohlich und gefährlich gewirkt.
Die Stimmung der Texte und die Intentionen des Autors werden dem Leser durch geschickt eingesetzte stilistische Mittel und auch durch die Struktur der Texte nahegebracht. "Fünfzehn" ist in neun Absätze gegliedert. Dabei folgt auf einen langen Absatz immer ein kurzer, in welchem das Vorhergehende noch einmal zusammengefasst und gewertet wird. Es erfolgt keine Einleitung in den Text, das Mädchen wird sofort beschrieben.
Erzählt wird der Text von einem Ich-Erzähler, von dem ich annehme, dass er der Vater des Mädchens ist. Die Handlung spielt in der Gegenwart, sie ist praktisch zu jeder Zeit aktuell und könnte in beinahe jedem beliebigen Jugendzimmer stattfinden.
Der Text ist von parataktischen Sätzen geprägt, welche die Sprache der Jugend - also die der Tochter - symbolisieren sollen. Die ausgefeiltere Sprache in manchen Partien des Textes ist dagegen ein Symbol für die Sprache des Vaters, in dessen Gedanken die Handlung spielt.
Schon durch diese Unterschiede in der Sprache wird aufgezeigt, dass zwischen Vater und Tochter eine Kluft herrscht. Dieser Generationskonflikt kommt auch im letzten Satz des ersten Abschnittes zum Ausdruck: ,,Sie ist fünfzehn Jahre alt und gibt nichts auf die Meinung uralter Leute - das sind alle Leute über dreißig." Anschließend wird durch die Verwendung einer rhetorischen Frage die Unmöglichkeit des vollen Verständnisses zwischen jung und ,,alt" festgestellt: ,,Könnte einer von ihnen sie verstehen, selbst wenn er sich bemühen würde?"
Diese (ungewollte) Distanz des Vaters gegenüber seiner Tochter wird auch ersichtlich, wenn man die Art, in der er seine Tochter beschreibt, betrachtet. So übertreibt er maßlos, wenn er zum Beispiel sagt, ,,Am liebsten hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben - eine Art Niagara-Fall aus Wolle", oder sie träge ,,einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang."
Auch wenn er die Unordentlichkeit in ihrem Zimmer beschreibt und sagt, dass die ,,Ausläufer dieser Hügellandschaft [...] sich bis ins Bad und in die Küche" erstrecken, oder wenn es heißt ,,Wenn sie Musik hört, vibrieren noch im übernächsten Zimmer die Türfüllungen", ist dies sicher übertrieben.
Außer den Übertreibungen treten in diesen - wie auch in anderen - Sätzen des Textes auch Metaphern auf: ,,Niagara-Fall"; ,,Hügellandschaft". Außerdem beschreibt der Vater den Zustand des Zimmers mit einer Klimax: ,,Auf den Möbeln ihres Zimmers flockt der Staub. Unter ihrem Bett wallt er." Darauf folgt eine lange Aufzählung verschiedenster Dinge, die den Eindruck noch einmal intensiviert (,,Haarklemmen, ein Taschenspiegel, Knautschlacklederreste, Schnellhefter, Apfelstiele...")
Dadurch bekommt der Leser eine sehr bildliche, jedoch von vornherein extreme Vorstellung von der Tochter und ihrer Umgebung.
Jedoch kann man an dieser Erzählweise auch erkennen, dass der Vater die Unordnung mit einem Augenzwinkern - mit einer gewissen Ironie - sieht.
Er weiß, dass seine Tochter eine ganz natürliche Entwicklung durchmacht. Schon der Titel
,,Fünfzehn" zeigt, dass diese Phase nur eine bestimmte Zeit anhalten wird und dass sich nach der Pubertät alles wieder normalisieren wird.
Auch betrachtet er die Unordentlichkeit zum Teil unter einem positiven Aspekt, da er darin auch die Kreativität, die Intelligenz seiner Tochter sieht (,,...und sie ist intelligent"). So liest sie zum Beispiel auch viele Bücher - ,,Hesse, Karl May, Hölderlin". Daran, dass diese Schriftsteller zu völlig verschiedenen Zeiten geschrieben haben, erkennt man wieder, dass die Tochter sich in einer Phase der Entwicklung befindet - sie liest verschiedenste Stilrichtungen, weil sie ihre Identität, den richtigen Weg im Leben noch finden muss und will.
Der Vater bringt dem Verhalten seiner Tochter deswegen auch sehr viel Verständnis und Geduld entgegen: So versucht er zum Beispiel, wenn sie extrem laut Musik hört, nicht einzuschreiten, denn er weiß, ,,diese Lautstärke bedeutet für sie Lustgewinn. Teilbefriedigung ihres Bedürfnisses nach Protest. Überschallverdrängung unangenehmer logischer Schlüsse.
Trance." Hier werden durch die aneinandergereihten Ellipsen und die damit verbundene Klimax die Empfindungen der Tochter besonders intensiv beschrieben.
Der Vater weiß, dass Jugendliche in diesem Alter die schönen Dinge des Lebens genießen wollen: ,,Ich weiß: Sie will sich nicht den Nichtigkeiten des Lebens ausliefern." Auch versteht er, dass seine Tochter ihre Freiheit genießen will, dass sie nur tut, was ihr Spaß macht - Sie ,,wägt [...] die Tätigkeiten gegeneinander ab nach dem Maß an Unlustgefühlen, das mit ihnen verbunden sein könnte, und betrachtet es als Ausdruck persönlicher Freiheit, die unlustintensiveren zu ignorieren."
Der Vater hat eine enge Beziehung zu seiner Tochter und in einer gewissen Weise ist er auch stolz darauf, dass sie ihr Leben so lebt, wie es ihr richtig erscheint.
Auch scheint sich der Vater als eine Art Vermittler zwischen der Tochter und der Mutter, die anscheinend mit der Situation überfordert ist, zu sehen. So wischt er zum Beispiel manchmal heimlich das Zimmer des Mädchens, ,,um ihre Mutter vor Herzkrämpfen zu bewahren".
Er will seiner Tochter sein Verständnis von Ordnung keinesfalls mit aller Gewalt aufzwingen, sondern versucht vielmehr, sie mit sanften Mitteln zu erziehen. So sagt er zum Beispiel einmal: ,,Unter deinem Bett waren zwei Spinnennester." Er will die Tochter mit dieser kleinen erzieherischen Lüge zu mehr Ordnung bewegen, diese allerdings durchschaut den Trick und geht aus der Situation überlegen hervor, indem sie ihre Hausschuhe auf das Klavier stellt und sagt: ,,Die stelle ich jetzt immer dorthin.[...]Damit keine Spinnen hineinkriechen können."
Der Text ,,Ordnung" steht in vielen Punkten im extremen Gegensatz zu ,,Fünfzehn", was man schon an der Struktur und der Sprache, die den Text bestimmt, erkennen kann.
Die Handlung des Textes spielt offensichtlich in der Zeit der DDR auf einem Bahnhof und einer anliegenden Straße.
Der Text ist in fünf kurze Absätze gegliedert. Die Sätze sind alle relativ kurz und einfach gehalten, wodurch eine nüchterne, kühle und gedrückte Grundstimmung den Text beherrscht. Der Erzähler ist als Person nicht wahrnehmbar, es ist ein personaler Erzähler. Dadurch wird das Geschehen - anders als in ,,Fünfzehn" - sehr objektiv beschrieben, wodurch eine gewisse kritische Distanz zum Geschehen geschaffen wird. Dies wird noch dadurch unterstützt, dass im gesamten Text kaum Adjektive vorkommen. Die Sprache, die verwendet wird, klingt sehr kalt und hart. Dieser Eindruck entsteht vor allem durch den Befehlston, den die Transportpolizisten anschlagen, als sie die Jugendlichen zur Ordnung aufrufen: ,,Entweder Sie setzen sich gerade hin, oder Sie verlassen den Bahnhof, Ordnung muss sein!"
Auch hier existiert - zwischen den Polizisten und den Jugendlichen - ein Generationskonflikt, der allerdings aggressiv statt - wie in ,,Fünfzehn" - verständnisvoll behandelt wird. Wie der Titel des Textes schon sagt, ist die Hauptthematik jedoch auch in diesem Text die Ordnung. Allerdings erkennt man schon an dem Befehl, den die Polizisten aussprechen, dass die Ordnung in dieser Situation mit aller Härte eingefordert wird und dass die Polizisten absolut kein Verständnis für die Jugendlichen haben und dies auch nicht haben wollen (ganz im Gegensatz zu dem Vater im Text ,,Fünfzehn"). Hier wird die Ordnung als etwas Grundlegendes angesehen, das mit Gewalt, Drohungen und gegebenenfalls auch Bestrafungen durchgesetzt und verteidigt werden muss.
Grundsätzlich stört es in einer ,,leeren Bahnhofshalle" sicher niemanden, wenn ein paar Jugendliche jeweils ,,den Kopf auf die Schultern ihres Nebenmannes" legen, um so auf ihren Zug zu warten. Hier jedoch wollen die Polizisten, die in diesem Text (zusammen mit dem Schäferhund) ein Symbol für die gesamte Staatsgewalt der DDR darstellen, den Jugendlichen ihre Macht demonstrieren, indem sie die feststehenden Normen, Regeln und Gesetze mit aller Gewalt durchsetzen.
So sehen sie auch die - für Jugendliche ganz normale - freche Reaktion auf ihren Befehl (,,Wieso Ordnung? [...] Sie sehen doch, daß jeder seinen Kopf gleich wiedergefunden hat.") als Angriff auf ihre Autorität an und reagieren darauf wiederum mit einer rhetorischen Frage, durch die klar wird, dass sie in diesem Bahnhof - oder wenn man es auf die DDR überträgt, in diesem Staat - die absolute Kontrolle haben und dass niemand sich dieser Gewalt widersetzen darf: ,,Wenn Sie frech werden, verschwinden sie sofort, verstanden?"
Als die Jugendlichen sich dem Befehl, sich ordentlich hinzusetzen, nicht beugen, haben sie sich damit der Gewalt widersetzt und werden deshalb von der Streife des Bahnhofs verwiesen. Allerdings gibt es in diesem Text noch eine Stelle, an der die Staatsmacht der DDR - zumindest hintergründig - kritisiert wird: Der Text wird eingeleitet mit den Worten ,,Die Mädchen und Jungen [...] kamen aus einem Jazz-Konzert." Das ist insofern von Bedeutung, dass diese Art von Musik in der Parteispitze der DDR äußerst verpönt war. Die Jugendlichen haben sich also schon durch den bloßen Besuch dieses Jazz-Konzertes - durch ihre Kreativität, ihre Lust, Neues zu erleben - verdächtig gemacht. Im Gegensatz zu ,,Fünfzehn", wo die Kreativität des Mädchens als positiv gesehen wird, wird hier versucht, neben der äußeren Ordnung auch noch die Gedanken der Menschen zu kontrollieren und somit eine ,,Ordnung" in ihren Köpfen zu schaffen. Als die Jugendlichen den Bahnhof verlassen hatten, ,,ging ein feiner Regen nieder." Dies kann man als Symbol für die zu diesem Zeitpunkt herrschende gedrückte Stimmung sehen. Der letzte Satz heißt: "Der Zeiger der großen Uhr wippte auf die Eins wie ein Gummiknüppel." Dabei steht der Gummiknüppel, mit dem der Uhrzeiger verglichen wird, für die (bedrohliche) Gewalt der Polizisten, und im übertragenen Sinne für die des Staates.
Beide Texte weisen deutliche Merkmale von Kurzgeschichten auf. Sie beginnen sehr abrupt, ohne in die Handlung einzuleiten und ohne die Charaktere vorzustellen, beziehungsweise deren Namen zu nennen. Die Handlung stellt beide Male eine Alltagssituation dar, in deren Verlauf sich die Charaktere kaum entwickeln. Auch haben die Texte ein offenes Ende, was den Leser anregt, über das Textende hinaus über das Gelesene nachzudenken (im Text ,,Fünfzehn" wird dies besonders deutlich, da hier am Schluß der bewertende Absatz fehlt). Hierbei ist die Intention des Autors im Text ,,Ordnung" recht offensichtlich: Reiner Kunze kritisiert die Staatsgewalt der DDR und enttarnt diese angestrebte Form der Ordnung als etwas äußerst Gefährliches.
Reiner Kunze schrieb viele kritische Werke über das Leben in der DDR. Darunter war auch der Prosaband mit dem ironischen Titel ,,Die wunderbaren Jahre", aus dem die zwei beschriebenen Kurzgeschichten stammen. Nachdem dieser Band in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht wurde (1976), wurde Reiner Kunze aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen und übersiedelte nach Westdeutschland.
Letztendlich kann man bei ,,Fünfzehn" so zum einen die Thematik der Ordnung und die des Generationskonfliktes erkennen, wobei sich hier auch autobiographische Züge Reiner Kunzes feststellen lassen, da dieser mit seiner Tochter sicher ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Zum anderen kann man jedoch auch in diesem Text die kritische Auseinandersetzung mit dem Leben in der DDR erkennen.
So scheint der Vater seine Tochter dafür zu bewundern, ja vielleicht sogar etwas zu beneiden, dass sie ihr Leben so gestalten kann, dass sie ihre Gefühle und ihre Einstellung, hier mit Hilfe der Kleidung, auch nach außen zeigt, statt alle Bedürfnisse nach Freiheit zu unterdrücken:
,,Ich glaube, von einem solchen Schal würde sie behaupten, daß er genau ihrem Lebensgefühl entspricht." Man kann vermuten, dass der Vater dem Verhalten der Tochter immer wieder Motive gibt, die eigentlich er selbst - durch die Einengung und die Anpassungszwänge in der DDR hervorgerufen - verspürt: ,,Sie fürchtet die Einengung des Blicks, des Geistes. Sie fürchtet die Abstumpfung der Seele durch Wiederholung!" Jedoch kann er, als Erwachsener, seine Wünsche und Träume nicht mehr ausleben.
Häufig gestellte Fragen zu Reiner Kunze - ,,Fünfzehn" und ,,Ordnung"
Worum geht es in der vergleichenden Interpretation der Kurzgeschichten ,,Fünfzehn" und ,,Ordnung" von Reiner Kunze?
Die Interpretation vergleicht die Kurzgeschichten ,,Fünfzehn" und ,,Ordnung" von Reiner Kunze. Beide Texte thematisieren die Frage der Ordnung, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven. ,,Fünfzehn" handelt von einem fünfzehnjährigen Mädchen, das sich gegen die Moralvorstellungen der Erwachsenen auflehnt, während ,,Ordnung" eine Gruppe Jugendlicher in einem Bahnhof behandelt, die aufgrund ihres Verhaltens von der Polizei des Platzes verwiesen werden. Die Interpretation untersucht die stilistischen Mittel, die Struktur und die Intentionen des Autors in beiden Texten.
Was ist das Hauptthema von ,,Fünfzehn"?
Das Hauptthema von ,,Fünfzehn" ist der Generationskonflikt und die Auseinandersetzung eines Teenagers mit den Erwartungen der Erwachsenen. Es geht um Rebellion, Individualität und das Streben nach Selbstfindung. Die Geschichte wird aus der Perspektive des Vaters erzählt, der versucht, seine Tochter zu verstehen und mit ihrer Unordnung umzugehen.
Wie wird die Thematik der Ordnung in ,,Fünfzehn" dargestellt?
In ,,Fünfzehn" wird die Ordnung hauptsächlich als ein Konflikt zwischen dem Wunsch des Vaters nach Sauberkeit und Struktur und dem Bedürfnis der Tochter nach Ausdruck und Freiheit dargestellt. Die Unordnung des Zimmers des Mädchens symbolisiert ihren Protest gegen konventionelle Normen. Der Vater zeigt jedoch Verständnis für ihre Entwicklung und versucht, ihr nicht seine eigenen Vorstellungen aufzuzwingen.
Was ist das Hauptthema von ,,Ordnung"?
Das Hauptthema von ,,Ordnung" ist die autoritäre Durchsetzung von Ordnung und die Unterdrückung von Individualität im Kontext der DDR. Die Geschichte kritisiert die Staatsgewalt und die Art und Weise, wie die Polizei ihre Macht missbraucht, um vermeintliche Ordnung herzustellen. Es geht auch um den Generationskonflikt, der hier jedoch aggressiv und ohne Verständnis behandelt wird.
Wie wird die Thematik der Ordnung in ,,Ordnung" dargestellt?
In ,,Ordnung" wird die Ordnung als ein Instrument der Kontrolle und Unterdrückung dargestellt. Die Polizisten setzen die Ordnung mit Härte und Gewalt durch, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse oder Gefühle der Jugendlichen. Die Geschichte kritisiert die starren Normen und Regeln der DDR und die fehlende Freiheit der Bürger.
Welche stilistischen Mittel werden in ,,Fünfzehn" verwendet?
In ,,Fünfzehn" werden verschiedene stilistische Mittel verwendet, darunter Übertreibungen, Metaphern, Klimax und rhetorische Fragen. Die Sprache ist oft parataktisch, um die Sprache der Jugend zu symbolisieren, während die ausgefeiltere Sprache des Vaters dessen Perspektive widerspiegelt. Der Ich-Erzähler (wahrscheinlich der Vater) vermittelt die Handlung subjektiv und ironisch.
Welche stilistischen Mittel werden in ,,Ordnung" verwendet?
In ,,Ordnung" wird eine nüchterne, kühle und distanzierte Sprache verwendet. Die Sätze sind kurz und einfach gehalten, und es kommen kaum Adjektive vor. Der personale Erzähler beschreibt das Geschehen objektiv, wodurch eine kritische Distanz geschaffen wird. Der Befehlston der Polizisten verstärkt den Eindruck von Härte und Autorität.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen ,,Fünfzehn" und ,,Ordnung"?
Beide Texte thematisieren die Ordnung und den Generationskonflikt. In ,,Fünfzehn" wird die Ordnung jedoch eher als ein persönlicher Konflikt dargestellt, während sie in ,,Ordnung" als ein politisches Instrument der Unterdrückung erscheint. ,,Fünfzehn" ist durch Verständnis und Ironie geprägt, während ,,Ordnung" durch Härte und Distanz gekennzeichnet ist. Beide Texte weisen Merkmale von Kurzgeschichten auf, wie einen abrupten Beginn, eine Alltagssituation und ein offenes Ende.
Welche Kritik an der DDR wird in den Texten deutlich?
In ,,Fünfzehn" wird die Kritik an der DDR subtiler angedeutet, etwa durch die Bewunderung des Vaters für die Freiheit und Unangepasstheit seiner Tochter. In ,,Ordnung" wird die Kritik deutlicher, indem die autoritäre Staatsgewalt und die Unterdrückung von Individualität angeprangert werden. Der Besuch eines Jazz-Konzertes wird als verdächtig dargestellt, und der Gummiknüppel am Ende symbolisiert die Gewalt des Staates.
In welchem Zusammenhang stehen die Kurzgeschichten zu Reiner Kunzes Leben?
Reiner Kunze schrieb viele kritische Werke über das Leben in der DDR. Die Kurzgeschichten stammen aus dem Prosaband ,,Die wunderbaren Jahre". Nachdem dieser Band in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht wurde, wurde Kunze aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen und übersiedelte nach Westdeutschland. ,,Fünfzehn" kann autobiographische Züge aufweisen, da Kunze möglicherweise ähnliche Erfahrungen mit seiner Tochter gemacht hat.
- Quote paper
- Arndt Schlosser (Author), 2000, Kunze, Reiner - "Fünfzehn" und "Ordnung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99680