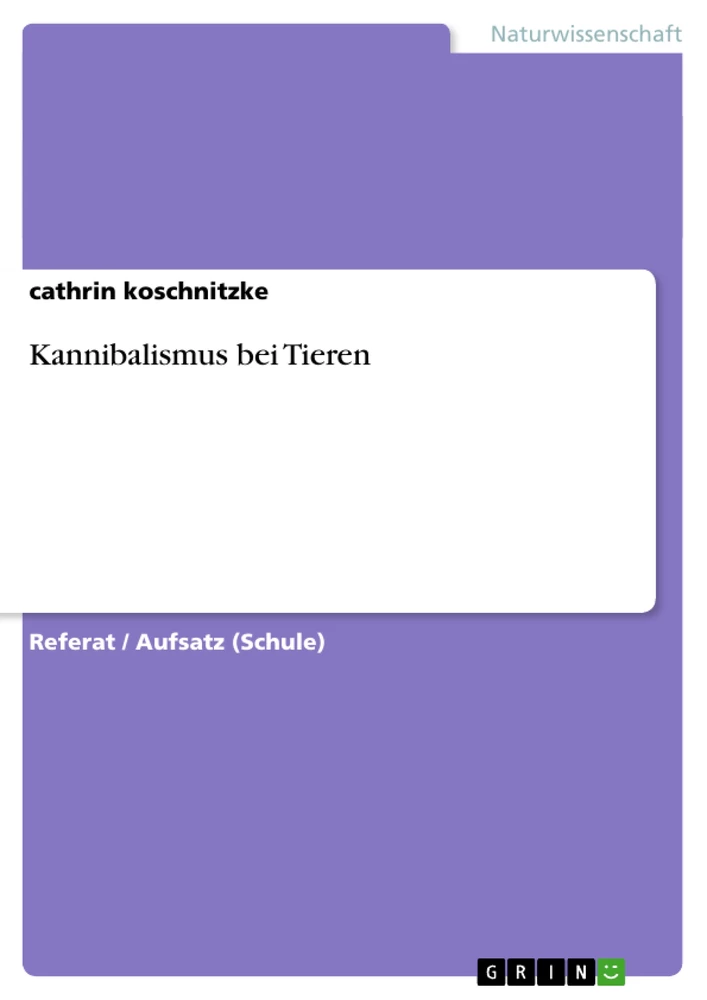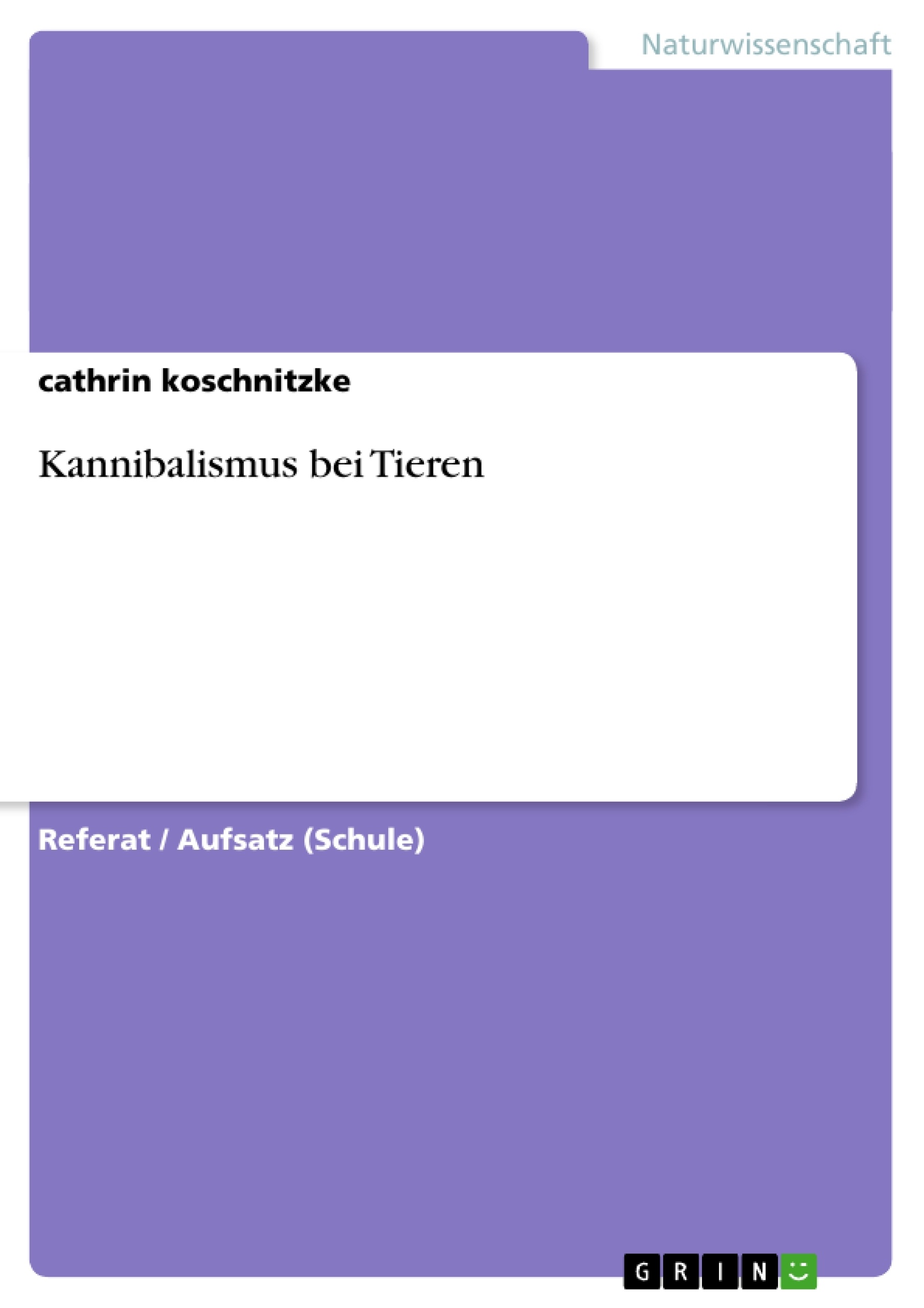Was treibt Tiere dazu, ihre eigenen Artgenossen zu fressen? Tauchen Sie ein in die düstere Welt des Kannibalismus im Tierreich, ein Verhalten, das weit verbreiteter ist, als man vielleicht denkt. Diese aufschlussreiche Untersuchung enthüllt die überraschenden Gründe, warum Kannibalismus in der Natur auftritt, von der Regulierung der Population bis hin zum Überleben in extremen Situationen. Entdecken Sie, wie Überbevölkerung, Schutzinstinkte, Krankheiten und sogar Paarungsrituale zu diesem schockierenden Verhalten führen können. Erfahren Sie, wie menschliche Eingriffe, insbesondere in der intensiven Tierhaltung, unbeabsichtigt Kannibalismus auslösen können, indem sie Stress, Enge und mangelnde Stimulation verursachen. Anhand von Beispielen wie Legehennen in Käfigen, Schweinen in Mastbetrieben und Skorpionen in Terrarien wird deutlich, wie unnatürliche Lebensbedingungen dieses Verhalten verstärken können. Dieses Buch beleuchtet nicht nur die dunklen Seiten des Tierreichs, sondern regt auch zum Nachdenken über unsere Verantwortung im Umgang mit Tieren an. Es erforscht die ethischen Implikationen der Massentierhaltung und fordert einen verantwortungsvolleren und respektvolleren Umgang mit Lebewesen. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Tierverhalten, Ökologie und die komplexen Wechselwirkungen innerhalb von Ökosystemen interessieren. Es bietet einen tiefen Einblick in die Überlebensstrategien der Natur und die oft unbeabsichtigten Folgen menschlichen Handelns. Untersuchen Sie die verblüffenden Vorteile des Kannibalismus, wie die Populationskontrolle und die Beseitigung von Rivalen, die zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts beitragen. Erforschen Sie die unheimlichen Paarungsrituale bestimmter Spinnen- und Insektenarten, bei denen das Weibchen das Männchen nach der Paarung verspeist, ein Akt, der sowohl brutal als auch biologisch bedeutsam ist. Diese umfassende Analyse bietet einen fesselnden Einblick in ein oft missverstandenes Phänomen und wirft wichtige Fragen über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier auf.
Inhalt:
1. Was versteht man unter Kannibalismus?
1.1. Allgemein
1.2. beim Menschen
2. Warum werden Tiere zu Kannibalen? (Situationsbedingter Kannibalismus)
2.1. natürliche Gründe
2.1.1. Überbevölkerung
2.1.2. Schutzgrenze
2.1.3. Krankheit
2.1.4. Paarung
2.2. unnatürliche Gründe
2.2.1. Käfighaltung (am Beispiel Legehenne)
2.2.2. Masthaltung (am Beispiel Schwein)
2.2.2.1. Klimafaktoren
2.2.2.2. Belegungsdichte und Gruppierung
2.2.2.3. Fütterung
2.2.2.4. Biorhythmus
2.2.2.5. Fehlende Ablenkung
2.2.3. Terrarienhaltung (am Beispiel Skorpione)
3. Nutzen des Kannibalismus
3.1. Regulierung der Population
3.2. Schutz vor Feinden
3.3. Nahrungsangebot
3.4. Rivalenbeseitigung
1.Was versteht man unter Kannibalismus?
1.1. Allgemein
Kannibalismus ist das Töten und Verzehren von Tieren der eigenen Art. Er tritt bei einigen Raubtieren, Nagern, Reptilien, Insekten und Spinnen auf.
1.2. Beim Menschen
Bei Menschen wird dieser Vorgang Anthropophagie(Menschenfresserei) genannt und kam früher bei Naturvölkern aller Erdteile vor. Dies ging auf die magische Vorstellung zurück, dass das Fleisch die geistigen oder körperlichen Kräfte vermehrt.
Heute kommt der Kannibalismus nur noch sehr selten vor, meist als krankhafte Erscheinung oder bei unzivilisierten Naturvölkern.
2. Warum werden Tiere zu Kannibalen? (Situationsbedingter Kannibalismus
Keine Tierart betreibt gewohnheitsmäßig Kannibalismus! Dies würde zur vorzeitigen Ausrottung der Art führen, die Tiere sind jedoch immer bestrebt,ihre Art zu erhalten.
2.1. natürliche Gründe
2.1.1. Überbevölkerung:
Hier ist in Folge zu großer Vermehrung die Populationsdichte zu hoch geworden und die Tiere fressen ihre Eier, die Jungtiere oder sogar die erwachsenen Tiere auf. Z.b. verlässt das Weibchen einer Wanderratte bei Überbevölkerung ihre Jungen, anstatt für sie ein Nest zu bauen und sie zu versorgen. Diese werden dann von ihren Artgenossen aufgefressen. Das kommt auch bei einigen Vogelarten vor, wie z. B. Seeschwalben, Reihern, Falken oder Bachstelzen. Die Silbermöwen greifen sogar gewohnheitsmäßig die Nester der Brutkolonien an und fressen deren Jungen . Die Überbevölkerung ist das häufigste Motiv für Kannibalismus ,das weitere Gründe nach sich zieht.
2.1.2. Schutzgrenze:
Wie der Mensch so besitzen auch Tiere eine gewisse Schutzgrenze für ihren Körper. Wenn ein Unbekannter diesen Abstand nicht einhält, gibt es entweder ein Ausweichen der Tiere oder der Eindringling wird angegriffen.
Vor allem auf engem Raum, wo viele Tiere genötigt werden miteinander zu leben,kann es zu Kannibalismus kommen. So z. B. bei den Skorpionen. Dies geschieht dadurch, dass die Tiere sich bedrängt fühlen und keine Rückzugsmöglichkeit mehr haben. Die Tiere greifen einander an und tragen den Kampf bis zum Tod des Widersachers aus. Danach frisst der Sieger seinen Gegner auf.
Damit wird wiederum die Population gemindert. Es ist eine Folge der Überbevölkerung und wird nur solange praktiziert, bis sich die Tiere wieder geborgen und wohlfühlen.
2.1.3. Krankheit:
Wenn die eigenen Artgenossen fremde Nester überfallen und die Jungen verschlingen bezeichnet man dies als pathologisch oder krankhaft. Z. B. muss ein maulbrütendender Fisch genau unterscheiden können, wann es sich um eines der Jungtiere handelt und wann um Beute. Ist dieser Erkennungsvorgang, mit dem Beutetiere ausgemacht werden gestört, kann es zu ungewolltem Kannibalismus kommen.
2.1.4. Paarung:
Manche Spinnenweibchen fressen die Männchen, die ihnen den Hof machen nach der Kopulation auf, z.B. die Schwarze Witwe. Die Gottesanbeterin ist berüchtigt für ihr rabiate Weise, sich mit einem Männchen zu paaren. Sie enthauptet ihren Partner, der allerdings mit der Paarung fortfährt, indem er die Kopulationsbewegungen weiterführt. Ein Grund für diese Tat könnte sein, dass die Gehirntätigkeit die Kopulation hemmen würde und der Geschlechtsakt nicht ausführbar wäre.
2.2. unnatürliche Gründe
Menschen sollten nur bedingt in die Natur eingreifen, da jeder Eingriff schwere Folgen haben könnte, die man vorher nicht einzuschätzen weiß.
2.2.1. Käfighaltung:
Tiere die in Käfigen gehalten werden, neigen häufig zu Kannibalismus oder Federpicken. Dies tritt bei Küken im Alter von 3 bis 8 Wochen und bei Legehennen zum Legebeginn und zur Legespitze auf.
Ursachen dafür können unter anderem ein Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten sein , aber auch Krankheiten(Parasitenbefall), Stress, zu helles Licht, schlechte Raumluft, zu hohe Besatzdichte, Nachahmung bei jungen Küken, hormonelle Umstellung, Nährstoffunterversorgung bei Legehennen, ungenügende Futterstruktur.
2.2.2. Masthaltung:
Z. B. bei Schweinen und hier insbesondere in der Ferkelzucht.
2.2.2.1. Klimafaktoren
Das Klima spielt in der Mastanlage für die Schweine eine wichtige Rolle. Bei schlechter Durchlüftung beißen sich die Schweine gegenseitig in die Ohren. Bei Zugluft legen sich die Schweine auf den Bauch, wodurch die Körperfläche verkleinert und der Bauch und die Beine vor Unterkühlung geschützt werden. Durch Zugluft wird die Aktivität und damit auch die Aggressivität gesteigert.
Ein hoher Schadgasgehalt kann zum Anknabbern der Schwänze führen. Durch eine laufende Durchlüftung der Ställe kann dies vermindert beziehungsweise vermieden werden.
2.2.2.2. Belegungsdichte und Gruppierung
Laut Gesetz sind 0,7 m² für jedes Mastschwein erlaubt. Die Schweineställe sollten allerdings nicht so dicht belegt werden, damit die Schweine in ihrer Jungphase ihren Spieltrieb noch ausleben können.
Häufig beginnt das kleinste Schwein einer Gruppe mit dem Kannibalismus. Von daher muss auf eine ordentlich Gruppierung nach Gewicht und Größe besonders geachtet werden.
2.2.2.3. Fütterung
bei der Fütterung sollte auf eine ausgewogene Ernährung der Schweine geachtet werden, damit kein Kannibalismus durch diverse Mangelerscheinungen auftritt. So führen zum Beispiel Mykotoxine (Pilzgifte) zu Unruhe und länger anhaltende Kämpfe, die in Kannibalismus enden können. Mangelhafte Wasser- und Vitaminversorgung kann ebenfalls zu Kannibalismus führen.
2.2.2.4. Biorhythmus
In den frühen Morgen- und Nachmittagsstunden sind Schweine sehr aktiv. Sie sollten deshalb in diesen Zeiten möglichst nicht mit fremden Schweinen in Kontakt treten.
2.2.2.5. Hauterkrankungen
Hauterkrankungen können zu starkem Juckreiz und Unruhe führen. Die betroffenen Schweine empfinden es dann sogar noch als angenehm ,,angeknabbert" zu werden. Die häufigsten Hauterkrankungen sind Streptokokkenerkrankungen, Nässendes Ekzem, Hautpilzerkrankungen, Räude und Läusebefall.
2.2.2.6. Fehlende Ablenkung
Eine weitere Ursache für Kannibalismus ist Langeweile. Damit die Schweine auch vorübergehende Stresssituationen überstehen, sollten sie schon früh Ablenkungsmöglichkeiten haben. Z.B. freihängende Kette, diverses Spielzeug (Bälle, Reifen, Holzklötze) und Tränkennippel.
2.2.3.Terrarienhaltung ( z.B. Skorpione)
Wenn viele Skorpione in einem Terrarium sind, treten gehäuft Kämpfe mit Todesfolge auf. Die Tiere fühlen sich in ihrer Schutzgrenze verletzt und greifen sich gegenseitig an. Zum Schluss verspeist der Sieger seinen Rivalen. Dies geht solange weiter, bis für den Skorpion eine angenehme Atmosphäre mit nur noch wenigen Rivalen herrscht und er genügend Platz für sich in Anspruch nehmen kann. In einer natürlichen Umgebung haben Skorpione genügend Platz, um sich von anderen Artgenossen fern zu halten. Außerdem können sie dann unter verschiedenen Dingen z.B. Steinen, Blättern oder Sand Schutz suchen. In der freien Natur kommt es daher selten zu Kannibalismus unter diesen Tieren.
Tiere sollten so natürlich, wie möglich gehalten werden, damit sie sich wohl fühlen. Damit erst gar kein Kannibalismus auftritt, muss nicht nur daran gedacht werden, wie viel Fleisch aus einem Schwein zu gewinnen ist, sondern auch daran, wie es dem Tier ergeht, wie es sich fühlt. Dabei sollte der Mensch von seinem Grundempfinden und der Moral ausgehen.
3.Nutzen des Kannibalismus
3.1. Regulierung der Population
Bei natürlichem Kannibalismus ist der Vorteil die Regulierung der Population und somit auch die Sicherung und Erhaltung der Art. Würde die Vermehrung ohne Kannibalismus oder sonstige natürliche Vorgänge voranschreiten, hätten die Tiere bald keine Nahrung mehr und würden ständig ihre Schutzgrenzen verletzen.
3.2. Schutz vor Feinden
Hätten die Tiere keine Unterkünfte, so hätten sie auch keinen Schutz vor Kälte oder vor ihren Feinden. Bevor die Tiere sich freiwillig als Futter zur Verfügung stellen, fressen sie lieber die schwächsten Mitglieder ihrer Art, die Jungen, um ihr eigenes Leben zu erhalten.
3.3. Nahrungsangebot
Bei Nahrungsknappheit wird ebenfalls auf die Schwächeren zurückgegriffen, diese haben noch keinen so starken Körper, um eine Hungerperiode zu überstehen.
3.4.Rivalenbeseitigung
Zur Sicherung und Stärkung der Position wird bei einigen Arten ein Kampf auf Leben und Tod ausgetragen, meist unter den männlichen Arten, die um ein Weibchen buhlen. Hierbei kann es auch sein, dass der Sieger den getöteten Verlierer verspeist.
Quellenverzeichnis:
Internet: www.Saustark.de/Kannibal.htm
www.ufa.ch/Tiere/Gefluegel/GeflügelUntugend.htm
Bücher: Grosses Lexikon der Tiere
Verlag Martin Greil GmbH 1989 erschienen
Band3 S. 732-733
Kleine Enzyklopädie NATUR
VEB Bibliografisches Institut Leipzig
1979 erschienen
S. 223
Meyers Lexikon
VEB Bibliografisches Institut leipzig 1975 erschienen
Abiturwissen Biologie
Weltbild Kolleg Weltbild Verlag GmbH 1995 erschienen
S.90 und 105
Brehms Tierleben
VEB Bibliografisches Institut Leipzig 1952 erschienen
2. Auflage S.206 und216
Das neue, große, farbige Lexikon
Bassermann'sche Verlagsbuchhandlung 1990 erschienen
Häufig gestellte Fragen
Was ist Kannibalismus laut diesem Text?
Kannibalismus ist das Töten und Verzehren von Tieren der eigenen Art. Beim Menschen wird dieser Vorgang Anthropophagie (Menschenfresserei) genannt.
Warum werden Tiere zu Kannibalen? (Situationsbedingter Kannibalismus)
Keine Tierart betreibt gewohnheitsmäßig Kannibalismus. Die Gründe dafür können natürlich (Überbevölkerung, Schutzgrenze, Krankheit, Paarung) oder unnatürlich (Käfighaltung, Masthaltung, Terrarienhaltung) sein.
Welche natürlichen Gründe werden für Kannibalismus genannt?
Die natürlichen Gründe umfassen Überbevölkerung, Verletzung der Schutzgrenze, Krankheit und Verhalten während der Paarung.
Welche unnatürlichen Gründe werden für Kannibalismus genannt?
Die unnatürlichen Gründe umfassen Käfighaltung (Beispiel Legehenne), Masthaltung (Beispiel Schwein) und Terrarienhaltung (Beispiel Skorpione).
Welche Faktoren tragen zum Kannibalismus in der Masthaltung von Schweinen bei?
Klimafaktoren (schlechte Durchlüftung, Zugluft, hoher Schadgasgehalt), Belegungsdichte und Gruppierung, Fütterung (unausgewogene Ernährung, Mykotoxine, Mangelhafte Wasser- und Vitaminversorgung), Biorhythmus, Hauterkrankungen, und fehlende Ablenkung können zum Kannibalismus beitragen.
Welchen Nutzen hat Kannibalismus?
Der Nutzen kann in der Regulierung der Population, im Schutz vor Feinden, als Nahrungsangebot und in der Rivalenbeseitigung liegen.
Wie reguliert Kannibalismus die Population?
Durch das Fressen von Artgenossen wird die Populationsdichte reduziert, was Ressourcenknappheit und die Verletzung der Schutzgrenze vermindert.
Wie hilft Kannibalismus beim Schutz vor Feinden?
Indem die schwächsten Mitglieder gefressen werden, sichert die Art das Überleben der Stärkeren und widerstandsfähigeren Individuen.
Wie dient Kannibalismus als Nahrungsangebot?
In Zeiten von Nahrungsknappheit stellt Kannibalismus eine zusätzliche Nahrungsquelle dar.
Wie dient Kannibalismus zur Rivalenbeseitigung?
Durch den Kampf auf Leben und Tod um Weibchen oder Positionen kann der Sieger den Verlierer verspeisen, um seine Position zu sichern und zu stärken.
Was sind die Hauptursachen für Kannibalismus in der Käfighaltung von Legehennen?
Ursachen sind u.a. Mangel an Beschäftigung, Krankheiten, Stress, zu helles Licht, schlechte Raumluft, hohe Besatzdichte, Nachahmung, hormonelle Umstellung, Nährstoffunterversorgung, ungenügende Futterstruktur.
Warum tritt Kannibalismus bei Skorpionen in Terrarien auf?
Durch die Enge des Terrariums fühlen sich die Tiere bedrängt und verletzen ihre Schutzgrenzen. Es kommt zu Kämpfen, bei denen der Sieger den Verlierer frisst.
- Citar trabajo
- cathrin koschnitzke (Autor), 2000, Kannibalismus bei Tieren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99635