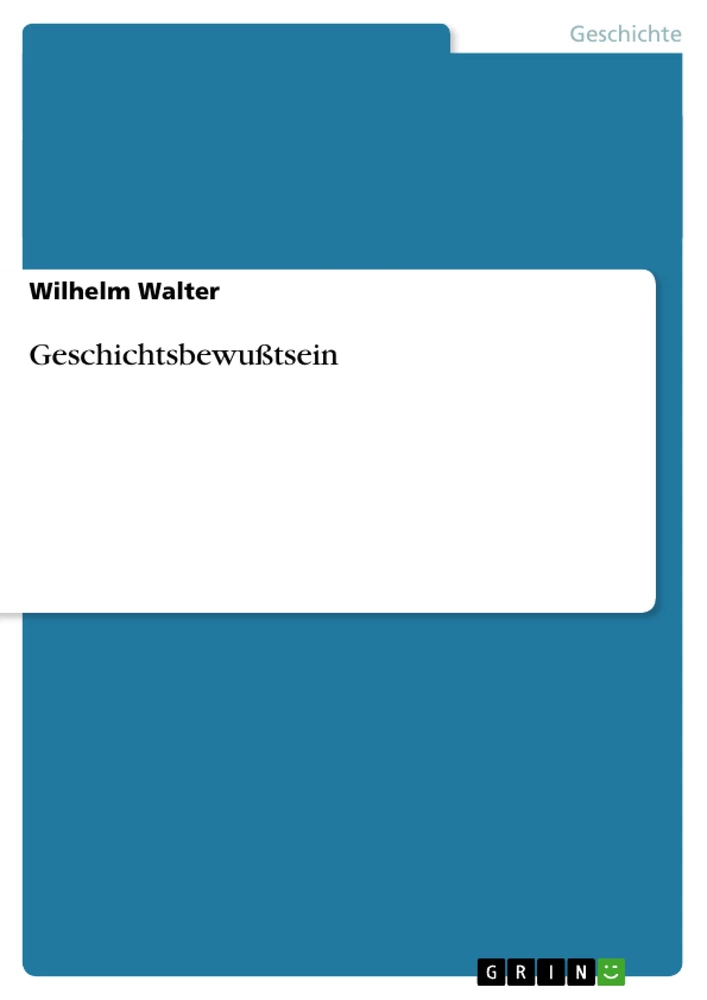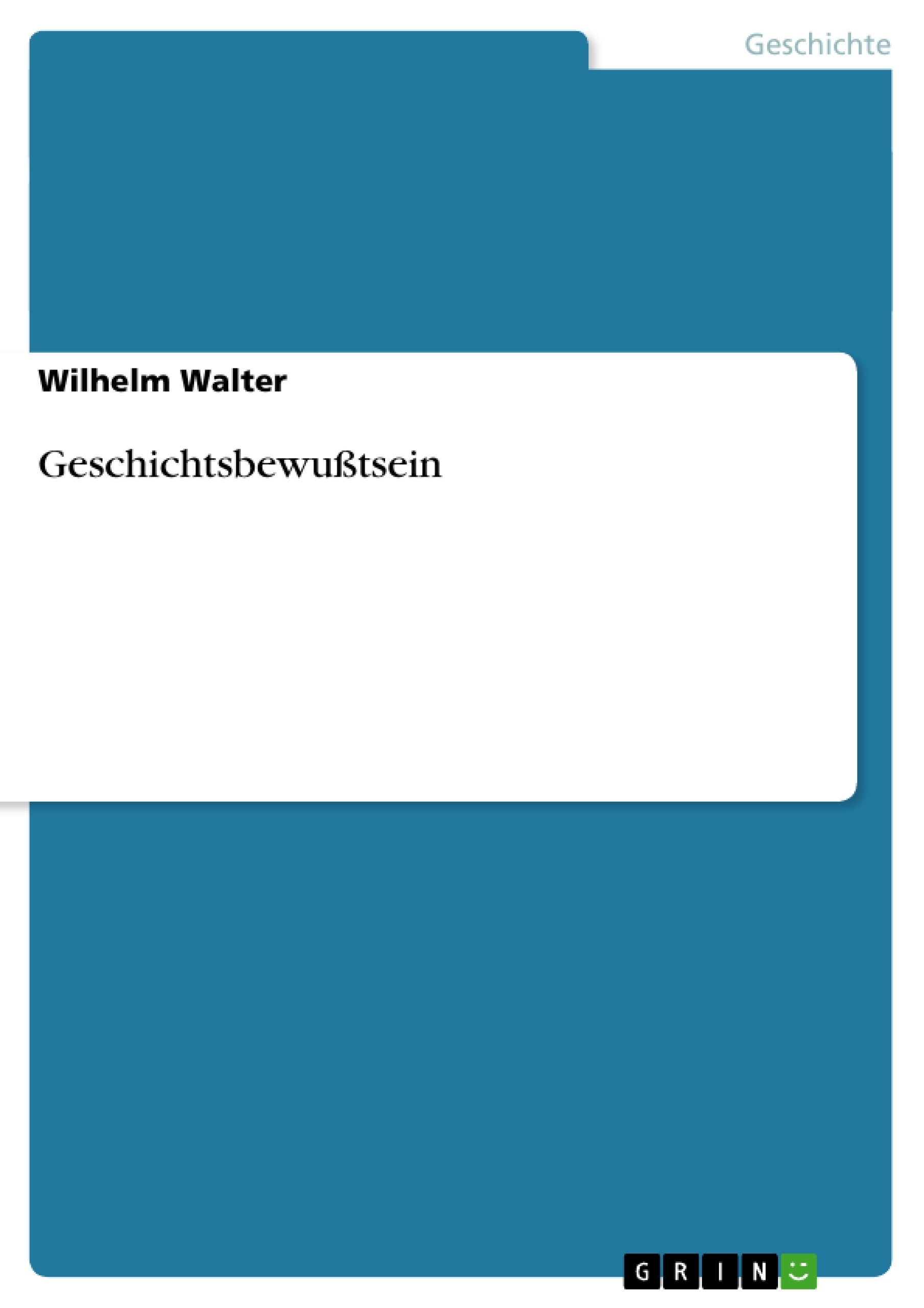Was bedeutet es wirklich, Geschichte zu verstehen? Diese tiefgreifende Analyse des Geschichtsbewusstseins entschlüsselt die komplexen Schichten, die unser Verständnis der Vergangenheit prägen. Anstatt sich auf bloße Faktenvermittlung zu beschränken, erkundet dieses Werk die fundamentalen Dimensionen, die es uns ermöglichen, historische Ereignisse zu interpretieren und in einen sinnvollen Kontext zu setzen. Von den Basiskategorien wie Zeitbewusstsein und Wirklichkeitsbewusstsein bis hin zu den sozialen Kategorien wie Identitätsbewusstsein, politisches, ökonomisch-soziales und moralisches Bewusstsein, werden die einzelnen Elemente beleuchtet, die unser Geschichtsbild formen. Wie unterscheiden wir zwischen Realität und Fiktion in historischen Erzählungen? Wie beeinflussen Machtverhältnisse unsere Wahrnehmung vergangener Ereignisse? Und inwiefern prägen unsere eigenen moralischen Vorstellungen unser Urteil über historische Figuren und Geschehnisse? Dieses Buch bietet nicht nur theoretische Einblicke, sondern auch praktische Überlegungen zur Vermittlung von Geschichtsbewusstsein im Unterricht und in anderen Bildungskontexten. Es zeigt auf, wie wir Kindern und Jugendlichen helfen können, ein differenziertes und reflektiertes Verständnis der Geschichte zu entwickeln, das über bloßes Auswendiglernen hinausgeht. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit Geschichtsdidaktik, politischer Bildung und der Entwicklung eines kritischen Geschichtsbewusstseins auseinandersetzen – ein Schlüssel zum Verständnis unserer Vergangenheit und zur Gestaltung unserer Zukunft. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Geschichtsbewusstseins und entdecken Sie die verborgenen Mechanismen, die unser Bild der Vergangenheit prägen. Dieses Buch ist ein Muss für Geschichtslehrer, Studierende der Geschichtswissenschaften und alle, die ein tieferes Verständnis für die Bedeutung von Geschichte in unserer Gesellschaft entwickeln möchten. Es bietet neue Perspektiven auf die Vermittlung von Geschichte und regt dazu an, tradierte Geschichtsbilder kritisch zu hinterfragen. Ein fundierter Beitrag zur Geschichtsdidaktik und zur Förderung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins.
Einleitung:
Thema des Referats sind die Dimensionen des Geschichtsbewußtseins.
Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Geschichtsbewußtsein ist wichtig, da dieser oftmals verwendet wird, ohne daß es eine verbindliche Definition gibt. Vor allem in der Politik, Geschichtswissenschaft und den Medien lassen sich unterschiedliche Tendenzen der Auslegung, Vorstellung des Begriffes feststellen.
Seit Ende der 60 er Jahre, befaßt sich auch die Geschichtsdidaktik intensiv mit dem Geschichtsbewußtsein. Auf diesen Wandel, der sich innerhalb der Geschichtsdidaktik vollzogen hat, bezieht sich der erste Teil des Referats.
Im zweiten und dritten Teil, werden die Kategorien des Geschichtsbewußtseins behandelt. Das Hauptaugenmerk wird auf den Erwerb der Kategorien, sowie deren Beitrag zum Verständnis von Geschichte.
Der letzte Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung im Unterricht und umreißt die Abläufe der Bildung des Geschichtsbewußtseins.
Geschichtsbewußtsein und Didaktik
Bis vor etwa 30 Jahren war der Gegenstand der Geschichtsdidaktik allein der, Geschichtsunterricht. Ihr Aufgabenfeld war dementsprechend eng gefasst, sie be- fasste sich mit dem Aufbau von Geschichtsunterricht, mit der Festlegung der Inhalte, dem sinnvollen Einsatz von Arbeitsformen, Medien und schließlich der Lernkontrolle.
Die so verstandene Geschichtsdidaktik war lediglich ein Teilbereich der allgemeinen Didaktik, sie war die theoretische Grundlage zu der Praxis des Unterrichts. Somit gehörte das Vermitteln eines Geschichtsbewusstseins nicht zu den Aufgaben der Geschichtsdidaktik. Dies hat sich Ende der 60er Jahre dadurch geändert, dass die Gechichtsdidaktik ihr Aufgabenfeld wesentlich erweiterte. Ihre Aufgabe war nicht mehr nur das Schulgerechte Vermitteln von Kenntnissen über die Vergangenheit im Unterricht, sondern alle Institutionen mit der Absicht der historischen Bildung wie z.B. Museen oder Ausstellungen sah und sieht sie immer noch als ihren Gegenstandsbereich an. In der Zwischenzeit ist aus der Geschichtsdidaktik eine eigenständige Wissenschaft geworden, auf der Grundlage der Frage danach, wie sich Individuen, Gruppen, Nationen, Gesellschaften jeglicher Art ins Verhältnis zu ihrer Vergangenheit setzen, wie sie sich in der Gegenwart historisch begreifen und wie sie, durch historisches Lernen, zu einem Geschichtsbewusstsein kommen1.
Die Dimensionen des Geschichtsbewußtseins
- Die sozialen Kategorien -2
Grundlage zum Erwerb der sozialen Kategorien ist die Ausprägung der Basiskategorien. Erst wenn eine Unterscheidung zwischen Fiktion und Wirklichkeit, bzw. ein Zeitbewußtsein vorhanden ist, kann der Schritt vom Märchenerzählen zum historischen Erzählen überwunden werden.
Die sozialen Kategorien verschaffen nun Zugang zu einem Bewußtsein über die Komplexität einer Gesellschaft.
Soziale Kategorien sind das:
1) Identitätsbewußtsein
2) politische Bewußtsein
3) ökonomisch- soziale Bewußtsein
4) moralische Bewußtsein
1) Identitätsbewußtsein
Fähigkeit zur Differenzierung verschiedener Gruppen, d.h. das Bewußtsein zu einer Gruppe ,,wir" bzw. ,,ihr" sagen zu können.
Sobald die ,,wir- Sichtweise" in Bezug zur zeitlichen Dimension gesetzt wird, also zu vergangenen Handlungen der Bezugsgruppe Identität gegründet wird, ist das Identitätsbewußtsein ein Strukturelement des Geschichtsbewußtseins.
2) Politisches Bewußtsein
Gemeint ist hier nicht das Wissen über politische Institutionen, sondern das Bewußtsein um Herrschaft.
In den Vordergrund rückt die Erkenntnis, daß in der Geschichte menschliche Gesellschaften stets durch asymmetrische Machtverhältnisse geprägt sind.
Obwohl Kinder früh ein Bewußtsein für das Phänomen Macht entwickeln, so kann dennoch auch später Einfluß auf das Erlernen von politischem Bewußtsein genommen werden.
3) Ökonomisch- soziales Bewußtsein
Ziel ist es bei Kindern die Wahrnehmung von sozialen Unterschieden und Ungleichheiten in historischen Darstellungen, sowie in ihrem sozialem Umfeld zu entwickeln. Die Differenzierung zwischen ,,arm" und ,,reich" ist bei Kindern schon sehr früh vorhanden. Problematisch jedoch ist ein Übertrag der Begriffe auf die eigenen Verhältnisse. So sind Kinder, die ihre Umwelt als arm einschätzen, oftmals davon überzeugt, daß dies ihre Eltern nicht betrifft. Eine Selbstlokalisation ist also schwierig. Außerdem neigen Schüler dazu den Zustand der Armut als eine von außen beinflußte Gegebenheit zu betrachten, während Reichtum oftmals als Ergebnis von Tüchtigkeit und wirtschaftlichem Geschick betrachtet wird.
4) Moralisches Bewußtsein
Gemeint ist hiermit die Klassifizierung historischer Zusammenhänge in ,,richtig" oder ,,falsch", gut oder schlecht. Historische Sachverhalte werden gewertet und zugrundeliegende Motivationen erfragt.
Nach Pandel besteht jedoch ,,keine völlige Klarheit, welche Bedeutung moralische Prinzipien für die Wahrnehmung und Deutung von Geschichte haben"3.
Fest steht jedoch, daß moralisches Bewußtsein bei Kindern im alltäglichen Leben und in hypothetischen Situationen früh zu finden ist. Eine Verknüpfung von moralischem Bewußtsein und dem Bewußtsein von Geschichtlichkeit erfolgt jedoch erst auf einer späteren lebensgeschichtlichen Stufe.
Die Dimensionen des Geschichtsbewußtseins
- Die Basiskategorien -
Das Geschichtsbewußtsein einzelner Individuen besteht aus einem System aufeinander verweisender Doppelkategorien, und zwar sieben an der Zahl. Diese können wir einteilen, ohne daß diese Einteilung etwas über die Wichtigkeit der einzelnen aussagt. In welcher Reihenfolge die jeweiligen Kategorien erworben werden, wissen wir noch nicht. Sicher ist, daß das Zusammenspiel der einzelnen Kategorien das Geschichtsbewußtsein jedes einzelnen ausmacht.
In dem Maße, in dem das Kind die folgenden grundlegenden Kategorien trennen und unterscheiden kann, ,,erwirbt es jenes kognitive Bezugssystem, ohne das es weder Geschichte verstehen noch Geschichte erzählen könnte."¹
Diese Kategorien sind:
1. Zeitbewußtsein (früher - heute 1 morgen)
2. Wirklichkeitsbewußtsein (real 1 historisch - imaginär)
3. Historizitätsbewußtsein (statisch - veränderlich)
4. Identitätsbewußtsein (wir - ihr 1 sie)
5. politisches Bewußtsein (oben - unten)
6. ökonomisch - soziales Bewußtsein (arm - reich)
7. moralisches Bewußtsein (richtig - falsch)2
Die ersten drei Kategorien der sieben Bewußtseinskategorien heißen Basiskategorien, die letzten vier nennt man soziale Kategorien.3
Diese Kategorien werden aber nicht unbedingt nacheinander erworben, sondern auch gleichzeitig.
1 Zeitbewußtsein
Zeitbewußtsein ist eine grundlegende Kategorie für das Erlernen von Geschichte, vor allem im Bezug auf die Unterscheidung der Zeitmodi. Gemeint ist hier, daß ein Kind die Begriffe ,,Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft" auseinanderhalten kann.
Früher wurden in den Schulen fast nur Daten auswendig gelernt. Aber: Geschichte ist ein Prozeß der Veränderung und darf somit nicht nur an einzelnen Fixpunkten von datierten Fakten festgelegt werden. Denn das Problem dabei war, daß ,,eine Fixierung auf datierbare Ereignisse langsam ablaufende Prozesse und Iangdauernde Strukturen übersah."4 Nach Pandel bleibt man so vorwiegend auf der Ebene der Ereignisgeschichte und hat diplomatiegeschichtlichen und außenpolitischen Charakter.5
Um in den verschiedenen Zeitmodi denken zu können, benötigt man die lebensweltliche Wahrnehmung der Zeitlichkeit von Erfahrung und Handeln. In der Sprache gibt es dafür Begriffe wie z.B.: gestern, heute, morgen,...
Darüber hinaus konkretisiert sich Zeitbewußtsein als Dimension von Geschichtlichkeit in vier Hinsichten:
1. Dichtigkeit der Ereignisse: d.h.: das Individuum besitzt für manche Zeitepochen mehr Wissen von Ereignissen dieser Epoche als von anderen. Dadurch drückt sich das jeweils konkrete und individuelle Zeitbewußtsein aus.
2. Länge der Zeitausdehnung: in Bezug auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es stellt sich also die Frage, wie weit das Geschichtsbewußtsein in die Vergangenheit zurück bzw. in die Zukunft vorausgeht.
3. Akzentuierung der Zeitdimension: d.h., daß Gesellschaften in bestimmten historischen Situationen und Epochen immer eine bestimmte Zeitdimension bevorzugen und diese dann für wichtiger halten als andere, da sie für die Gesellschaft mehr bedeutet. Sie können damit ihre eigene Lage besser verdeutlichen. Auch handeln manche Menschen mehr vergangenheits-, gegenwarts- oder zukunftsbezogen, je nach Einstellung.
4. Narrativierung von Zeit: d.h., die Umgliederung von wahrgenommenen und gelernten Ereignissen, wenn sie in die Geschichte eingehen. Also eine Umgliederung der Chronik der wahrgenommenen und gelernten Ereignisse in eine erzählende (narrative) Chronologie. Die chronologische Reihenfolge, in der die Ereignisse wahrgenommen werden, wird von uns in der Weise verändert, daß damit eine sinnvolle Geschichte entsteht.6
2.Wirklichkeitsbewußtsein
Die Aufgabe des Wirklichkeitsbewußtseins ist es, eine Grenze zwischen real und imaginär zu ziehen. Kinder müssen also lernen, daß es Personen und Handlungen gibt, die erfunden sind (z.B. Märchenfiguren), denn sie gehen in erster Linie davon aus, daß alles existiert. Man muß Kindern also klar machen, daß historische Personen und Handlungen nicht einfach ,,nicht - existierende", sondern nur gegenwärtig,,nicht - mehr - existierende" Sachverhalte sind7. Auch hier spielt die Dimension Zeitbewußtsein eine große Rolle, da das Kind erst durch die Unterscheidung der einzelnen Zeitmodi erkennen kann , was (historisch-) real bzw. imaginär ist. Es benötigt also das Verständnis Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Dieser Prozeß, der sich bei dem Wirklichkeitsbewußtsein abspielt ist jedoch kein Prozeß, der in jungen Jahren abgeschlossen wird, wie das folgende Beispiel zeigt:
Beispiel: Studentenbefragung in Osnabrück8: Bei der Beantwortung der Frage, ob Prinz Eisenherz real existiert hat, entschieden sich erstaunlicherweise 11,1% dafür, immerhin 73,5% ordneten ihn als imaginär ein und 13,2% konnten sich nicht entscheiden.
Manchmal ordnet der Mensch die Geschichte auch individuell ein, z.B. gab es die ,,gute" alte Zeit tatsächlich und vor allem wann? Für manche Menschen war es die Zeit in der vorindustriellen Phase9, für andere einfach als sie jung waren...
Selbst Mythen gehören zu dem Geschichtsbewußtsein, obwohl sie nicht real existiert haben. Auch hier wird es schwierig sein, dem Kind klar zu machen, daß Mythen nie real existiert haben, aber die Menschen sie früher meistens als real angesehen haben, und man sie heute benötigt, um die jeweilige Kultur bzw. Gesellschaft zu verstehen. Deshalb ist es eine wichtige Funktion der Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik, diese historischen Legenden und Mythen aufzulösen und das Wirklichkeitsbewußtsein zu schärfen.9
3. Historizitätsbewußtsein
Historizitätsbewußtsein bedeutet, daß jeder seine eigene Geschichte hat und auch ein Teil der Geschichte ist. Man muß sich bewußt sein, daß Personen und Verhältnisse sich ändern, verändern, aber auch gleich bleiben können, z.B. sie veralten, verjüngen, sterben aus...
Diese Kenntnis von Veränderlichkeit drückt Historizitätsbewußtsein aus, der die Erkenntnis von Geschichtlichkeit zugrunde liegt.10
Es gibt die lebensweltliche, erfahrene Historizität, die auf direktes Erfahren und Handeln bezogen ist. Die Personen und Gegenstände sind hier real präsent. Außerdem gibt es historische Ereignisse, die sich nur über Erzählungen und Aufschriebe erfahren lassen.11
In dieser Dimension ist das Wissen gemeint, daß Personen und Ereignisse sich in der Zeit verändern, aber bestimmte Dinge/Ereignisse konstant bleiben. Historizitätsbe-wußtsein ,"beinhaltet aber auch die Anwesenheit von alltäglichen ,,Geschichtstheorien" im Bewußtsein des einzelnen".12Darüber hinaus stellt es sich auch noch die Frage, was denn die Kräfte sind, die Geschichte verändern bzw. nicht verändern und was der Gegenstand von Geschichte ist.
Anmerkungen:
1 Karl-Ernst Jeismann
2 Vgl. Pandel, Hans -Jürgen: Dimensionen und Struktur des Geschichtsbewußtseins. In: Geschichtsunterricht im vereinten Deutschland: Auf der Suche nach Neuorientierung. Hans Süssmuth. Baden-Baden 1991, S.64-69.
3 Pandel S.68
[...]
1 Pandel, Hans-Jürgen: Dimensionen und Struktur des Geschichtsbewußtseins. In: Geschichtsuntericht im vereinten Deutschland: Auf der Suche nach Neuorientierung von Hans Süssmuth. Baden-Baden 1991, S.58.
2.ebd.: 5.58.
3.ebd. :S.59.
4.ebd. :S.60.
5.ebd. :5.60.
6.ebd.:S.60f.
7.ebd. :S.61f.
8.ebd. :S.61f.
9.ebd. :S.63.
10.ebd.:S.63.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Dimensionen des Geschichtsbewußtseins, die in diesem Referat behandelt werden?
Das Referat behandelt die Dimensionen des Geschichtsbewußtseins, wobei ein Schwerpunkt auf den Basiskategorien (Zeitbewußtsein, Wirklichkeitsbewußtsein, Historizitätsbewußtsein) und den sozialen Kategorien (Identitätsbewußtsein, politisches Bewußtsein, ökonomisch-soziales Bewußtsein, moralisches Bewußtsein) liegt.
Welche Rolle spielt die Geschichtsdidaktik im Zusammenhang mit dem Geschichtsbewußtsein?
Das Referat beschreibt, wie sich die Geschichtsdidaktik von einer auf den Geschichtsunterricht beschränkten Disziplin zu einer eigenständigen Wissenschaft entwickelt hat, die sich mit der Entstehung und Entwicklung des Geschichtsbewußtseins befasst.
Was sind die Basiskategorien des Geschichtsbewußtseins?
Die Basiskategorien umfassen Zeitbewußtsein (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), Wirklichkeitsbewußtsein (Unterscheidung zwischen Realität und Imagination) und Historizitätsbewußtsein (Erkenntnis der Veränderlichkeit und Konstanz von Personen und Verhältnissen im Laufe der Zeit).
Was sind die sozialen Kategorien des Geschichtsbewußtseins?
Die sozialen Kategorien beinhalten Identitätsbewußtsein (Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer Gruppe), politisches Bewußtsein (Bewußtsein um Machtverhältnisse), ökonomisch-soziales Bewußtsein (Wahrnehmung sozialer Unterschiede) und moralisches Bewußtsein (Bewertung historischer Zusammenhänge nach moralischen Kriterien).
Wie wird Zeitbewußtsein im Kontext des Geschichtsbewußtseins definiert?
Zeitbewußtsein beinhaltet die Fähigkeit, die Zeitmodi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden und die Wahrnehmung der Zeitlichkeit von Erfahrung und Handeln.
Was bedeutet Wirklichkeitsbewußtsein im Bezug auf Geschichte?
Wirklichkeitsbewußtsein ist die Fähigkeit, zwischen realen historischen Ereignissen und imaginären Vorstellungen zu unterscheiden. Es beinhaltet auch das Verständnis, dass historische Personen und Ereignisse nicht einfach "nicht-existierend" sind, sondern "nicht-mehr-existierend".
Was ist mit Historizitätsbewußtsein gemeint?
Historizitätsbewußtsein bedeutet das Bewußtsein, dass sich Personen und Verhältnisse im Laufe der Zeit verändern oder gleich bleiben können und dass jeder Teil der Geschichte ist. Es umfasst die Erkenntnis von Geschichtlichkeit und die Anwesenheit von alltäglichen "Geschichtstheorien".
Wie hängen die Basiskategorien und sozialen Kategorien zusammen?
Die sozialen Kategorien bauen auf den Basiskategorien auf. Erst wenn ein Kind die Unterscheidung zwischen Fiktion und Wirklichkeit (Wirklichkeitsbewußtsein) und ein Zeitbewußtsein (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) entwickelt hat, kann es die Komplexität einer Gesellschaft durch soziale Kategorien verstehen.
Welche Rolle spielt das moralische Bewußtsein bei der Interpretation von Geschichte?
Das moralische Bewußtsein ermöglicht die Klassifizierung historischer Zusammenhänge in "richtig" oder "falsch" und die Bewertung zugrunde liegender Motivationen. Die Bedeutung moralischer Prinzipien für die Wahrnehmung und Deutung von Geschichte ist jedoch komplex.
Wie kann das Gelernte im Unterricht umgesetzt werden?
Das Referat umreißt die Abläufe der Bildung des Geschichtsbewußtseins im Unterricht, geht aber nicht konkret auf die Umsetzung ein.
- Quote paper
- Wilhelm Walter (Author), 2001, Geschichtsbewußtsein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99567