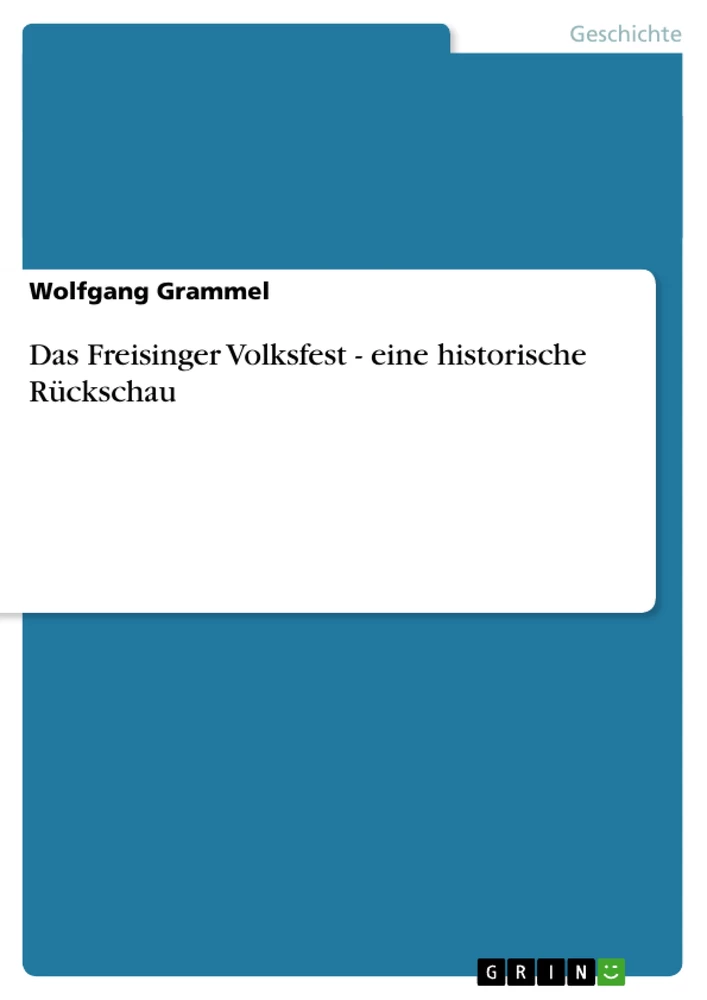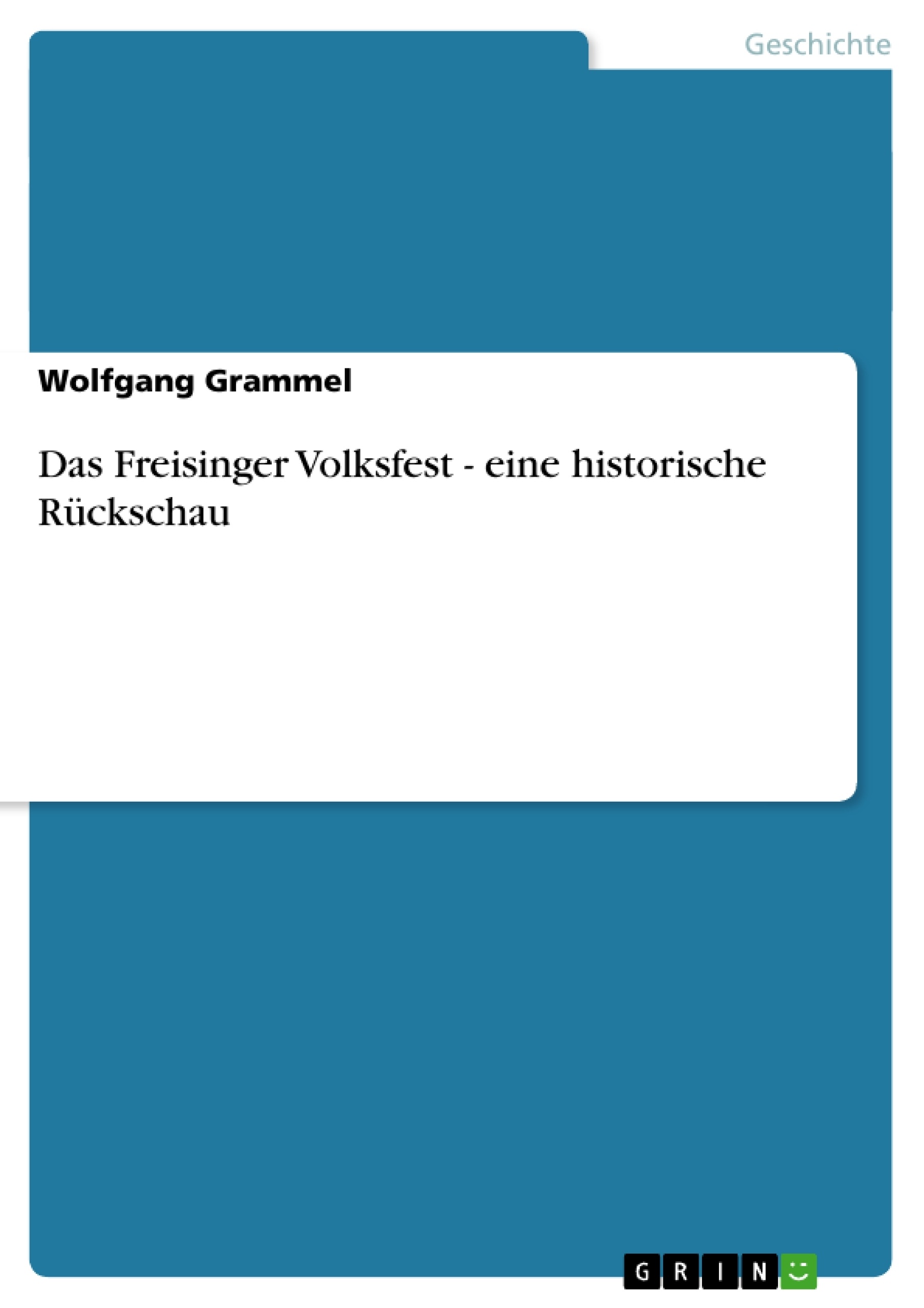Das Freisinger Volksfest - eine historische Rückschau 1874
Das Freisinger Volksfest feierte in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Seit 70 Jahren findet das Volksfest jährlich - mit Ausnahme der Kriegsjahre - statt, aber eigentlich wurde es schon vor 125 Jahren zum ersten Mal veranstaltet.
Wenn man heute den Anfängen des Freisinger Volksfestes auf den Grund gehen will, stößt man auf den engen Zusammenhang zwischen dem Volksfest, wie wir es heute kennen, und den Wanderversammlungen der bayerischen Landwirte, den Kreis- und Bezirkstierschauen, den Gewerbeschauen. Diese sind als Vorläufer der Volksfeste für den oberbayerischen Raum anzusehen.
In Freising fanden 1874 erstmals ein Volksfest und ein landwirtschaftliches Bezirksfest in Verbindung mit einer Ausstellung des Gewerbe- und Geflügelzuchtvereins statt. Am Donnerstag, den 2.September 1874, bekam der Freisinger Stadtmagistrat ein Schreiben des Sekretärs seiner Majestät des Königs von Bayern, Eisenhart, in dem dieser dem Festvorstand der Festkommission, Bürgermeister Mauermayr, für die Einladung zu dem an diesem Tage stattfindenden landwirtschaftlichen Feste den allerhöchsten Dank ausspricht. ,,Er sei überzeugt, dass die hiermit verbundenen Ausstellungen auf Landwirtschaft und Gartenbau, auf Industrie und Gewerbe, einen fördernden Einfluss ausüben werden." Mit dieser Aussage hat er auf die wichtige Funktion der landwirtschaftlich Tätigen und der Gewerbetreibenden bei diesem ersten in Freising abgehaltenen Fest hingewiesen, die auch in den folgenden Jahren erhalten blieb.
Die Reihenfolge der Festlichkeiten begann am 4. September mit einer Gewerbeausstellung in einer eigens hierfür geschaffenen Festhalle. Bei einer großen Verlosung konnten Handwerkserzeugnisse z.B. Salonmöbeln, eine Lancasterbüchse selbst ein Altarkelch bis hin zu einer Chaischen (kleiner Zweispänner) gewonnen werden. Am Samstag eröffnete der Glückshafen sowie die Ausstellungen des landwirtschaftlichen- und des Gartenbauvereins, nachmittags versammelten sich die Landwirte im Vereinslokal beim Urbanbräu (Kolosseum). Am Sonntag stellte sich der Festzug mit geschmückten Wägen und Fußgruppen auf der Steineckerwiese vor dem Münchner Tor auf und zog durch die Stadt über die alte Isarbrücke zum Festplatz in Lerchenfeld am heutigen Schwimmbad. Angeführt von den Turnern und dem Musikkorps folgten der Stadtmagistrat, das Collegium der Gemeindebevollmächtigten und das Festkomitee, dann die kgl. privilegierten Schützen, der Gewerbeverein, die prämierten gewerblichen und landwirtschaftlichen Handwerker und Arbeiter, der landwirtschaftliche Gartenbauverein, der Krieger- und Veteranenverein und die Gesellschaft Jungfreising. Im Zug befanden sich schön verzierte Wägen mit den Motiven Torfkultur und Torfstecherei, Schafzucht, Sommer und Winter und der Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr. Den Abschluss bildeten schließlich die Feuerwehren aus Freising, Massenhausen und Wartenberg mit ihren prächtigen Fahnen. Den schönsten Festwagen stellte Sebastian Wachinger, Besitzer der Sondermühle in Freising.
Während das Volksfestgelände mit seinen Festhallen und Buden, die Schießstätte mit ihren Schießständen und der Rennplatz mit seinen Tribünen auf die Gäste warteten, erfolgte am späten Nachmittag der Umzug der Rennpferde zum Rennplatz an der Isar (heutige westliche Schwabenau) mit anschließendem Pferdesprungrennen . Am Montag fand der Viehmarkt und der Schützenzug statt, während Dienstags früh eine große Hauptübung der freiwilligen Feuerwehr angesetzt war Am Nachmittag fieberten die Rennbegeisterten beim Trabrennen. Am Mittwoch wurden im Rahmen des Volksfestprogramms sog. ,,Volksbelustigungen" durchgeführt, z.B. Speerwerfen, Bockstechen, Ringstechen oder die Aufführung von Indianertänzen. Am 10. September klang das Fest mit einer großen Preisverteilung an die Schützen und nochmaligem Pferderennen aus.
Man sieht an dieser Aufzählung, dass zu dieser Zeit das Fest stark landwirtschaftlich geprägt war und auch die Pferderennen noch sehr großen Anklang bei der Bevölkerung fanden. Aber auch Schausteller, wie Schmids mechanischer Kunstsalon, der historische berühmte Personen lebensgroß mechanisch nachbaute oder große Landschaftspanoramen entstehen ließ, die Dressur eines großes Walrosses, eine Riesendame aus Sachsen, oder eine Elektrisiermaschine erfreuten die Besucher. Ein ,,Gang über die Isar" auf einem Stahlseil durch den Seiltänzer Neumann für 6 Kreuzer Eintritt war eine der Hauptattraktionen. Bei der Ostbahnverwaltung mussten sogar wegen Mangels an Personenwagen Güterwagen mit Sitzbrettern verwendet werden, um die Besucher und Teilnehmer aus München, Landshut und Moosburg nach Freising zu bringen. Keine Angaben über den Bierkonsum finden sich bei diesem ersten Freisinger Volksfest.
Das nächste Bezirks- und Volksfest fand erst wieder 1882 vom 8.-11. September statt. Zuvor ging bereits am 7. September eine Ausstellungseröffnung des technischen Vereins, diesmal in den Sälen der kgl. Ralschule voran. Im Hofraum und den unteren Räumen gaben die Firmen Steinecker, die Maschinenfabrik des Vorschussvereins, die Mühlenbauanstalten Walter und Führer, der Steinmetzmeister Franz und die Herdfabrik Reuchl Einblicke in Betrieb und Produktion; weiterhin zeigten auch die Schäffler, Schmiede, Maurer, Schuhmacher, Pelzmacher; Sattler, Polsterer, Bürstenmacher, Buchbinder, Drechsler und Wagner besondere Schaustücke, sogar die armen Schulschwestern präsentierten ihre mühevoll handgestickten Teppichwaren. Die Steinzeugfabrik Hauber & Reuther und die Zinngießereien Reill und Hiedl, der Instrumentenmacher Krinner, die Hütemacher und Modistinnen waren ebenso vertreten wie die Conditoren. Am Freitagnachmittag stellte sich der Festzug vor dem Veitstor auf und zog durch die Hauptstraße, die Landshuterstraße und über die alte Isarbrücke zum Festplatz nach Lerchenfeld. Auch eine Besichtigung des kgl. Staatsgutes und der Central Landwirtschaftsschule Weihenstefan war am Sonntag vorgesehen.
Pferdeprämierungen, Viehverlosungen, Pferde- und Sprungrennen, wie schon beim Fest 1874, ergänzten das Programm. Im Rathaussaal fand zusätzlich eine Geflügelzuchtvereins- ausstellung mit einer Glückshafenverlosung statt.
Neu war, dass zum ersten Mal ein großes Abschlussfeuerwerk abgehalten wurde und dass der Festplatz mit Hilfe einer ,,Locomobile" elektrisch beleuchtet war, allerdings erhellten die acht Flammen - laut dem Freisinger Tagblatt - den Platz nur sehr spärlich.
In den prächtig dekorierten Raümen der Realschulaula fand die Kreiswanderversammlung des landwirtschaftlichen Vereins statt. Die Professoren Holzner, Lehnert und Albrecht hielten Vorträge.
Die Gewerbe- und Gartenbauausstellung von 5.-12. September fand diesmal gemeinsam in den Räumen der Realschule statt und war mit 65 Austellern ein Schwerpunkt der Festveranstaltungen 1888.
Auf der Festwiese waren vom 7. -11. September Buschs großes Kaiser- und Königsmuseum und Bayers große Tiermenagerie, eine Tierschau u.a. mit Büffeln, Tigern, Jaguaren, Bären und Wölfen, die Attraktionen. Beim Kaisermuseum handelte es sich um ein beleuchtetes Museum, in dem Gemälde von berühmten Persönlichkeiten und Panoramen eindrucksvoller Landschaften und Kunstdenkmälern ( Peterskirche), sowie auch lebensgroße Wachsfiguren, wie z. B. Kaiser Wilhelm, bei einem Eintrittspreis von 20 Pfennig stilvoll präsentiert wurden. Eine Karawane von Aschantinegern machte ebenfalls ihr Lager auf der Festwiese auf. Im Urbansaale fand wiederum die Kreiswanderversammlung des landwirtschaftlichen Vereins statt, die bayerischen Gewerbevereine tagten in der Aula der Realschule und die Delegierten- versammlung des oberbayer. Kreisgeflügelzuchtvereins im Magistratsgebäude. Anhand der in den Jahren auf der Festwiese vorhandenen Karussells konnte man die rasche Entwicklung der Technik verfolgen: am Anfang Handbetrieb, dann Pferdebetrieb, nun Dampfbetrieb. Alles lief 1888 zum neuen Dampfkarussell mit seiner elektrischen Beleuchtung, die anderen standen leer. Ein einstündiges Feuerwerk beschloss das Fest.
Man kann es sich nur wünschen, dass es so ein verregnetes und stürmisches Volksfest wie 1899 nicht noch einmal in der Geschichte von Freising gibt.
Dabei war das Fest vor 100 Jahren vom Volksfestausschuss mit dem kurz vor seiner Pensionierung stehenden Bürgermeister Mauermayr, sowie den Magistratsräten Johann Baptist Entleutner und Ludwig Ostermann gut vorbereitet und sollte die vorangegangenen Volksfeste übertreffen. Vom frühen Morgen des 8. September - damals mit Mariä Geburt noch ein Feiertag - strömten Menschen in die Stadt. Die Bahn hatte ihren Betrieb durch sieben Sonderzüge verstärkt, ein Gesuch des Magistrats um Fahrpreisermäßigung für die Festbesucher an den Haupttagen wurde jedoch abgelehnt. Auf Gäuwagen, zu Fuß und per Fahrrad kamen die Leute aus der Umgebung und bis von München und Landshut her und mischten sich unter die an den Straßen bereits mit aufgespannten Regenschirmen postierten Freisinger Bürger, denn pünktlich um zehn Uhr hallte Musikklang durch die festlich geschmückte Stadt. Mit Blasmusik marschierte die kgl. privilegierte Feuerschützengesellschaft, samt ihren auswärtigen Gästen, vom Duschlbräu zur neu hergerichteten Schießstätte mit Tribüne, wo während des Volksfestes auf acht Ständen ein Preisschießen ausgetragen werden sollte. Zur gleichen Zeit waren auch die Kriegerschützen des Freisinger Krieger- und Kampfgenossenvereins mit Musik unterwegs zum Volksfestplatz, wo bald auf provisorischen Ständen die Zimmerstutzen knallten.
Der Festzug
Um ein Uhr mittags setzte sich beim Karlwirt ein Festzug in Bewegung, der alle bisherigen übertraf. Er zog durch die gesamte Hauptstraße, durch die Landshuter Straße in Richtung Neustift, durch die Kasernstraße (jetzt Dr.-von-Daller-Straße) wieder herein und schließlich über die Isarbrücke zum Festplatz, der sich mit Buden, Zelten, Schaukeln, Tribünen und Karussells zwischen der Erdinger und der Ismaninger Straße fast bis hinaus zur Gaststätte Grüner Hof ausdehnte.
Der Zug gliederte sich in drei Abteilungen, deren jede von einer Musikkapelle angeführt wurde. Es beteiligten sich alle Freisinger Vereine, entweder zu Fuß und mit Fahne oder mit fantasievoll ausgestatteten Festwagen. Besonderes Aufsehen erregte der Wagen "Flora" der Freisinger Gärtner und der Weihenstefaner Eleven wegen seiner geschmackvoll arrangierten Blumenpracht, während der katholische Gesellenverein auf vier Rädern eine wurzelstarke Eiche als Sinnbild der Eintracht präsentierte. Die Kaufleute ließen ein Schiff durch die Stadt rollen, das mit Fracht aus Übersee beladen und von einer Dame und vier Herren begleitet war, welche die fünf Erdteile darstellten. Der Turnverein, die Gesellschaft Bergrose, die Gesellschaft Linde, der Bienenzuchtverein, der Kriegerverein, die Kaufleute und die Brauer stellten weitere Wägen. Den größten Beifall der vielen Zuschauer bekam der Wagen der Stadt, auf dem die "Dame Frisinga" thronte, von acht Pagen lieblich eingerahmt. Auch die Gemeinden Langenbach und Tünzhausen schickten einen Wagen.
Unauffällig, aber wirkungsvoll, überwachten die Ordnungskräfte das Volksfest. Zwei städtische Schutzleute waren am Bahnhof postiert, die anderen streiften über den Festplatz und bewachten die Abstellmöglichkeiten für Velozipeds unweit der Isarbrücke, während die Landgendarmen sich in der Stadt zur Verfügung hielten. Auch die Freiwillige Feuerwehr Freising hielt Tag und Nacht auf dem Festplatz eine Brandwache.
Auch seine königliche Hoheit Prinz Arnulf, kommandierender General des ersten bayerischen Armeekorps, traf in der Stadt ein, aß im Bayerischen Hof und besichtigte das Manövergelände in Nandlstadt. Den Großteil der Neustifter Garnison hatte man aber höheren Orts ins Manöver geschickt, so dass die jungen, heimatfernen Soldaten - als Unruhestifter bei vielen öffentlichen Ereignissen gefürchtet - überhaupt nicht in Erscheinung traten. Inserate, Vorschauen und Mundpropaganda ließen auf dem Lerchenfeld wahre Wunderdinge erwarten. Schon auf der Isarbrücke sahen die Volksfestbesucher, dass am östlichen erhöhten Brückenkopf ein mächtiges Eisengestell aufragte, das die Drahtleitungen des Elektrizitätswerkes Dr. Datterer aus der Stadt über die Isar hob und sie dann hinab in die Buden, Zelte und Ausstellungshallen des Volksfestes leitete.
Die Schausteller
Auf dem Volksfestplatz selbst floss das Bier der Aktienbrauerei, des Hofbräuhauses, des Seiderer-Bräus und Weihenstefans noch getrennt in vier größeren Wirtsbuden in die durstigen Kehlen, die Maß um 30 Pfennig, wovon drei Pfennig an die Stadt abzugeben waren. Der magistratische Kontrolleur musste beim Abladen des Bieres die Nummern und den Inhalt der Fässer kontrollieren und in einem Verzeichnis festhalten Unter Fahnen und Girlanden schob sich die Menge der Besucher durch die Zelt-, Buden- und Attraktionenstadt, begleitet vo der Drehorgelmusik an den Karussells und Schiffschaukeln. Was gab es da aber auch alles zu sehen und zu hören:
Der Münchner Direktor Schichtl lud zu "großen, brillanten Vorstellungen" ein, bei denen 32 Künstler "Zauber-, Geister- und Pantomimentheater" vorführten. In "Straßbergers Central- Circus" zelebrierten Damen- und Herrenreiter die hohe Kunst der Dressur, während man im "Zirkus Hagenbeck" vier japanische Zwergpferde bewunderte, so klein, dass man sie in den Arm nehmen" konnte; dazu auch den "kleinsten Hirsch der Welt", nur 30 cm hoch und ganze sechs Pfund schwer. Ein paar Schritte weiter pries ein Ausrufer "Rußlands größten Soldaten a.D." an, den 2,41 Meter großen Riesen Pisjak, der 375 Pfund Gewicht zur Schau stellte; an anderer Stelle lud einer die Gaffer ein, "Deutschlands größtes und schwerstes Riesenmädchen Ella", erst 12 Jahre alt, zu bestaunen, neben dem als Gegensatz das Zwergfräulein Feodora aus Paris auf einem Stühlchen thronend Handarbeiten verrichtete, obwohl ihre Hände und
Füße wie Löwentatzen ausgebildet waren. "Günthers Flohzirkus" ließ gleich 200 Künstler springen, tanzen und fechten. Weitere Schaubuden, wie eine chinesische Plattenbude, Fotografen, Hundetheater, Seiltänzer, sowie Kraftmaschinen, Elektriseure, Waffelbäcker und verschiedene Musiker lockten die Gäste an. Als Volksbelustigungen waren noch weitere Wettbewerbe wie Ringelstechen zu Pferd, Hunderennen, Schubkarrenrennen etc. geplant. Die Geschäftsbesitzer kamen überwiegend aus dem süddeutschen Raum (Regensburg, München, Stuttgart, Ulm, Würzburg, Nürnberg) aber auch aus Zwickau und Hamburg. Im Glückshafen konnte man Fortuna auf die Probe stellen, Karussells und Schaukeln luden mit lautstarker Musik zu Gaudi und Umtrieb, kurzum, alle Besucher waren sich einig, dass Freising ein würdiges Fest gerichtet hatte.
Auch wenn 1899 der Festplatz mit seinen Geschäften deutlich vergrößert war, sollte nicht nur das Vergnügen sein Recht bekommen:
Wiederum gab es eine landwirtschaftliche Ausstellung mit Tierprämiierung in einer von der Stadt eigens errichteten Halle, eine Bienenzucht-Ausstellung, eine Fischereischau, zu der frisches Isarwasser durch eine Pumpanlage heraufgeholt wurde sowie eine Geflügelausstellung in den Rathaussälen. In der Realschule hatte man Gelegenheit Lehrmittel und Lehrlingsarbeiten zu besichtigen, und schließlich fanden wieder Versammlungen und Fachtagungen der ausstellenden Verbände statt.
Trotz der umfangreichen Vorbereitungen und der Bedeutung des Festes für die gesamte
Region sahen sich die eingeladenen Mitglieder des Königshauses "zu höchstdero Bedauern" nicht in der Lage, einer "untertänigsten Einladung" Folge zu leisten, was vor allem die Honoratioren ärgerte, die sich so viel Mühe gegeben hatten.
Der Wettersturz führt zum Abbruch
Einen entscheidender Faktor für das Gelingen des Festes stellte allerdings wie immer das Wetter dar. Die Zeitungen hatten schon vor einigen Tagen gemeldet, dass die Isar im Gebirg infolge starker Regenfälle um 1.40 Meter gestiegen war und so war man über die ersten vereinzelten Regenschauer am Freitagvormittag schon in Sorge.
Wenn auch bei der Eröffnung das Wetter hielt, so begann der Samstag bereits mit schweren Regenfällen, die erst am Nachmittag etwas aufhörten, als das Velozipedrennen auf rutschiger Bahn vor sich ging. Abends schüttete es dagegen wieder so arg, dass die Turner ihre Vorführungen absagen mussten.
Als am Sonntag dann schon frühmorgens ein heftiger, nasskalter Sturm die Fahnen auf dem Festplatz zerfetzte und die Stangen knickten, fürchtete man das Schlimmste. Ab neun Uhr klarte es aber auf und die lachende Sonne lockte von nah und fern große Zuschauermassen an. Schon um ein Uhr beim großen Radfahrrennen schüttete es dann erneut so, dass die völlig durchweichten Radfahrer ihre Stadtrundfahrt abbrechen mussten. Auch das stark besuchte Pferdesprungrennen am Nachmittag ging nur mit Galgenhumor über die schlüpfrige Bahn und die Zuschauer froren unter ihren Regenschirmen.
Wirte und Schausteller klagten laut über den wetterbedingten "Erlösentgang" und so ließ sich der Stadtmagistrat erweichen, das Fest bis Donnerstagabend um zehn Uhr zu verlängern. Darauf kündigte das Festkomitee für den Mittwoch weitere Attraktionen an: Hunderennen, Sackhüpfen, Schubkarrenrennen, Hosenlaufen und Ringelstechen zu Pferd, und am Abend wollten endlich die Turner ihre immer wieder verschobenen Vorführungen an den Mann bringen.
Am Montag, den 11. September, ertrank früh um 8 Uhr die große Pferdemusterung samt Preisverteilung fast im unablässig strömenden Regen und um zwei Uhr hagelte es sogar noch auf die Dächer, Zelte und die schon völlig durchweichten Plätze, Wege und Wiesen. Die Zeitung beschrieb die deprimierende Lage so:
"Trübselig stehen die Buden auf dem durchweichten, kalten Volksfestplatz, watschelnass hängen die zerrissenen Fahnen an den schief gewordenen Stangen, Pfützen und Lachen machen es den Budenbesitzern fast unmöglich, mit ihren schweren Wägen aus den versumpften Wiesen herauszukommen. Dazu kommt noch die Überschwemmungsgefahr, denn die Isar bespült schon die Dämme und ist noch immer im Steigen begriffen. Die Straße zum Geflügelhof steht unter Wasser."
Nur der Wirt des Grünen Hofes konnte sich über dieses Wetter freuen, da er jeden Abend den Tanzsaal bis auf den letzten Platz füllen konnte. Aber auch der Bierkonsum auf dem Festplatz war trotz des miserabelen Wetters - wie sich später herausstellte- mit 310 hl (104 hl Seiderer und Eichner, Kolosseum, 95 hl Hofbräu, 66 hl Weihenstefan, 45 hl Aktienbrauerei 45) recht beachtlich.
Am Dienstag wurde es dann angesichts des weiter steigenden Wasserpegels und alarmierender Nachrichten aus München und dem Oberland klar, dass die Verlängerung ein verhängnisvoller Entschluss war. Hastig fingen die Fieranten am Mittwochmorgen mit dem Abbau ihrer Buden und Fahrgeschäfte an, getrieben von der Angst vor dem ansteigenden Isarstrom, der gegen Mittag an der Ismaninger Straße über die Dammkrone strömte und schmutzig graue Rinnsale über die Festwiese fluten ließ.
Um drei Uhr gab der Kommandant der Freisinger Feuerwehr Alarm. 48 Mann rückten eilig zum Festplatz aus. Eine Abteilung hatte große Mühe, Frauen, Kinder und Tiere in Sicherheit zu bringen, ebenso mussten steckengebliebene Wagen auf die Isarbrücke gezogen werden. Eine andere Abteilung schaffte einen mit Stroh und Steinen beladenen Wagen heran und besserte mit diesem Material den brüchigen Damm an der Ismaninger Straße aus. Als es dunkel wurde, rückten die Feuerwehrleute, die sich inzwischen auf 100 Mann verstärkt hatten, wieder ab. Auf der Festwiese war nichts mehr zu retten. Die Reste der einstigen Pracht ragten, ebenso wie die Häuser der Lerchenfelder, aus einem riesigen See. Die Leute auf dem Lerchenfeld - nicht zum ersten Mal in Wassersnot - hatten Rechtzeitig ihr Vieh nach Attaching oder in hochgelegene Ortsteile Freisings getrieben und hockten nun in den Speicherkammern, die bewegliche Habe um sich aufgetürmt. Als Trommeln und Hörner nachts um drei Uhr erneut die Feuerwehr alarmierten, galt der Einsatz den Uferstadtteilen auf der linken Isarseite. Der Damm war zwischen Mintraching und Achering geborsten, die ausströmenden Fluten vereinigten sich mit dem Hochwasser der Moosach, der Bahndamm bei Pulling wurde unterspült und der Zugverkehr kam zum Erliegen.
Nun drangen die Wassermassen aus dem Freisinger Moos nach Freising herein, setzten das Bahnhofs- und Fabrikviertel unter Wasser, ließen gegen fünf Uhr früh das Elektrizitätswerk Datterer absaufen und wüteten dann durch die Enge zwischen Domberg und Bahndamm hinaus in die Kasern- und Sonnenstraße, um endlich Neustift so zu verheeren, dass dort Mensch und Tier sich auch in Sicherheit bringen mussten.
Am Freitag endlich begann das Wasser zu sinken, die Fluten verliefen sich allmählich und nun wurden die Schäden sichtbar. Das Lerchenfeld war verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Immerhin gab es unterhalb des Geflügelhofes auf 30 Meter Länge keine Ismaninger Straße mehr und mit welcher Wut dort die Fluten gehaust hatten, bewies eine Auswaschung von 4,50 Meter Tiefe. Viel schlimmer erwischte es die Bewohner in Neustift, welche am linksseitigen Ufer der Herrenmoosach lagen, die Sondermühle mit dem Sägwerk und die Einwohner im Fabrikviertel. Sie mussten größtenteils ihre unter Wasser stehenden Wohnungen, Fabriken und Gärten verlassen.
Hilfsaktionen zur Linderung der Not
Eine Welle der Hilfsbereitschaft ging durch das Land, denn alle Flüsse zwischen Isar und Inn hatten ihre Anlieger geschädigt und schließlich auch der Donau ein Katastrophenhochwasser zugeführt. Der Prinzregent stellte aus seinem Privatfonds 50.000 Mark zur Verfügung, von denen 500 Mark sogleich nach Freising überwiesen wurden. Von der Regierung von Oberbayern kamen 1.000 Mark "zur Verhütung von Krankheiten und Epidemien und zur raschen Entfeuchtung und Reinigung der mit Wasser und Schlamm angefüllten Wohngebäude."
Schon am 20. September bildeten in Freising Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein Hilfskomitee, das in der Zeitung um Spenden bat. Die Liedertafel veranstaltete ein Wohltätigkeitskonzert und der Turnverein spendete die Eintrittsgelder eines Variete den Hochwassergeschädigten.
Es handelte sich wirklich um eine "Jahrhundertkatastrophe", denn die Hochwasser von 1833,1840,1851 und 1853 hatten zwar das Lerchenfeld heimgesucht, die hölzerne Isarbrücke zerstört und auch Menschenleben gekostet, aber Schäden derartigen Ausmaßes wie 1899 waren noch nie aufgetreten. Diese Erfahrung aus diesen Hochwassern hatte u.a. die Erhöhung des Fürstendamms zur Folge, der ebenso wie der Bau der neuen, steinernen Isarbrücke 1894 den Wassermassen trotzte und die Verbindung nach Lerchenfeld nicht abreißen ließ.
1922-1926
Scheinbar hatte diese Katastrophe bei den Freisingern viele Jahre nachgewirkt. Erst 1922 sind wieder erste Bemühungen zur Abhaltung eines Volksfestes aktenkundig. Erstmalig befasste sich der Verwaltungsauschuss der Stadt am 13. Februar 1922 mit der Möglichkeit, das Volksfest in der Luitpoldanlage abzuhalten. Hierzu mussten aber erhebliche Aufwendungen für Zufahrtsstraßen, Elektrifizierung, Kanal-, Wasserabschluss und die Instandsetzung von Brücken und Wegen gemacht werden.
Hierfür wären mindestens 140.000 Mark nötig. Der Wert dieser Maßnahmen für spätere Veranstaltungen, auch für die weitere Nutzung von Vereinen und Gesellschaften wurde als gering erachtet. Der Eisplatz als geschlossener Festplatz wurde erwogen, aber als zu klein verworfen, auch der neue Turnplatz der Turngemeinde in Lerchenfeld an der Erdingerstraße wurde geprüft. Als Veranstaltungstermin legte man die Woche vom 12. -19. August fest. Noch im April und Mai wurde ein Festzug geplant und Anmeldungen für die Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen entgegengenommen.
Es wurde für eine Bierhalle mit etwa 4000 Personen Fassungsvermögen bei verschiedenen Leihgebern angefragt. Auch wurde immer wieder über eine Eintrittsgebühr für den Festplatz von ca. einer Mark gesprochen. Vor allem der elektrische Anschluss mit der Legung einer Gleichstromanlage oder der Bereitstellung einer Lokomobile schaffte bauliche bzw. finanzielle Probleme.
Wahrscheinlich aus den oben genannten Problemen kam es 1922 dann doch nicht zu einem Volksfest. Der dann für September 1925 vorgesehene Termin wurde wegen Ausbruchs einer Maul- und Klauenseuche im Verwaltungsbezirk Freising-Stadt auf den 6.-13. September 1926 verschoben. Aber auch dieser Termin wurde nicht eingehalten. Den Stadtvätern erschien vor allem das finanzielle Risiko zu groß.
Erst 1929 durften sich die Freisinger, und von nun ab - außer in den Kriegsjahren - jedes Jahr aufs Neue, wieder über ein Volksfest freuen. Vom 31. August bis zum 9. September kamen zur Eröffnung sogar der Regierungspräsident Ritter von Knözinger, Landwirtschaftsminister Dr. Fehr und der Präsident der Handwerkskammer, Geheimrat Würz.
Zwanzig Ausstellungen, vornehmlich im Zeichen der Landwirtschaft, prägten das Volksfest 1929 in einem Maße, wie es die Stadt bisher nicht mehr erlebt hatte. Im Knabenschulhaus St. Georg fand in 12 Sälen eine Kunst- und Gewerbeschau statt. Unter den Künstlern stellten bekannte Namen wie die Maler Nickl, Landgrebe, Schwarzenbacher, Lamprecht und Kohlbrand ihre Werke und Techniken vor. In einer neuen großen Halle des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins gaben sich Wissenschaft und Forschung ein Stelldichein. Ein Höhepunkt der Festfolge war zweifellos der große Festzug am Sonntagnachmittag mit über 20 Gruppen und 15 großen Festwagen. Der Rennverein führte wieder sieben Rennen durch, der ADAC lud zur Sternfahrt nach Freising mit abschließendem Blumenkorso. Die 35. Kreiswanderversammlung des Landwirtschaftlichen Vereins fand im Kolosseum statt und es wurden verschiedene Wiedersehensfeiern für ehemalige Garnisonsangehörige und Studierende Weihenstefans abgehalten. Sogar eine Festpostkarte mit dem Freisinger Mohren und ein ausführlicher Programmführer zur Festfolge, bei dem sogar die einzelnen Positionen des Feuerwerks auf einer Seite ausführlich beschrieben wurden, erschien zum Fest.
Der neue Volksfestplatz, erstmals in den Luitpoldanlagen mit dem großen Bierzelt von Festwirt Schneider wurde mit hohem finanziellen Aufwand von der Stadt geschaffen. Hier befand sich noch bis vor wenigen Jahren der Luitpoldpark mit zwei großen Weihern. Bei seiner Rede an die Vertreter der Presse, - geladen und gekommen waren Vertreter aus verschiedenen Städten und Märkten in der näheren und weiteren Umgebung ebenso wie auch aus der Landeshauptstadt - betonte Bürgermeister Bierner, ,,dass man diese hohen Aufwendungen für das Volksfest doch bitte auch durch fleißigen Besuch aus dem Umland und vor allem auch aus München, das einen Großteil der wirtschaftlichen und steuerlichen Kraft unserer Bevölkerung absolbiere, belohnen solle". Überhaupt war schon im Vorfelde eine für die damalige Zeit sehr große Werbekampagne gestartet worden. Schon Ende Juli begann das Freisinger Tagblatt in mehreren Artikeln und Anzeigen auf das Fest und seine Abfolge hinzuweisen.
Wenn auch die zum Abschluss im Bierzelt veranstaltete große Damenschönheitskonkurrenz von der Stadtspitze als unpassend und störend empfunden wurde, so begann mit diesem Volksfest von 1929, dass von nun an jedes Jahr abgehaltenen wurde, endgültig die lange Freisinger Volksfesttradition.
Quellen und Literatur:
Stadtarchiv Freising
Altaktenbestand I, Nrn. 1-3, 5-10
Altaktenbestand II, Nrn. 72,73,82,84,85,97
Freisinger Tagblatt
1874,1882,1888,1899,1929 (darin Aufsatz von R. Birkner über das Volksfest 1899)
Festschrift zum Volksfestjubiläum 1929
Gruber, Hans:
Felder, Lerchen und unsere Stadt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hintergrund des Freisinger Volksfestes laut dem Text "Das Freisinger Volksfest - eine historische Rückschau 1874"?
Das Freisinger Volksfest hat seinen Ursprung in den Wanderversammlungen der bayerischen Landwirte, den Kreis- und Bezirkstierschauen sowie den Gewerbeschauen.
Wann fand das erste Freisinger Volksfest in Verbindung mit einem landwirtschaftlichen Bezirksfest und einer Gewerbeausstellung statt?
Das erste Fest dieser Art fand 1874 statt.
Welche Art von Ausstellungen gab es im Jahr 1874 auf dem Freisinger Volksfest?
Es gab eine Gewerbeausstellung, eine Ausstellung des landwirtschaftlichen- und des Gartenbauvereins.
Wie verlief der Festzug im Jahr 1874?
Der Festzug startete auf der Steineckerwiese vor dem Münchner Tor und zog durch die Stadt zum Festplatz in Lerchenfeld. Beteiligt waren Vereine, Handwerker, Landwirte, Feuerwehr und geschmückte Wägen mit verschiedenen Motiven.
Welche Attraktionen gab es neben den landwirtschaftlichen Ausstellungen auf dem Freisinger Volksfest 1874?
Es gab Pferderennen, Schausteller wie Schmids mechanischen Kunstsalon, die Dressur eines Walrosses, eine Riesendame, eine Elektrisiermaschine und einen Seiltänzer.
Wann fand das nächste Bezirks- und Volksfest nach 1874 statt?
Das nächste Fest fand 1882 statt.
Was war neu beim Volksfest 1882?
Es gab zum ersten Mal ein großes Abschlussfeuerwerk und der Festplatz wurde elektrisch beleuchtet.
Welche Attraktionen bot das Freisinger Volksfest im Jahr 1888?
Zu den Attraktionen gehörten Buschs großes Kaiser- und Königsmuseum, Bayers große Tiermenagerie und eine Karawane von Aschantinegern.
Wie war das Wetter beim Volksfest 1899 und welche Auswirkungen hatte es?
Das Volksfest 1899 war von starkem Regen und Sturm geprägt, was zu einem vorzeitigen Abbruch und Überschwemmungen führte.
Welche Vereine und Gruppen beteiligten sich am Festzug im Jahr 1899?
Es beteiligten sich alle Freisinger Vereine, Kaufleute, der Turnverein, der katholische Gesellenverein, die Gesellschaft Bergrose, die Gesellschaft Linde, der Bienenzuchtverein, der Kriegerverein und die Brauer.
Welche Schausteller und Attraktionen gab es auf dem Volksfest 1899 trotz des schlechten Wetters?
Es gab den Zirkus Schichtl, den Zirkus Hagenbeck, Riesen und Zwerge zur Schau gestellt, Günthers Flohzirkus und verschiedene weitere Schaubuden und Musiker.
Was wurde trotz des schlechten Wetters 1899 an Ausstellungen angeboten?
Es gab eine landwirtschaftliche Ausstellung mit Tierprämiierung, eine Bienenzucht-Ausstellung, eine Fischereischau und eine Geflügelausstellung.
Wann fanden nach der Katastrophe von 1899 wieder erste Bemühungen zur Abhaltung eines Volksfestes statt?
Erste Bemühungen gab es 1922.
Wann fand das nächste Freisinger Volksfest nach den Bemühungen ab 1922 statt?
Nach den Bemühungen 1922 fand das nächste Freisinger Volksfest erst 1929 statt.
Welche Besonderheiten prägten das Volksfest 1929?
Das Volksfest war stark landwirtschaftlich geprägt, mit zwanzig Ausstellungen, einer Kunst- und Gewerbeschau und einem großen Festzug. Es gab sogar eine Festpostkarte und einen detaillierten Programmführer.
Wo fand das Volksfest 1929 statt?
Es fand in den Luitpoldanlagen statt.
- Quote paper
- Wolfgang Grammel (Author), 2000, Das Freisinger Volksfest - eine historische Rückschau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99544