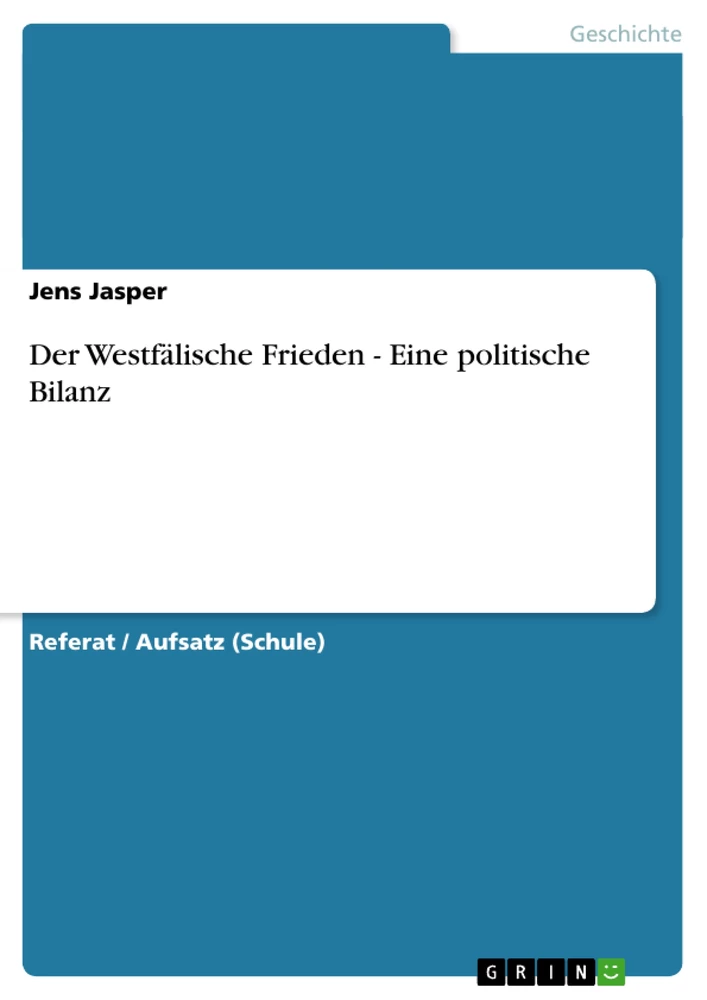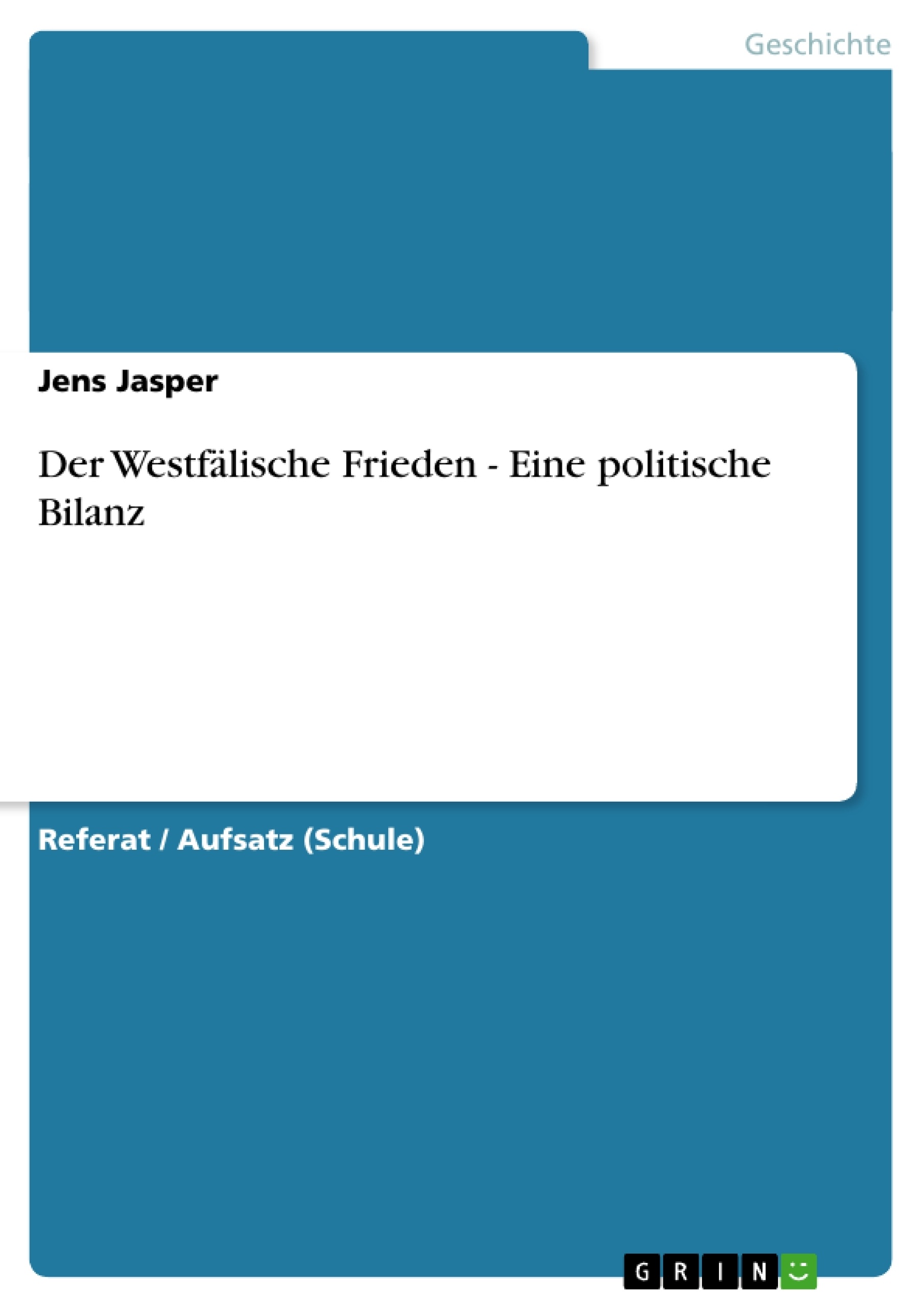Der Westfälische Frieden - Eine politische Bilanz
Der Westfälische Frieden beendete den Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 andauerte. Im Laufe der Jahrzehnte war der Krieg sehr unübersichtlich geworden, da immer mehr Staaten in den Krieg hineingezogen wurden. So dauerten die Friedensverhandlungen denn auch von 1644 bis 1648, die Unterzeichnung der Friedensverträge zog sich von Januar bis Oktober 1648 hin. Erst dann herrschte zwischen allen Staaten offiziell Frieden. Dieser Frieden veränderte Europa in drei wesentlichen Punkten:
Erstens bekam der Begriff Souveränität eine neue Bedeutung, denn die Macht des Kaisers wurde eingeschränkt. Er durfte die Außenpolitik des Reiches nicht mehr führen und hatte keinen Einfluß mehr auf die Territorialfürsten. Dadurch konnten die Reichsterritorien zu Einzelstaaten werden. Diese neuen Staaten wurden territorial fixiert, so dass es klare Landesgrenzen gab. Die Souveränität der Staaten wurde zum Schlüsselbegriff der ganzen folgenden Epoche.
Zweitens wurde beschlossen, sich nicht mehr in innere Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen und damit einhergehend gab es einen Schutzanspruch für Andersgläubige, da bei religiösen Fragen Mehrheitsbeschlüsse nicht mehr gültig waren. Damit sollten in Zukunft Religionskriege vermieden werden. Drittens kam der Gedanke des Gleichgewichts der Kräfte zwischen den Staaten auf. Dadurch sollte verhindert werden, dass in Zukunft ein Staat zu mächtig wird und gefahrlos einen Krieg anfangen kann. Deshalb wurden Verträge zur Verteilung der Territorien so geregelt, dass kein Staat eine Übermacht bekam. So ging z. B. Lothringen und ein großer Teil des Elsaß an Frankreich über.
Nach 350 Jahren ist es an der Zeit zu überprüfen, ob diese Punkte noch sinnvoll sind bzw. wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben.
Die Landesgrenzen sind heute längst nicht mehr so stark wie früher, zum einen wird der Staat heute in einzelne Regionen aufgeteilt, die teils eigene Entscheidungen treffen, zum anderen gibt es innerhalb der Europäischen Union, in der zahlreiche europäische Staaten Mitglied sind, offene Grenzen. Die Souveränitätsrechte der Staaten werden zudem von Nichtregierungsorganisationen beeinflusst. Dem territorial fixierten Staat stehen heute außerdem nichtterritoriale Probleme und Lösungen gegenüber.
Dem Nichteinmischungsgebot des Westfälischen Friedens stehen heute die Probleme vieler Staaten gegenüber, von den Problemen der Ostblockstaaten erfuhr ein Großteil der westlichen Welt erst nach Ende des Kalten Kriegs, der diese Probleme lange Zeit verdeckt hatte. Damals entwickelte sich eine Diskussion mit der Frage, ob es nicht gar eine Pflicht zum Eingreifen gab, und ob man sich nicht schuldig mache wenn man nicht eingreift. Und tatsächlich gab es in den neunziger Jahren so viele militärische Aktionen für humanitäre Zwecke wie nie zuvor, vor allen Dingen im früheren Jugoslawien. Als man aber erkannte das man mit solchen Aktionen nur kurzfristig Abhilfe schaffen konnte und das für die Lösung der Probleme ein längerfristiges ökonomisches und politisches Engagement nötig ist, ist die Begeisterung für solche Aktionen wieder deutlich zurückgegangen. Das Nichteinmischungsgebot bleibt also weiter ein Fakt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Westfälische Frieden?
Der Westfälische Frieden beendete den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). Er war ein Vertragswerk, das die Machtverhältnisse in Europa grundlegend veränderte.
Welche drei wesentlichen Punkte veränderten Europa durch den Westfälischen Frieden?
Erstens erhielt der Begriff Souveränität eine neue Bedeutung durch die Einschränkung der kaiserlichen Macht. Zweitens wurde beschlossen, sich nicht in innere Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen, verbunden mit einem Schutzanspruch für Andersgläubige. Drittens entstand der Gedanke des Gleichgewichts der Kräfte zwischen den Staaten.
Wie wurde die Souveränität der Staaten durch den Westfälischen Frieden beeinflusst?
Die Macht des Kaisers wurde eingeschränkt, was den Reichsterritorien ermöglichte, sich zu Einzelstaaten zu entwickeln. Diese Staaten wurden territorial fixiert, was klare Landesgrenzen zur Folge hatte.
Was bedeutete das Nichteinmischungsgebot des Westfälischen Friedens?
Es wurde beschlossen, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen, um Religionskriege zu vermeiden. Religiöse Fragen sollten nicht länger durch Mehrheitsbeschlüsse entschieden werden.
Was war der Gedanke des Gleichgewichts der Kräfte?
Es sollte verhindert werden, dass ein Staat zu mächtig wird und gefahrlos einen Krieg beginnen kann. Territorien wurden so verteilt, dass keine Übermacht entstand, wie beispielsweise Lothringen und Teile des Elsass an Frankreich gingen.
Wie hat sich die Bedeutung der Landesgrenzen im Laufe der Zeit verändert?
Die Landesgrenzen sind heute weniger stark, da Staaten in Regionen aufgeteilt sind, die eigene Entscheidungen treffen. Innerhalb der Europäischen Union gibt es offene Grenzen. Nichtregierungsorganisationen beeinflussen die Souveränitätsrechte der Staaten.
Wie wird das Nichteinmischungsgebot heute gesehen?
Obwohl es weiterhin ein Fakt ist, gab es Diskussionen darüber, ob es eine Pflicht zum Eingreifen bei Problemen anderer Staaten gibt. Militärische Aktionen für humanitäre Zwecke, insbesondere in den 1990er Jahren, waren nur kurzfristig wirksam. Langfristiges ökonomisches und politisches Engagement wird als notwendig erachtet.
Wie ist der Gleichgewichtsgedanke heute relevant?
Der Gleichgewichtsgedanke ist weiterhin präsent, insbesondere im 21. Jahrhundert, beeinflusst durch ökonomische Leistungskraft und innere Stabilität der Staaten. Während des Kalten Krieges wurde er zum "Gleichgewicht des Schreckens".
Wie werden Kriege heutzutage beendet im Vergleich zum Westfälischen Frieden?
Heutzutage werden kaum noch offizielle Friedensverträge geschlossen. Viele Kriege enden stillschweigend oder mit dem Sieg der überlegenen Macht, ohne formelle Besiegelung.
Was bedeutet "pax optima rerum"?
"Pax optima rerum" bedeutet "Der Frieden ist das höchste Gut".
- Quote paper
- Jens Jasper (Author), 2000, Der Westfälische Frieden - Eine politische Bilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99537