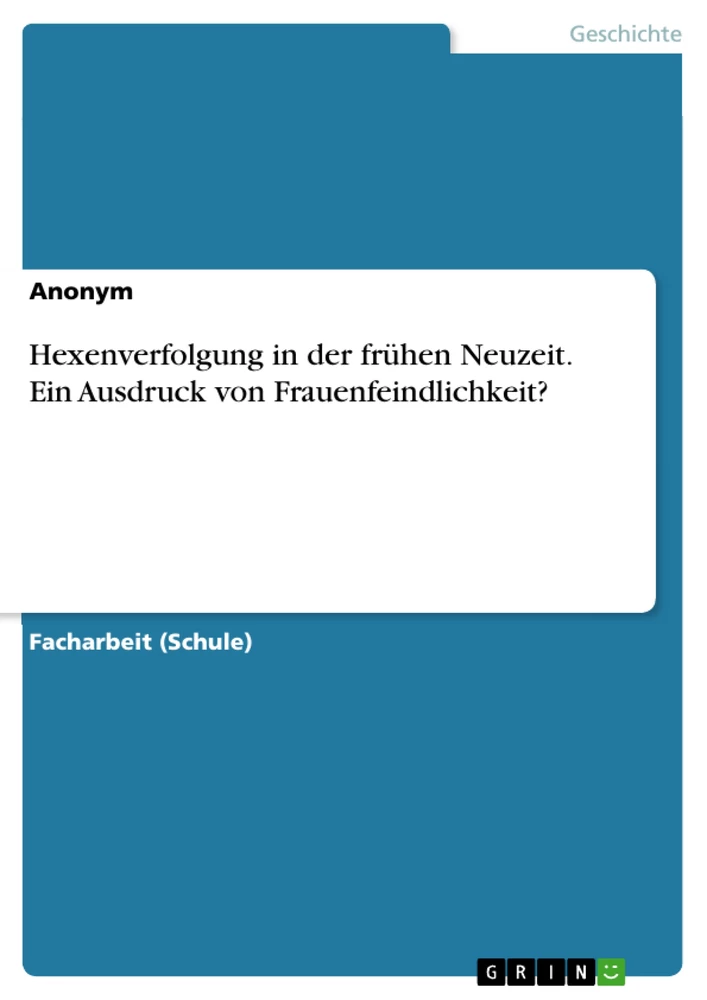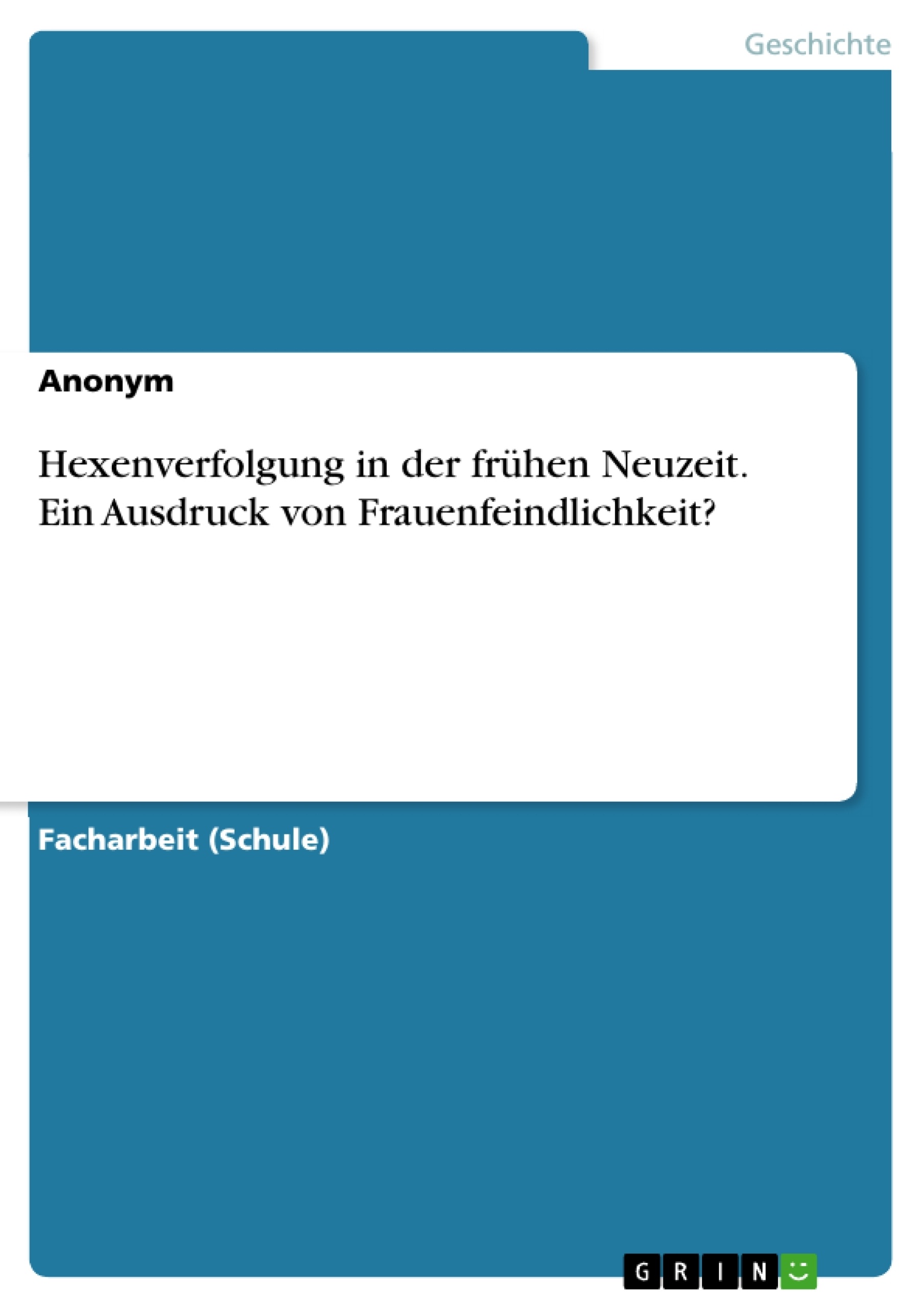In dieser Arbeit steht die Frau im Mittelpunkt der Hexenprozess. Der Fokus liegt auf Deutschland als Hochburg der Hexenverfolgung in Europa. Zeitlich wird sich auf die Epoche der frühen Neuzeit von etwa 1500 bis 1650 bezogen. Ein lokalhistorischer Fall aus der Region Braunschweig dient dazu als konkretes Beispiel. Um die Frage zu klären, inwieweit es sich bei der Hexenverfolgung um einen Ausdruck von Frauenfeindlichkeit handelt, wird sich mit dem Frauenbild der frühen Neuzeit auseinandergesetzt. Eine Statistik bezüglich des Verhältnisses der Geschlechter unterstützt dabei dieThese, dass die Frau im Zentrum der Hexenverfolgung stand. Darüber hinaus wird das Werk „Malleus Maleficarum“ nach Heinrich Kramer und Jacob Sprenger in einen Zusammenhang mit dem weiblichen Feindbild gesetzt.
Ferner wird sich dem ersten Strafgesetzbuch gewidmet, der Constitutio Criminalis Carolina. Sie schuf erstmalig eine rechtliche Grundlage für die systematische Durchführung von Hexenprozessen. Im Weiteren wird sich mit der sogenannten Hexenprobe und der peinlichen Befragung befasst. Schlussendlich wird der Begriff „Erinnerung“ aufgegriffen, wobei dieser sich an der Frage orientiert: Wie erinnert man sich heute noch an die frühneuzeitliche Hexenverfolgung in Deutschland?
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. HEXENVERFOLGUNG IN DEUTSCHLAND
- 2.1 DER FALL DER LUCIE HEILIGENTAG
- 3. MALLEUS MALEFICARUM
- 4. DAS FRAUENBILD IN DER FRÜHEN NEUZEIT
- 4.1 DAS GESCHLECHTERVERHÄLTNIS
- 5. DIE SCHAFFUNG DER RECHTLICHEN GRUNDLAGE IN DER CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA
- 5.1 ABLAUF EINES HEXENPROZESSES
- 5.2 PEINLICHE BEFRAGUNG
- 5.3 HEXENPROBE
- 6. ERINNERUNGSKULTUR IN DEUTSCHLAND
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Hexenverfolgung in der frühneuzeitlichen deutschen Gesellschaft und deren mögliche Verbindung zu Frauenfeindlichkeit. Die Arbeit analysiert den Kontext der Verfolgung, das damalige Frauenbild und die rechtlichen Grundlagen der Prozesse. Ein konkreter Fall wird beleuchtet, um die Thematik zu veranschaulichen.
- Die Rolle der Frau in den Hexenprozessen
- Das Frauenbild der frühen Neuzeit und seine gesellschaftliche Bedeutung
- Die rechtlichen Grundlagen der Hexenverfolgung in der Constitutio Criminalis Carolina
- Der Einfluss von Aberglauben und gesellschaftlichen Umständen auf die Hexenjagd
- Die heutige Erinnerungskultur an die Hexenverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Hexenverfolgung und Frauenfeindlichkeit. Sie umreißt den zeitlichen und räumlichen Fokus der Arbeit (Deutschland, 1500-1650) und benennt die zentralen Untersuchungsgegenstände: das Frauenbild der damaligen Zeit, das Werk "Malleus Maleficarum", die Constitutio Criminalis Carolina und die heutige Erinnerungskultur. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz und kündigt die Analyse eines konkreten Falles an.
2. HEXENVERFOLGUNG IN DEUTSCHLAND: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Hexenverfolgung im Heiligen Römischen Reich, beleuchtet die Schwierigkeiten bei der genauen Bestimmung der Opferzahlen und diskutiert die Motive hinter den Anschuldigungen. Es wird hervorgehoben, dass neben der Angst vor Hexerei auch persönliche Interessen und die Stigmatisierung von Frauen eine Rolle spielten. Das Kapitel verweist auf die besondere Vulnerabilität von Frauen, die aufgrund von äußerlichen Merkmalen wie roten Haaren oder körperlichen Beeinträchtigungen oft als Zielscheiben dienten. Der Zusammenhang zwischen der kleinen Eiszeit und den daraus resultierenden Hungersnöten als Auslöser für die Verschärfung der Hexenjagd wird diskutiert.
2.1 DER FALL DER LUCIE HEILIGENTAG: Dieses Kapitel präsentiert den Fall von Lucie Heiligentag aus Timmerlah als Fallbeispiel. Es beschreibt detailliert die Anschuldigungen, den Prozessablauf, die Folter und die Hinrichtung. Der Fall illustriert die Mechanismen der Hexenverfolgung, die Rolle von falschen Zeugenaussagen und den Einfluss von Folter auf die "Geständnisse". Der Fall veranschaulicht die willkürliche und ungerechte Natur der Prozesse und die weitreichenden Folgen für die Betroffenen und ihre Familien, inklusive der "Sippenhaft".
3. MALLEUS MALEFICARUM: [Dieses Kapitel würde hier eine Zusammenfassung des Malleus Maleficarum und seiner Relevanz für die Hexenverfolgung enthalten. Da der Text diesen Abschnitt nur mit dem Titel nennt, muss die Zusammenfassung aus einer anderen Quelle stammen.]
4. DAS FRAUENBILD IN DER FRÜHEN NEUZEIT: [Dieses Kapitel würde hier eine Zusammenfassung des Frauenbildes der frühen Neuzeit und seiner Verbindung zur Hexenverfolgung enthalten. Da der Text nur den Titel nennt, ist eine Zusammenfassungen aus einer anderen Quelle erforderlich.]
5. DIE SCHAFFUNG DER RECHTLICHEN GRUNDLAGE IN DER CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA: Dieses Kapitel behandelt die Constitutio Criminalis Carolina als erste rechtliche Grundlage für die systematische Verfolgung von Hexerei. Es würde den Ablauf eines Hexenprozesses nach der Carolina beschreiben, die Rolle der peinlichen Befragung und der Hexenprobe erläutern und deren Beitrag zur Verurteilung Unschuldiger analysieren. Die juristischen Aspekte der Hexenverfolgung und die Lücken im Rechtssystem, die Missbrauch ermöglichten, würden im Detail besprochen.
6. ERINNERUNGSKULTUR IN DEUTSCHLAND: [Dieses Kapitel würde eine Zusammenfassung der heutigen Erinnerungskultur an die Hexenverfolgung in Deutschland beinhalten. Da der Text nur den Titel nennt, ist eine Zusammenfassung aus einer anderen Quelle erforderlich.]
Schlüsselwörter
Hexenverfolgung, Frauenfeindlichkeit, frühneuzeitliche Gesellschaft, Malleus Maleficarum, Constitutio Criminalis Carolina, Lucie Heiligentag, Aberglaube, Recht, Erinnerungskultur, Geschlechterverhältnis, Folter, Prozess.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Hexenverfolgung in der frühneuzeitlichen deutschen Gesellschaft (ca. 1500-1650) und deren mögliche Verbindung zu Frauenfeindlichkeit. Sie analysiert den Kontext der Verfolgung, das damalige Frauenbild, die rechtlichen Grundlagen der Prozesse (insbesondere die Constitutio Criminalis Carolina) und die heutige Erinnerungskultur. Ein konkreter Fall (Lucie Heiligentag) dient der Veranschaulichung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Frau in den Hexenprozessen, das Frauenbild der frühen Neuzeit und dessen gesellschaftliche Bedeutung, die rechtlichen Grundlagen der Hexenverfolgung in der Constitutio Criminalis Carolina, den Einfluss von Aberglauben und gesellschaftlichen Umständen auf die Hexenjagd und die heutige Erinnerungskultur an die Hexenverfolgung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Forschungsfrage), Hexenverfolgung in Deutschland (Überblick, Opferzahlen, Motive), Der Fall der Lucie Heiligentag (detaillierte Fallstudie), Malleus Maleficarum (Zusammenfassung des Werkes und seiner Relevanz), Das Frauenbild in der frühen Neuzeit (Analyse des Frauenbildes und seiner Verbindung zur Hexenverfolgung), Die Schaffung der rechtlichen Grundlage in der Constitutio Criminalis Carolina (Ablauf eines Prozesses, peinliche Befragung, Hexenprobe), Erinnerungskultur in Deutschland (Zusammenfassung der heutigen Erinnerungskultur).
Wie wird der Fall von Lucie Heiligentag behandelt?
Der Fall von Lucie Heiligentag aus Timmerlah wird als detailliertes Fallbeispiel präsentiert. Es werden die Anschuldigungen, der Prozessablauf, die Folter, die Hinrichtung und die Folgen für die Betroffenen und ihre Familien beschrieben. Der Fall illustriert die Mechanismen der Hexenverfolgung, die Rolle falscher Zeugenaussagen und den Einfluss von Folter auf die "Geständnisse".
Welche Rolle spielt der "Malleus Maleficarum"?
Das Kapitel über den "Malleus Maleficarum" analysiert die Bedeutung dieses Werkes für die Hexenverfolgung. Da im vorliegenden Text keine Zusammenfassung dieses Kapitels enthalten ist, muss diese Information aus anderen Quellen bezogen werden.
Welche Rolle spielt die Constitutio Criminalis Carolina?
Die Constitutio Criminalis Carolina wird als erste rechtliche Grundlage für die systematische Verfolgung von Hexerei behandelt. Der Ablauf eines Hexenprozesses nach der Carolina, die Rolle der peinlichen Befragung und der Hexenprobe sowie deren Beitrag zur Verurteilung Unschuldiger werden erläutert.
Wie wird das Frauenbild der frühen Neuzeit dargestellt?
Das Kapitel zum Frauenbild der frühen Neuzeit untersucht die gesellschaftliche Stellung der Frau und deren Verbindung zur Hexenverfolgung. Da im vorliegenden Text keine Zusammenfassung dieses Kapitels enthalten ist, muss diese Information aus anderen Quellen bezogen werden.
Wie wird die heutige Erinnerungskultur an die Hexenverfolgung behandelt?
Das Kapitel zur Erinnerungskultur in Deutschland beschreibt die heutige Auseinandersetzung mit der Hexenverfolgung. Da im vorliegenden Text keine Zusammenfassung dieses Kapitels enthalten ist, muss diese Information aus anderen Quellen bezogen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hexenverfolgung, Frauenfeindlichkeit, frühneuzeitliche Gesellschaft, Malleus Maleficarum, Constitutio Criminalis Carolina, Lucie Heiligentag, Aberglaube, Recht, Erinnerungskultur, Geschlechterverhältnis, Folter, Prozess.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Ein Ausdruck von Frauenfeindlichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995108