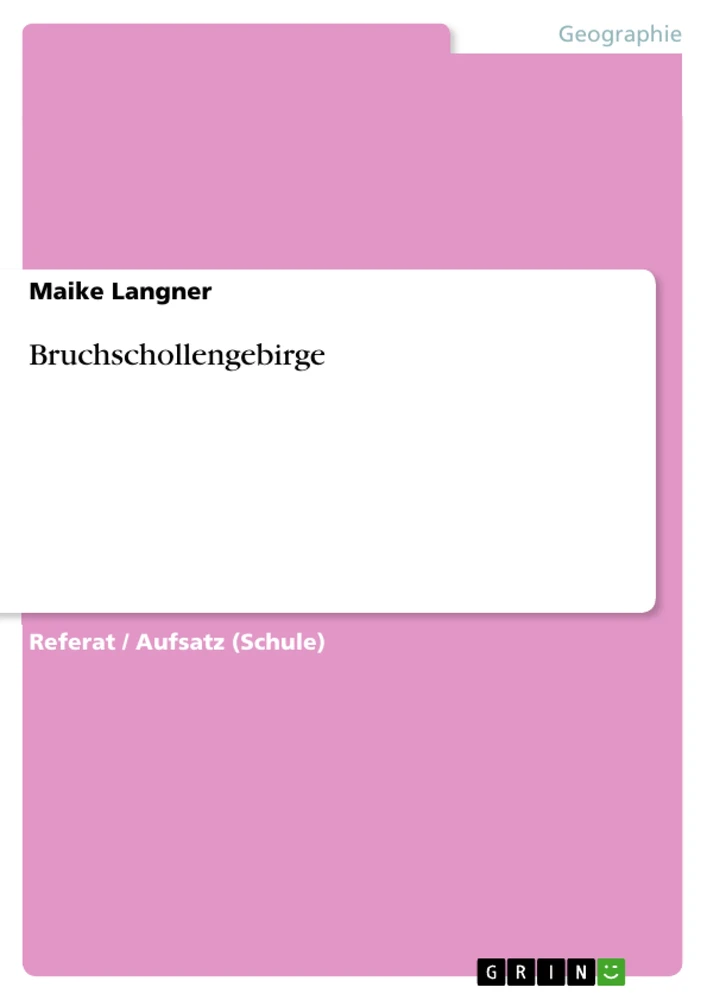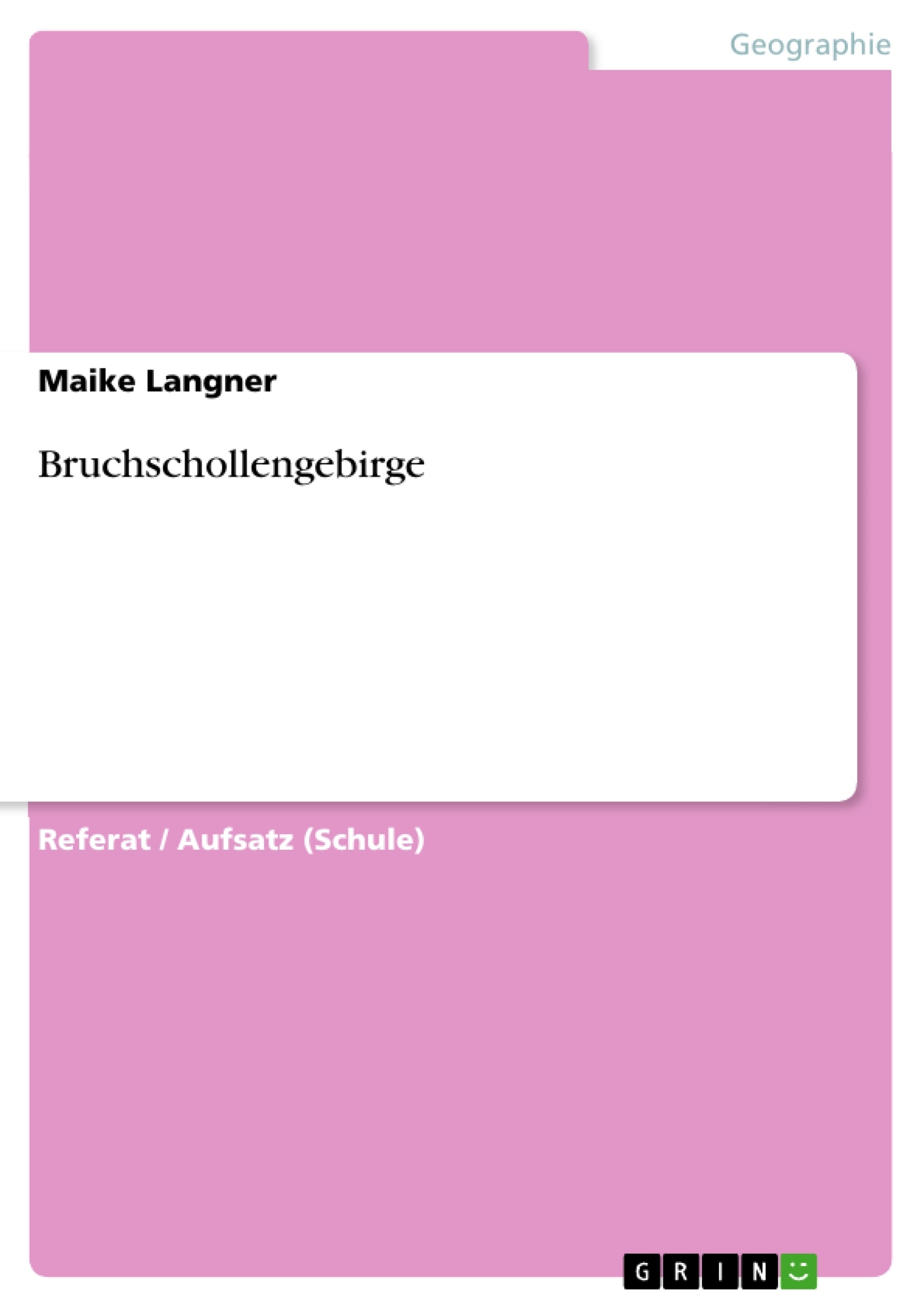Diese Arbeit widmet sich der Entstehungsgeschichte der Mittelgebirge in Europa. Ihr Hauptanliegen besteht darin, die komplexe geologische Entwicklung dieser Gebirgsformationen zu erklären und ihre Struktur sowie Entstehungsprozesse zu verdeutlichen.
Die Mittelgebirge in Europa sind älter als die Alpen und entstanden vor Millionen von Jahren durch gewaltige geologische Kräfte. Sie reichen von Ostfrankreich bis Polen und bestehen aus einem Sockel aus Gneis, der durch Schmelzen und Abkühlen der Erdkruste entstand. Frisches Gestein drang in Spalten ein und bildete Granit. Durch Verwitterung und Abtragung wurden die ursprünglichen Hochgebirge abgeflacht, und die verbliebenen gewellten Hochflächen wurden später während der Alpenbildung erneut zu Gebirgen herausgehoben. Dabei wurden sie in verschiedene Schollen zerbrochen, die durch Bruchlinien miteinander verbunden sind. Die alten Gebirgsrümpfe gerieten erneut unter tektonischen Druck und brachen in größere und kleinere Schollen. Diese Schollen wurden vertikal gehoben, gesenkt oder horizontal gegeneinander verschoben, was zu Bruchfalten und Verwerfungen führte. Je nach Bewegung der Schollen entstanden verschiedene Oberflächenformen wie Horstschollen, Keil- oder Pultschollen, Gräben und Staffelbrüche. Bruchbildung entstand durch die schwache Verbiegung des Gesteins und verstärkten tektonischen Druck, der Klüfte und Spalten erzeugte. An solchen Störungen wurden einzelne Schollen der Erdkruste nach oben geschoben oder abgesenkt. Verwerfungen können in vertikaler oder horizontaler Richtung auftreten und verschiedene Oberflächenformen wie Abschiebung oder Aufschiebung hervorrufen.
Die Entstehung der Mittelgebirge in Europa ist das Ergebnis komplexer geologischer Prozesse, die über Millionen von Jahren hinweg abliefen. Die Bruchtektonik spielte dabei eine entscheidende Rolle und formte die Landschaft durch Bruchbildungen und Verwerfungen. Dieses Verständnis der Entstehungsgeschichte ist von grundlegender Bedeutung für die Geologie und ermöglicht ein tieferes Verständnis der Erdgeschichte.
Bruchschollengebirge
ENTSTEHUNG DER MITTELGEBIRGE IN EUROPA
- älter als Alpen
- schon vor Mio. von Jahren, vor Alpen - gewaltige innere Kräfte haben Erdkruste zu Hochgebirge gefaltet oder aufgewölbt
- reichte von Ostfrankreich bis Polen
- Sockel besteht aus Gneis - ist durch mehrfaches Schmelzen und Abkühlen in Erdkruste entstanden
- in Gebirgssockel drang auf Erinnern durch Spalten frisches, glutflüssiges Gestein ein - kühlte sich langsam ab - daraus: Granit
- Verwitterung und Abtragung ebneten Hochgebirge fast völlig ein
- es blieben leicht gewellte Hochflächen
- abgetragene Schuttmassen lagerten sie um Teil im Alpenmeer ab- bei Alpenbildung erneut zu Gebirge herausgehoben
- mit Alpenbildung - Gebirgsrumpf wieder in Bewegung
- innere Kräfte hoben und senkten starren Rumpf und zerbrachen in viele Schollen - zwischen die flüssiges Gestein nach oben eindrang - so entstanden Schollengebirge, die von vielen Bruchlinien durchzogen werden
- durch Verwitterung und Abtragung - Schollengebirge heute als einheitliche, gewellte Gebirge mit mittleren Höhen
Entstehung der Bruchschollengebirge
- alte verfaltete Gebirgsrümpfe erneut unter tektonischem Druck - Gestein zerbricht - größere + kleinere Schollen - ändern Lage bei anhaltendem Druck
- werden sie vertikal gehoben o. gesenkt, oder horizontal geg.einander geschoben - Bruchfalten - VERWERFUNG
- je nach Bewegung der Schollen versch. Oberflächenformen
- Horstschollen, Keil- o. Pultschollen, Graben, Staffelbruch
BRUCHBILDUNG
- schwache Verbiegung des Gesteinskörpers
- bei verstärktem tektonischen Druck - Klüfte und Spalten, die Gesteinskörper zerreißen
- an solchen Störungen können einzelne Schollen der Erdkruste nach oben geschoben werden oder absinken
- Störungen vertikal gegeneinander - Verwerfungen
- ähnlich wie sich bei Eisdecke auf Fluß Sprünge und einzelne Schollen bilden, die sich übereinander schieben, schräg oder aufrecht stellen - Verschiebung der Schollen auf Erdkruste
- Brüche, an denen Schollen gehoben o. gesenkt werden nicht so glatt wie Eisschollen
- bestehen aus mehreren Verwerfungen, die staffelförmig angeordnet sind
Verwerfung (Bruch, Sprung, Störung)
- tektonische Störung einer ursprünglich intakten Gesteinslagerung
- Gesteinskomplex an Verwerfungs- o. Bruchfläche in zwei Schollen zerbrochen _ gegeneinander verschoben
- wenn das in senkrechter Richtung_Vertikalverschiebung
- wenn das in waagerechter Richtung_Horizontal- o. Blattverschiebung
- entstehende Differenz der vertikal gegeneinander verschobenen Gesteinsschichten _Sprunghöhe
- Schnittlinie der Verwerfungsfläche mit der Erdoberfläche _Verwerfungslinie
- zwei Arten - Abschiebung, Aufschiebung
- Abschiebung: eine Scholle ist gegenüber der anderen abgesunken und Verwerfungsfläche in Richtung der Beweg. geneigt
- Aufschiebung: Scholle relativ zur anderen aufwärts bewegt worden - Verwerfungsfläche weist inverses Einfallen von 45° auf
- bei schwach geneigter Störungsfläche, wenn Gesteinskomplex auf einen anderen aufgeschoben worden ist ( älteres Gestein über jüngerem)_Überschiebung
- durch großräumige Überschiebungen entstehen Decken
- an diesem Teil der Erde ein ganzes System von Flächen, Größenordnung und Richtung der Bewegung nicht immer dieselben
- besondere Formen entstanden durch Verwerfung - Graben, Horst, Pultscholle, Staffelbruch
Formen der Bruchtektonik
HORST
- gehobener oder infolge von Absinken der Umgebung stehengebliebenen meist von parallelen Verwerfungen begrenzten Teil der Erdkruste
- oft auch morphologisch als Erhebung ausgebildet
- durch entgegengesetzte Bewegung- Graben
Graben
- relative Einsenkung v. Erdkrustensteifen zw. stehengebliebenen oder gehobenen Schollen
- Einsenkung: längs mehr oder weniger parallelen Verwerfungen
Keil- oder Pultscholle
- schräg gestellter von Brüchen umgrenzter Erdkrustenkomplex mit stark unterschiedlicher Sprunghöhe der Verwerfungen an 2 gegenüberlieg. Flanken
Staffelbruch
- Verwerfungssystem, bei dem einzelne Gesteinsschollen treppenartig abgestuft sind
Bruchtektonik
- alle Bauformen der Erdkruste, bei denen ursprünglicher Gesteinsverband an Verwerfungsflächen zerrissen ist u. versetzt worden ist
- Abschiebung, Aufschiebung, Blattverschiebung, Graben, Horst, Überschiebung
Bruchlinie
- Schnittlinie der Verwerfungsfläche mit Erdoberfläche
Bruchstufe
- Durch tekton. Störungen in Erdkruste - Gesteinsschichten zerbrechen und die entstehende Schollen können horizontal oder vertikal gegeneinander verschoben werden (Verwerfung)
- bei vertikaler Verwerfung nennt man entstandene Geländestufe Bruchstufe
- Ausmaß der vertikalen Verschiebung wird Sprunghöhe genannt
OBERRHEINGRABEN
- Entstehung begann vor ca. 150 Mio. Jahren mit langsamer Aufwölbung der Erdkruste durch sich bild. Mantelkissen
- vor ca. 50 Mio. Jahren setzte in überdehnter Scheitelzone Absinken einzelner Krustenteile ein
- zuerst im südlichen, dann verstärkt auch im nördlichen Teil des heutigen Grabens
- Absenkung der zentralen Grabenzone - von Anstieg beider Flanken begleitet
- Grabensenkung und Flankenhebung - bis heute eine Vertikalverstellung bis zu 5000m - größter Teil aber durch Meeres- und Flußablagerungen immer wieder aufgefüllt wurde
- relativ häufige Erdbeben dort zeigten, dass Grabenentwicklung noch nicht zu Ende ist - jährliche Höhendifferenz zw. Graben/Flanken 0,5mm
ERZGEBIRGE
- zwischen Elsterergebirge im Westen und Elbsandsteingebirge im Osten
- über 130 km lang und bis 20m breit
- dominierende geologische Großlandschaft Mitteleuropas mit kristallinem und granitischem Grundgebirge
- geologisch: tektonisch herausgehobener Steifen des kristallinen Grundgebirges aus variskischer Gebirgsbildung am Nordrand der Böhmischen Masse
- Entstehung läßt sich hunderte von Jahren zurückverfolgen
- die im Paläozokium abgelagerten mächtigen, meist sandig-tonige, untergeordnet vulkanischen Gesteine wurden durch Zusammenschub der benachbarten Kontinentmassen zu Gebirge aufgetürmt
- in dieser variskischen Gebirgsbildung vor ca. 320 Mio. Jahren im Oberkarbon - ehemals flach gelagerte Schichten zu gewaltigen Milden und Sätteln aufgefaltet und Gesteinsverband gestört
- Aufheizung und Durchbewegund der Gesteine - führte zur Umwandlung der Sedimente und der vulkanisch-magmatischen Gesteine
- Neu- und Umbildung von Mineralen, die als Metamorphose bezeichnet werden
- aus sandigen Tonsteinen entstanden kristalline Schiefer und bei stärkerer Durchbewegung entstanden die Phyllite
- entlang von Schwächezonen - Eindringen glutfüssiger Granitmagmen - erstarrten in Erdkruste
- tektonische Nachbewegung wandelte Granite zu geschieferten Gneisen um
- mit Beginn der alpidischen Faltung (vor ca. 140 Mio. J.)zerbrach das bereits stark abgetragene variskische Gebirge in Schollen - hoben oder senkten sich
- Erzgebirge steigt dadurch von Norden allmählich bis auf über 1000 m ü. NN _ Pultscholle
- im Süden fällt es steil zum Egergraben hin ab
- die von Erosion abgetragenen Schuttmassen aus Sanden, Kiesen und Konglomeraten wurden in die umliegenden Denken sedimentiert
- Bewegung in mehreren Phasen über ca.30 Mio. Jahre
- an Bruchzonen Aufdringen basaltischer Gesteinsschmelzen, deren Lavaströme dem Relief folgend in Talsenken flossen - erstarrten
- Reste dieser Basaltdecken: Scheibenberg und Bärenstein (südwestl.+südl. Annaberg)
- ehemalige Vulkanschlote bilden auch Härtlinge im umgebenden Gestein
Gliederung
Entstehung eines Gebirges Definition Faltengebirge Gliederung der Falten Faltungsphasen
Alpen (Entstehung, Bau) Himalaya (Entstehung) Astenosphäre
Entstehung der Mittelgebirge
Entstehung von Bruchschollengebirgen Bruchbildung
Verwerfung
Formen der Bruchtektonik Oberrheingraben
Häufig gestellte Fragen
Was sind Bruchschollengebirge und wie entstehen sie?
Bruchschollengebirge sind Gebirge, die durch tektonische Kräfte entstehen, bei denen alte, verfaltete Gebirgsrümpfe erneut unter Druck geraten und in größere und kleinere Schollen zerbrechen. Diese Schollen können sich vertikal heben oder senken, oder horizontal gegeneinander verschoben werden. Die Bruchlinien, die dabei entstehen, werden als Verwerfungen bezeichnet.
Was sind Verwerfungen?
Verwerfungen sind tektonische Störungen einer ursprünglich intakten Gesteinslagerung. Dabei wird ein Gesteinskomplex an einer Bruchfläche in zwei Schollen zerbrochen und gegeneinander verschoben. Die Verschiebung kann senkrecht (Vertikalverschiebung) oder waagerecht (Horizontal- oder Blattverschiebung) erfolgen. Die Differenz der vertikal verschobenen Gesteinsschichten wird als Sprunghöhe bezeichnet.
Welche verschiedenen Formen der Bruchtektonik gibt es?
Es gibt verschiedene Formen der Bruchtektonik, darunter:
- Horst: Ein gehobener oder infolge von Absinken der Umgebung stehengebliebener Teil der Erdkruste, der meist von parallelen Verwerfungen begrenzt ist.
- Graben: Eine relative Einsenkung der Erdkruste zwischen stehengebliebenen oder gehobenen Schollen, die längs mehr oder weniger parallelen Verwerfungen verläuft.
- Keil- oder Pultscholle: Ein schräg gestellter, von Brüchen umgrenzter Erdkrustenkomplex mit stark unterschiedlicher Sprunghöhe der Verwerfungen an zwei gegenüberliegenden Flanken.
- Staffelbruch: Ein Verwerfungssystem, bei dem einzelne Gesteinsschollen treppenartig abgestuft sind.
Wie ist der Oberrheingraben entstanden?
Die Entstehung des Oberrheingrabens begann vor etwa 150 Millionen Jahren mit einer langsamen Aufwölbung der Erdkruste. Vor etwa 50 Millionen Jahren setzte in der überdehnten Scheitelzone das Absinken einzelner Krustenteile ein, zuerst im südlichen, dann im nördlichen Teil des heutigen Grabens. Die Absenkung der zentralen Grabenzone wurde von einem Anstieg beider Flanken begleitet. Erdbeben in der Region zeigen, dass die Grabenentwicklung noch nicht abgeschlossen ist.
Wie ist das Erzgebirge entstanden?
Das Erzgebirge ist ein tektonisch herausgehobener Steifen des kristallinen Grundgebirges aus der variskischen Gebirgsbildung am Nordrand der Böhmischen Masse. Vor ca. 320 Millionen Jahren wurden abgelagerte Gesteine durch den Zusammenschub benachbarter Kontinentmassen aufgetürmt und gefaltet. Tektonische Nachbewegungen führten zur Bildung von Graniten und Gneisen. Später zerbrach das Gebirge in Schollen, die sich hoben oder senkten, wodurch das Erzgebirge als Pultscholle entstand.
Was bedeutet Bruchbildung?
Bruchbildung ist der Prozess, bei dem sich Klüfte und Spalten im Gesteinskörper bilden, wenn der tektonische Druck zu stark wird. An diesen Störungen können einzelne Schollen der Erdkruste nach oben geschoben werden oder absinken.
Was ist eine Bruchlinie und Bruchstufe?
Die Bruchlinie ist die Schnittlinie der Verwerfungsfläche mit der Erdoberfläche. Eine Bruchstufe ist die Geländestufe, die bei einer vertikalen Verwerfung entsteht. Das Ausmaß der vertikalen Verschiebung wird Sprunghöhe genannt.
- Quote paper
- Maike Langner (Author), 2001, Bruchschollengebirge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99505