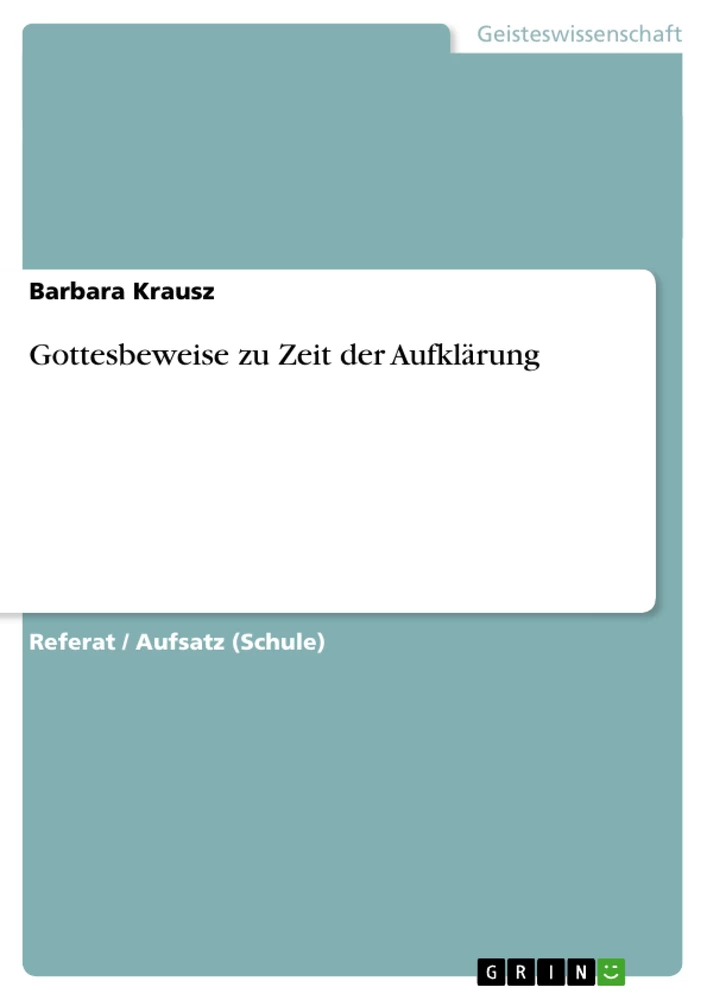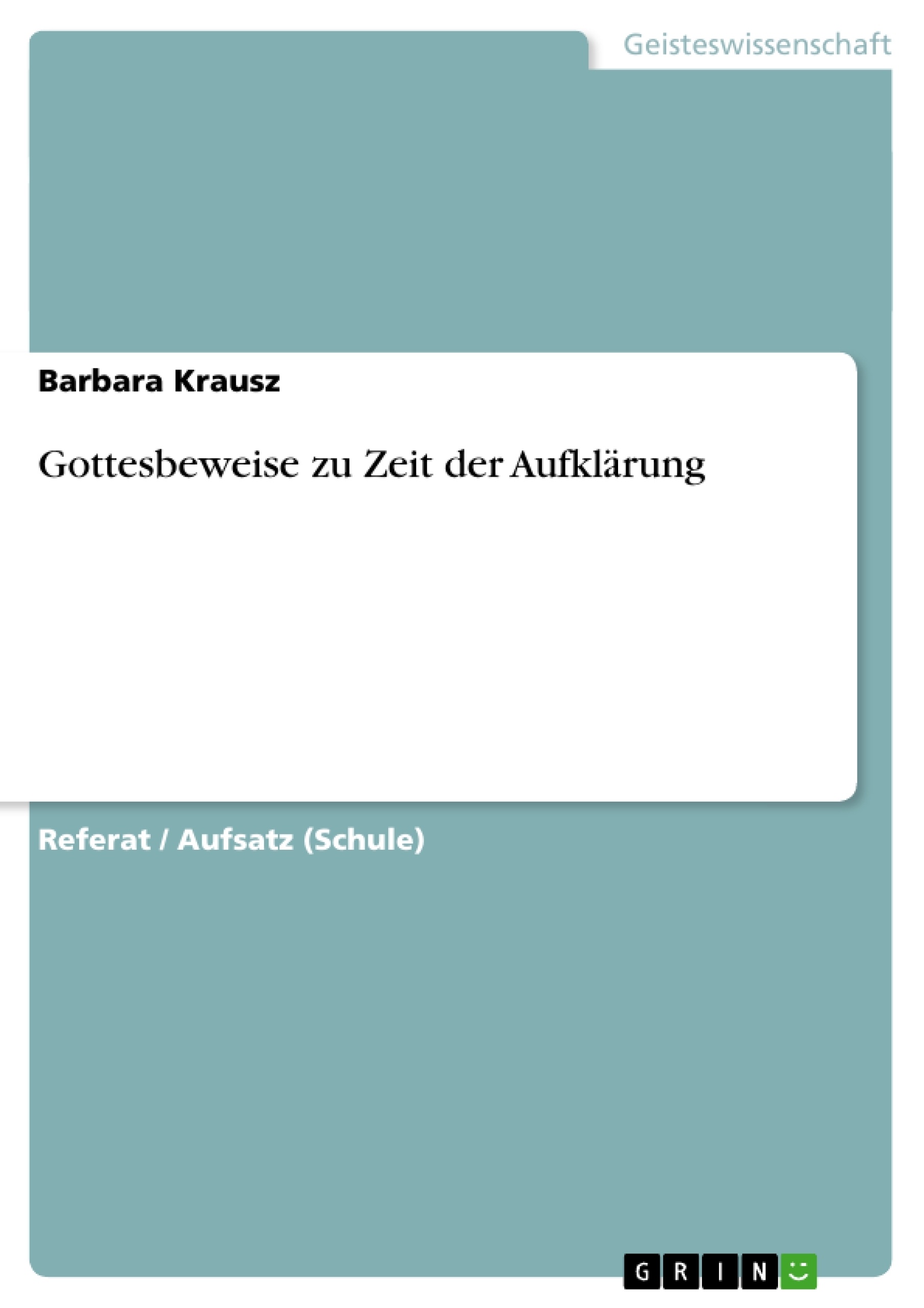Was wäre, wenn die Grundfesten unseres Denkens, die vermeintlichen Gewissheiten über Gott und die Welt, in einer Zeit des radikalen Umbruchs neu verhandelt würden? Diese Frage steht im Zentrum dieser tiefgründigen Analyse der Philosophie der Aufklärung, einer Epoche, in der Vernunft und Erfahrung zu den obersten Richtlinien des menschlichen Erkenntnisstrebens avancierten. Der Leser wird auf eine intellektuelle Reise mitgenommen, die von den revolutionären Ideen René Descartes', der mit seinem berühmten "Ich denke, also bin ich" das Fundament für ein neues Verständnis des Selbst schuf, bis hin zu den subtilen und kritischen Auseinandersetzungen Gottfried Wilhelm Leibniz' mit den Gottesbeweisen seiner Vorgänger reicht. Das Buch beleuchtet auf faszinierende Weise, wie die Aufklärung nicht nur eine Epoche des wissenschaftlichen Fortschritts, sondern auch eine Zeit der tiefgreifenden philosophischen Reflexion war, in der die Rolle Gottes, die Natur des menschlichen Geistes und die Grundlagen der Erkenntnis neu definiert wurden. Es werden die zentralen Konzepte des Rationalismus und Empirismus verständlich erklärt und die unterschiedlichen Argumentationslinien der wichtigsten Denker dieser Zeit detailliert analysiert. Dabei wird auch auf die Kritik an den traditionellen Gottesbeweisen eingegangen und gezeigt, wie die Aufklärung den Weg für eine säkulare Weltanschauung ebnete. Tauchen Sie ein in die Welt der Aufklärung und entdecken Sie, wie diese Epoche unser heutiges Denken und unsere Werte bis heute prägt. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Philosophiegeschichte, Religionskritik und die Ursprünge der modernen Welt interessieren. Lassen Sie sich von den Ideen der Aufklärung inspirieren und hinterfragen Sie Ihre eigenen Überzeugungen. Dieses Buch bietet Ihnen die Werkzeuge, um die Welt mit neuen Augen zu sehen und die komplexen Fragen des Lebens auf einer fundierten und kritischen Basis zu beantworten. Ergründen Sie die Wurzeln der modernen Philosophie und verstehen Sie die Welt, in der wir leben, ein Stück besser.
Inhaltsverzeichnis
- Die Aufklärung - Eine Revolution des Denkens
- Die Philosophie während der Aufklärung
- Gottesbeweise
- René Descartes
- ,,Abhandlung über die Methode" Vierter Teil
- Gottfried Wilhelm Leibniz
- ,,Schriften zur Metaphysik"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- René Descartes ,,Abhandlung über die Methode"
- Gottfried Wilhelm Leipzig ,,Schriften zur Metaphysik"
- Erklärung
Die Aufklärung - Eine Revolution des Denkens
Die Aufklärung war die beherrschende Geistesbewegung im Europa des 18. Jahrhunderts. Ihr Grundgedanke war der ,,Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Hilfe eines anderen zu bedienen."1 Die Vernunft ist das eigentliche Wesen des Menschen, also sind alle Menschen gleich (Egalitarismus). Die Vernunft ist fähig, die Wahrheit und damit die Welt zu erkennen (Vernunftoptimismus). Diese Auffassung übt Kritik an dem Weltbild der christlichen Kirche sowie an jeglichem Aberglauben. Durch den Gebrauch der Vernunft kann die Vervollkommnung des Menschen erreicht werden.
Ihre Anfänge reichen bis in das Zeitalter der Reformation und der Renaissance zurück. Zu dieser Zeit löste sich die enge Bindung zwischen Wissenschaften und Kirche. Bestes Beispiel für diese enge Verbindung ist der Prozeß gegen Galileo Galilei, der für sein neues Weltbild angeklagt wurde, weil es gegen die Bibel und damit gegen die Kirche sprach. Doch die Wirkung seiner Erkenntnisse ließ sich nicht mehr aufhalten. Es wurde geforscht und so entscheidende Erfindungen gemacht: Thermometer und Barometer, Pendeluhr und Gußstahl, Blitzableiter und Porzellan.
Durch Hugo Grotius (1583-1645) und Baruch Spinoza (1632-1677), der zu den bedeutendsten Vertretern des Pantheismus zählt, entwickelte sich die Bewegung zuerst in den Niederlanden und verbreitete sich um 1690 in England. Hier ist besonders der Philosoph John Locke (1632- 1704) zu nennen. Der Empirist betrachtete die Seele des Menschen als unbeschriebenes Blatt, als tabula rasa, auf das die Erfahrung im Laufe des Lebens das Wissen schreibe. Schließlich erfaßte die Aufklärung mit Voltaire Frankreich. Dieser zählte zu den Mitarbeitern der berühmten französischen Enzyklopädie Encyclop é die ou dictionnaire raisonn é des sciences, des arts et des m é tiers von Denis Diderot (1713-1784). Einen großen Beitrag zur deutschen Aufklärung leistete Christian Wolff (1679-1754), der die Entwicklung einer philosophischen deutschen Fachsprache vorantrieb.
Die Fortschrittsgedanken der Aufklärung hatten auf viele Bereiche große Auswirkungen. Man beschäftigt sich in zunehmenden Maße mit der Geschichte. Bayle begründete die Quellenkritik, umfassende Werke der Geschichtsschreibung (Hume, E. Gibbon, Voltaire) und Geschichtsphilosophie (Montesquieu) entstanden. Der Kulturverfall wurde für Gibbon und Montesquieu zu einem Hauptproblem, da man an den Fortschritt der Menschheit glaubte.
Im religiösen Bereich kämpfte man gegen die starren Traditionen und das Weltbild der Kirche und erstrebte eine ,,natürliche" Religion. So forderte Voltaire den Kampf gegen die Kirche.
Viele der Aufklärer sahen das Ziel des Lebens nicht mehr im Jenseits. Ihr Ziel war es, im Diesseits glücklich zu werden. Doch dieses Ziel könne nur durch den Vernunftgebrauch erreicht werden.
In der Rechts- und Staatslehre entwickelten sich die Menschenrechte, die später die Grundlage der amerikanischen und französischen Menschenrechtserklärung (1776 bzw. 1789) bildeten: Jeder Mensch ist frei geboren und hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück. Folter und Hexenprozesse wurden abgeschafft, die Berechtigung der Todesstrafe hinterfragt und das harte Strafmaß gemildert.
Besonders deutlich werden die Gedanken der Aufklärung in den Erziehungswissenschaften. Sie kritisierten die traditionellen Erziehungsmethoden und forderten eine von der Vernunft bestimmte Lebensweise. Außerdem erhielten Hygiene und Gesundheitswesen einen höheren Stellenwert.
In der bildenden Kunst vollzog sich ein Wandel vom Barock zum Rokoko. Typisch waren helle Farben, weltlicher Inhalt und Verweltlichung religiöser Darstellungen.
In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wurde Kritik laut, daß die Aufklärung die Vernunft überbewerte und dabei Seele, Emotionen und Religionen zu wenig Bedeutung zumesse. Diese Haltung fand sich in den neuen Geistesbewegungen (Neuhumanismus, Sturm und Drang, Romantik) wieder. Trotzdem kann nicht die Bedeutung dieses Zeitalters für Wissenschaft, Menschenrechte und gesellschaftliche Entwicklungen der Gegenwart (Emanzipation, Gleichberechtigung) geleugnet werden.
Die Philosophie während der Aufklärung
War die Aufgabe der Philosophen des Mittelalters noch, die vorhandene Wahrheit, die die Kirche vorgab, als richtig zu beweisen und von der Kirche offen gelassene Fragen ohne Widerspruch zur Bibel zu beantworten , so entwickelte sich nach der Reformation und Renaissance eine unabhängige, sich weiterentwickelnde Philosophie.
Zur Erforschung der Wahrheit gab es zwei verschiedene Mittel: die Vernunft und die Erfahrung. So entstanden im 17. Jahrhundert der Rationalismus ( von lat. ratio - die Vernunft) und der Empirismus.
Für die Rationalisten war der Verstand das einzige Mittel der Erkenntnis. Er war zwar von der Erfahrung völlig unabhängig, doch konnte diese die erkannten Wahrheiten stützen. Die Mathematik, insbesondere die Geometrie, hatte Vorbildcharakter für den Rationalismus. Wie die Mathematik durch streng logische Schlüsse Erkenntnisse herleitet, so sollte die Philosophie aus wenigen bekannten Grundsätzen andere Gesetze entwickeln, die die gesamte Welt erklären sollten. Doch für diese Schlüsse mußten zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Alles in der Welt mußte logisch zusammenhängen und der Verstand fähig sein, diese Zusammenhänge zu erkennen und die grundsätzlichen Einsichten aus sich gewonnen haben. Dagegen bestritt der Empirismus, daß die Vernunft ein schöpferisches Wesen sei und Erkenntnisse aus sich selbst errungen habe. Nach Ansicht der Empiristen hat der Mensch seine gesamte Erkenntnis aus der Erfahrung. Der Verstand sei nur dazu da, den durch die Erfahrung beschafften Stoff logisch zu ordnen. Dies müsse aber unter der Kontrolle der Erfahrung geschehen.
Gottesbeweise
Unter Gottesbeweis versteht man den Versuch, die Existenz Gottes zu beweisen. Es gibt verschiedene Richtungen. Die bekanntesten sind: der ontologische, der kosmologische und der teleologische (auch: nomologische oder physikotheologische) Gottesbeweis. Der ontologische Gottesbeweis erklärt seine Existenz aus dem Begriff ,,Gott" heraus: Gott ist seiner Definition nach das vollkommenste Wesen. Fehlte ihm die Existenz, so wäre er unvollkommen und ein vollkommeneres Wesen als Gott wäre vorstellbar. Doch dies ist nach der Definition unmöglich. Folglich muß Gott existieren.
Diese Gedanken brachte zuerst Anselm von Canterbury hervor und wurde später von Baruch Spinoza und René Descartes aufgegriffen. Leibniz kritisierte die cartesianische (nach Descartes) Auffassung und versuchte, sie zu verbessern. Auf die verschiedenen Auffassungen dieser beiden Philosophen werde ich in der Analyse zweier Texte näher eingehen.
Der kosmologische Gottesbeweis geht davon aus, daß jede Wirkung eine Ursache hat. Da es jedoch irgendwo einen Anfang geben muß, gab es eine ,,erste wirkende Ursache", die nicht Folge einer Ursache war und die folgende Verkettung von Ursachen und Wirkungen auslöste. Diese ,,erste wirkende Ursache" ist Gott.
Dieses Argument wurde u.a. von Aristoteles, Thomas von Aquin und Albertus Magnus hervorgebracht.
Der dritte Beweis, der teleologische Beweis, schließt aus den Gesetzmäßigkeiten der Natur auf einen Schöpfer, der diese Ordnung genau geplant und durchdacht hat. Schon Platon, Aristoteles, Sokrates und Thomas von Aquin hatten diese Gründe formuliert, die später in der europäischen Aufklärung durch Christian Wolff (1679-1754) noch näher ausgearbeitet wurden.
,,Unter Gott verstehe ich das absolut unendliche Wesen, die Substanz, die aus unzähligen Attributen besteht, von denen jedes ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt"2
,,Also ist die oberste Ursache der Natur, so fern sie zum höchsten Gute vorausgesetzt werden muß, ein Wesen, das durch Verstand und Willen die Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist, d.i. Gott."3
Diese offensichtliche Bedeutung Gottes für den Menschen als Schöpfer und vollkommenstes, höchstes Wesen veranlaßte mich dazu, den Wandel der Gottesbeweise zur Zeit der Aufklärung zu untersuchen. Hatten die Menschen im Mittelalter es noch nicht gewagt, die Traditionen und Gesetze der Kirche anzuzweifeln, so wurde während der Aufklärung mehr über diese nachgedacht: Kritik wurde laut. Man nahm die Auffassung der Kirche wie zuvor nicht einfach an, sondern dachte selbständig darüber nach, ob es Gott geben kann.
René Descartes
René Descartes wurde am 31. März 1596 in Touraine/Frankreich geboren. Nach der Schulzeit auf einer Jesuitenschule studierte er an der Universität Poitiers bis 1616 Rechtswissenschaften, übte jedoch nie einen Beruf dieses Gebietes aus. Ab 1618 diente Descartes in verschiedenen Armeen und nahm u.a. am Dreißigjährigen Krieg teil. In den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts studierte er in Frankreich Philosophie, zog aber bald darauf in die Niederlanden. Nachdem er von der Verurteilung Galileis hörte, gab er nur unbedenkliche Teile des Werkes Discours de la m é thode (1637) heraus. Einige seiner Schriften, die z.T. erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden, kamen auf den Index. 1649 folgte er der Einladung der schwedischen Königin Christine und erteilte ihr Philosophieunterricht. Descartes starb am 11. Februar 1650 in Stockholm an einer Lungenentzündung.
Abhandlung über die Methode Vierter Teil
René Descartes gibt in seinem bekanntesten Werk Discours de la m é thode von 1637 einige Gründe für die Existenz Gottes und seine Beziehung zur Welt, speziell zum Menschen. Er macht sich jedoch zugleich Gedanken über das Wesen Gottes und auch des Menschen. Sein Werk ist in vier Abschnitte einzuteilen: In der Einleitung bis Zeile 22 schildert Descartes sein weiteres Vorgehen. In den folgenden Zeilen (Z. 24-42) macht er sich Gedanken über den Menschen sowie darüber, wann man eine Erkenntnis als wahr annehmen kann. Der Hauptteil (Z. 44-136) besteht aus einer gründlichen Beweisführung für Gottes Existenz, wobei er in den Zeilen 99-110 einen Einschnitt macht: Hier übt Descartes Kritik. Zum Schluß (Z 138-160) geht er auf Methoden ein, die der Wahrheitsfindung dienen sollen.
Descartes beginnt mit einer vierzeiligen Einleitung, in der er zugibt, daß die folgenden Gedanken vielleicht nicht für jedermann interessant seien, er aber seine Grundlagen erklären müsse. Darauf folgen Erklärungen zweier möglicher Methoden (Z. 4-9): Zum einen sei es nötig, ,,manchmal Meinungen, von denen man weiß, daß sie sehr unsicher sind, so zu folgen, als wären sie nicht zweifelhaft" (Z.5/6), zum anderen sei es nötig, ,,daß ich das völlige Gegenteil täte und alles das als völlig falsch zurückwiese, wovon ich mir nur den geringsten Zweifel einbilden könnte, um zu sehen, ob nicht danach irgend etwas in meiner Überzeugung zurückbliebe, was völlig unbezweifelbar wäre." (Z. 7-9) Letztere Methode kommt bei seinen Überlegungen zum Einsatz. In den Zeilen 9-17 werden mögliche Fehlerquellen aufgezeigt: Sinnestäuschungen könnten zu Vorstellungen führen, die nicht der Wahrheit entsprechen, Fehlschlüsse, die durch die Unvollkommenheit des Menschen entstehen, und Trugbilder ebenfalls eine falsche Wahrheit bewirken. In den letzten sechs Zeilen dieses Abschnittes kommt Descartes zu seinem ersten, sehr bekannten Grundsatz: ,,Ich denke, also bin ich" (Zeile 19). Durch seine vorhergehenden Überlegungen sieht er ein, daß er, der Denkende, existieren müsse.
Im zweiten Paragraphen stellt Descartes Überlegungen über den Menschen an. Er sagt, daß er sich einbilden könne, daß er ,,keinen Körper hätte und daß es keine Welt gäbe, noch einen Ort, wo ich wäre, aber daß ich deswegen nicht vorgeben könnte, daß ich selbst nicht wäre" (Z. 25/26). Dies bedeutet, daß die Seele allein das Wesen des Menschen ausmacht, da er zusätzlich noch überlegt, daß er sich nicht vorstellen könne zu existieren, wenn er nicht denken würde. Für ihn ist die Seele des Menschen (orts-) unabhängig und völlig verschieden vom Körper (Z. 29-32). Er geht sogar noch einen Schritt weiter: In Zeile 33 schreibt er, daß die Seele auch ohne den Körper existieren könne.
Descartes fährt mit der Überlegung fort, wann man etwas als wahr annehmen könne. Aus seinem ersten Grundsatz, in dem er ,,sehr deutlich [sieht], daß man, um zu denken, sein muß" (Z. 39) folgert er, daß offensichtliche Dinge wahr sind, daß aber die Problematik darin bestehe, deutliche von undeutlichen Dingen zu unterscheiden. (Z. 41/42) Nun folgen Gedankengänge, die die Existenz Gottes beweisen sollen. Er geht dabei vom Menschen aus und überlegt, daß er nicht vollkommen sein kann, wenn er gemäß seiner Methode (Z. 7-9) an allem zweifelte. Denn er sieht ,,klar, daß es eine größere Vollkommenheit ist zu wissen als zu zweifeln" (Zeile 45). Daraufhin geht er der Frage nach, woher er die Idee des Vollkommenen habe und sieht ein, daß er diese nur von einem vollkommenen Wesen haben könne. (Z. 47) Im Folgenden erkennt er auch, daß andere Ideen von Dingen weder aus ihm, einem unvollkommenen Wesen, noch aus dem Nichts entstammen können. Er gelangt in den Zeilen 56-69 zu der Erkenntnis, daß er diese Ideen nur von Gott erhalten haben könne. Hätte er die Ideen von Dingen wie Himmel, Licht oder Erde von sich selbst, gäbe es keinen Grund dafür, daß er Ideen anderer Dinge, die ihn zu einem vollkommenen Wesen machen würden, er aber nicht besitzt, nicht haben könne. (Z. 62-67) Im Anschluß daran macht er sich eine Vorstellung vom Wesen Gottes. Er überlegt, daß etwas Unvollkommenes wie Traurigkeit, Unbeständigkeit oder Zweifel nicht Elemente des Vollkommenen, also Gott, sein können (Z. 67-72). In den Zeilen 75-88 sieht er ein, daß Gott körperlos sein muß, da eine Verbindung von Seele und Körper eine Unvollkommenheit darstellt, aber daß eine unvollkommene Natur, die diesen Mangel innehat, ,,von seiner Macht abhängen müßte, daß sie ohne ihn nicht einen einzigen Moment bestehen [könnte]." (Zeile 80) Im fünften Abschnitt schreibt er zunächst über geometrische Beweise, deren Sicherheit darin besteht, ,,daß man sie offensichtlich wahrnimmt" (Z. 87). Jedoch findet er keinen Beweis dafür, daß diese geometrischen Figuren überhaupt bestehen. Ohne ihre Existenz wären sie aber nicht vollkommen. Anschließend stellt er einen Bezug zu Gott her: Er behauptet, daß Gott existieren müsse, weil er ja andernfalls nicht vollkommen sei und dies der Definition des Begriffes widerspräche (Ontologischer Gottesbeweis).
Descartes übt in den folgenden Zeilen Kritik: Er distanziert sich sowohl von den Menschen, die Probleme haben, Gott und ihre eigene Seele zu erkennen, da ,,sie ihren Geist niemals über die fühlbaren Dinge erheben und [...] alles das, was nicht vorstellbar ist, ihnen nicht denkbar erscheint" (Z. 100-103), als auch von den Anhängern des Empirismus. Diese Ablehnung begründet er damit, ,,daß es nichts im Verstand gebe, was nicht zuerst in den Seelen gewesen sei, wo jedenfalls [...] die Ideen von Gott und von der Seele nie gewesen sind." (Z. 104-105)
Weiterhin schreibt Descartes, daß der Verstand und nicht etwa die Einbildung oder die Sinne Wahrheiten entdecken müsse. (Zeilen 109/110)
Danach spricht er im siebten Abschnitt diejenigen an, die immer noch nicht von der Existenz Gottes und der Seele überzeugt sind, indem er ihnen sagt, daß für sie offensichtliche Dinge nicht so wahr sind wie die, die sie bezweifeln. Er argumentiert damit, daß man nie sagen kann, ,,daß die Gedanken, die im Traum kommen eher falsch sind als die anderen" (Z. 120/121). Anschließend beschreibt er den teleologischen Beweis (Z. 122-128): Er stellt Gott als den Planer dar, der die Sicherheit für seine Regel gibt, ,,daß die Dinge, die wir klar und deutlich unterschieden wahrnehmen, alle wahr sind" (Z. 125). Da Gott, der uns Ideen eingibt, vollkommen ist, kann ,,Verworrenes oder Dunkles" (Z. 129/130) nicht von ihm, sondern von unvollkommenen Wesen (Mensch) kommen. Zum Abschluß gibt er noch das Argument wieder, daß wir nichts als wahr annehmen könnten, wenn es nicht von einem vollkommenen Wesen wie Gott käme. (Z. 133-136)
Descartes spricht im letzten Abschnitt erneut die Fehlerquellen der Sinnestäuschungen und Einbildungen an. Er meint, daß eine Idee, die dem Menschen im Schlaf kommt, nicht wahrer oder falscher sei als die Ideen, die ihm am Tage in den Sinn kommen. Jedoch bestehe die Schwierigkeit darin, ,,daß wir uns verschiedene Gegenstände in derselben Weise vorstellen, wie es unsere äußeren Sinne tun" (Z. 143/144). Und dies ist, wie er schon in Zeile 9 bis 11 schreibt, unbedingt zu vermeiden indem man sich niemals überzeugen lassen darf ,,außer durch die Offensichtlichkeit unserer Vernunft" (Z. 148). Denn die Vernunft muß ,,irgendeine Grundlage in der Wahrheit haben [...]; denn es wäre nicht möglich, daß Gott, der ganz vollkommen und ganz wahrhaftig ist, sie ohne diese in uns gesetzt hätte." (Z. 154/155) Zum Abschluß sagt Descartes, daß wahre Gedanken uns eher während des Wachseins einfallen als im Schlaf, da die Gedanken in der Nacht nicht deutlich und lückenlos seien. (Z. 155-160)
Die Abhandlung über die Methode ist ein rein wissenschaftlicher Text, der dem kritischen Leser die Ergebnisse seiner Überlegungen nahebringen will. Descartes beginnt bei einem einzigen Grundsatz (,,Je pense, donc je suis") und geleitet den Lesenden durch seine Gedankengänge, indem er jede einzelne Schlußfolgerung exakt beschreibt.
Er selbst sagt, daß er ,,den Ruhm nicht übermäßig liebe, oder selbst, wenn ich so sagen darf, insofern hasse, als ich ihn für der Ruhe zuwider halte". 4 Er möchte also den Menschen seine Ideen aufzeigen. Seine Person steht dabei ganz im Hintergrund.
Gottfried Wilhelm Leibniz
Leibniz wurde am 1. Juli 1646 in Leipzig geboren. Nach seinem Studium bekam er 1666 den Doktortitel in Recht und stand im Dienst des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz.1673 beschäftigte er sich in Paris intensiv mit Mathematik, Naturwissenschaften und Philosophie. Hier entwickelte er 1675 u.a. die Grundlagen der Differentialrechnung. Ein Jahr später arbeitete er bis zu seinem Tod als Bibliothekar und Geheimrat am Hof von Hannover. Er verstarb dort am 14. November 1716.
Schriften zur Metaphysik
Leibniz bezieht sich in diesem Werk von 1692 auf die Gottesbeweise von René Descartes und versucht diese zu verbessern. Es läßt sich in drei Teile zerlegen:
In jedem Teil (1. Teil: S. 191 Z. 30 - S. 293 Z. 14; 2. Teil: S. 293 Z.15 - S. 294 Z. 5; 3. Teil: S. 294 Z. 6 - Z. 19) werden jeweils verschiedene Beweise von Descartes besprochen.
Zu Anfang gibt Leibniz kurz die Geschichte des ontologischen Beweises wieder (S. 291 Z. 30-35). Dieser sei zuerst von Anselm von Canterbury formuliert und später von Thomas von Aquin und René Descartes aufgegriffen worden. Daraufhin schreibt er, daß er zwar den Argumenten von Descartes grundsätzlich zustimmt, diese aber noch verbessern möchte. Nun definiert er nach Descartes den ontologischen Beweis. (S. 292 Z. 5-15)5 Er formuliert im Folgenden dieses Argument anders: ,,Das notwendige Wesen - als das Wesen, dessen Essenz seine Existenz besagt oder das Wesen an sich - existiert, wie das schon aus den Worten erhellt. Nun ist Gott - gemäß seiner Definition - ein solches Wesen: also existiert Gott." (Z. 19-23) Jedoch gilt bei diesem Beweis die Einschränkung, daß dieses vollkommene Wesen überhaupt möglich ist. Leibniz weist darauf hin, daß man erst dann aus einer Definition etwas folgern kann, wenn man sicher ist, ,,daß der Inhalt, den die Definition ausdrückt, möglich ist." (Z. 35/36) Desweiteren schreibt er vom ,,Vorrecht der göttlichen Natur" (S. 293 Z. 2/3): Ist die Existenz möglich, so existiert sie auch. Dieses Verfahren gilt jedoch nicht bei anderen Gegenständen. (Z. 1-6) Der Beweis, der die Existenz Gottes beinhaltet, muß streng logisch aufgebaut sein und mit großer Genauigkeit geführt werden. In den letzten Zeilen dieses Abschnittes führt er noch einen anderen Beweis an, den er jedoch nicht näher ausführt; er weist auf sein Buch ,,Monadologie" §§ 37-39 hin.
Im nächsten Teil spricht er den Beweis an, der besagt, daß ein vollkommenes Wesen uns die Idee der Vollkommenheit eingegeben hat und dieses Wesen, also Gott, folglich existiert. Es wird von vielen Gegnern dieses Beweises gesprochen. Er widerspricht Descartes auch darin, ,,daß wir die Idee einer Sache haben, wenn wir von ihr mit Verständnis der Worte, die wir brauchen, sprechen können" (Z. 23-25). Sein Argument ist, daß man sich zwar die schnellste Bewegung vorstellen kann, diese aber nicht existieren kann und so auch keiner Idee gleichkommt. Dieses Argument führt er weiter aus, indem er berichtet, daß wir uns einer Wahrheit erst dann bewußt sind, ,,wenn wir den Gegenstand erkennen und, soweit es nötig ist, in seine Bestandteile auflösen." (S.294 Z. 3-5) Das letzte Argument von Descartes, das Leibniz hier behandelt, besagt, ,,daß Gott sei, da ja wir, die wir seine Idee haben, existieren." (S.294 Z. 9/10) Sein Gegenargument folgt in den Zeilen 11-19: Hier schreibt er, daß dieses Argument nicht ausreicht zu beweisen, daß Gott existiert.
Der behandelte Text von Gottfried Wilhelm Leibniz ist ein kritischer Text zu den Ideen von René Descartes. Obwohl Leibniz den kartesischen Prinzipien grundsätzlich zustimmt, übt er Kritik an ihnen und versucht, sie zu verbessern. Er beschreibt zunächst jeweils die Ansichten von Descartes und bringt darauf ein Gegenargument hervor. Daraufhin formuliert er - wie beispielsweise aus S. 292 Z. 19-23 - die Beweise neu.
Seine Absicht besteht also nur darin, die Gottesbeweise weiterzuentwickeln.
Fazit
Durch die vielen Beweise, die nicht nur durch Descartes und Leibniz formuliert wurden, sondern auch von sehr vielen anderen Philosophen besonders zur Zeit der Aufklärung, erkennt man die Bedeutung Gottes für den Menschen. Gott, dessen Status der Mensch nie erreichen wird, hat Vorbildcharakter. Die Schwierigkeit eines Beweises für die Existenz besteht darin, daß er körperlos ist (s. Descartes Z. 75-88). Seine Existenz wird wohl nie bewiesen werden können, obwohl es immer Philosophen und Denker geben wird, die dies zu beweisen versuchen. Die Gedankengänge der behandelten Philosophen sind oft zu theoretisch und vernachlässigen bisweilen den Bezug zu natürlichen Gegebenheiten. Beispielsweise erscheint mir der Beweis, ,,daß Gott sei, da ja wir, die wir seine Idee haben, existieren" (Kritik von Leibniz S. 294 Z. 9/10) unschlüssig, da wir zwar seine Idee haben, ihn uns aber ganz und gar nicht vorstellen können. Auch der ontologische Beweis, der Gott aus dem Begriff selbst beweist, wirkt abwegig. Bei diesem Verfahren schreibt man der Sache, also Gott, Eigenschaften zu, die zwar in der Definition enthalten sind, aber trotzdem nicht zutreffen müssen. Dennoch sind ihre Werke große Denkleistungen, die besonders in der Aufklärung die Menschen zum Nachdenken brachten und die Wissenschaften von dem Zwang der Kirche loslösten.
Literaturverzeichnis
- ,,Neues Großes Volkslexikon" Fackelverlag G. Bowitz, Stuttgart 1981
- ,,Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie" Microsoft Corporation 1993-1998
- Dr. Ludwig Busse ,,Die Weltanschauung der großen Philosophen der Neuzeit" herausgegeben von Dr. R. Falckenberg, Verlag Teubner, Leipzig 1909
- René Descartes ,,Abhandlung über die Methode, seine Vernunft richtig zu leiten und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen", Verlag der DürrÂschen Buchhandlung, Leipzig 1905
- G.W. Leibniz ,,Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie", Felix Meiner Verlag, Hamburg 1966
[...]
1 Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland: Was ist Aufkl ä rung? Thesen und Definitionen. Stuttgart 1976, S. 9f
2 Baruch Spinoza ,,Die Ethik", 1670 herausgegeben von Hans Heinrich Tillgner Verlag, Berlin und Wien 1924, S.9
3 Immanuel Kant ,,Kritik der praktischen Vernunft" , 1788 herausgegeben von Rolf Tomann, Köln 1995, S. 434
4 René Descartes ,,Abhandlung über die Methode" Verlag der DürrÂschen Buchhandlung, Leipzig 1905, S.61 Z. 15-17
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments?
Das Dokument analysiert die Philosophie während der Aufklärung, insbesondere die Gottesbeweise von René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz.
Was war die Aufklärung?
Die Aufklärung war eine Geistesbewegung im Europa des 18. Jahrhunderts, die die Vernunft und den Verstand in den Mittelpunkt stellte und Kritik an traditionellen Weltbildern, insbesondere der Kirche, übte.
Wer waren die wichtigsten Philosophen der Aufklärung, die in diesem Dokument behandelt werden?
René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz sind die wichtigsten Philosophen, deren Gottesbeweise analysiert werden. Es werden auch andere Philosophen wie John Locke, Voltaire und Christian Wolff erwähnt.
Was sind Gottesbeweise?
Gottesbeweise sind Versuche, die Existenz Gottes zu beweisen. Das Dokument behandelt den ontologischen, den kosmologischen und den teleologischen Gottesbeweis.
Was ist der ontologische Gottesbeweis?
Der ontologische Gottesbeweis versucht, die Existenz Gottes aus dem Begriff "Gott" selbst abzuleiten, wobei Gott als das vollkommenste Wesen definiert wird.
Was ist der kosmologische Gottesbeweis?
Der kosmologische Gottesbeweis argumentiert, dass jede Wirkung eine Ursache hat und es daher eine "erste wirkende Ursache" geben muss, die nicht Folge einer Ursache war, nämlich Gott.
Was ist der teleologische Gottesbeweis?
Der teleologische Gottesbeweis schließt aus den Gesetzmäßigkeiten der Natur auf einen Schöpfer, der diese Ordnung geplant und durchdacht hat.
Was sind die Hauptpunkte von René Descartes' Gottesbeweisen in "Abhandlung über die Methode"?
Descartes argumentiert, dass die Idee des Vollkommenen in uns von einem vollkommenen Wesen (Gott) stammen muss. Er verwendet auch den ontologischen Gottesbeweis, indem er sagt, dass Gott existieren muss, weil er sonst nicht vollkommen wäre.
Wie kritisiert Leibniz Descartes' Gottesbeweise?
Leibniz stimmt Descartes' Argumenten grundsätzlich zu, versucht aber, sie zu verbessern. Er betont, dass bei der Verwendung des ontologischen Beweises zunächst die Möglichkeit des vollkommenen Wesens bewiesen werden muss. Er kritisiert auch, dass die bloße Idee von etwas nicht dessen Existenz beweist.
Was sind die wichtigsten Fehlerquellen bei der Wahrheitsfindung laut Descartes?
Descartes nennt Sinnestäuschungen, Fehlschlüsse, die durch die Unvollkommenheit des Menschen entstehen, und Trugbilder als mögliche Fehlerquellen.
Wie bewertet das Dokument die Bedeutung der Aufklärung?
Das Dokument betont die Bedeutung der Aufklärung für Wissenschaft, Menschenrechte und gesellschaftliche Entwicklungen wie Emanzipation und Gleichberechtigung, obwohl es auch die Kritik an der Überbewertung der Vernunft erwähnt.
Was ist der Rationalismus und Empirismus?
Rationalismus (von lat. ratio - die Vernunft) und der Empirismus sind die zwei verschiedenen Mittel zur Erforschung der Wahrheit. Für die Rationalisten war der Verstand das einzige Mittel der Erkenntnis. Nach Ansicht der Empiristen hat der Mensch seine gesamte Erkenntnis aus der Erfahrung.
Welche Kritikpunkte werden an den Gottesbeweisen geäußert?
Die Gedankengänge der Philosophen werden als oft zu theoretisch und als Vernachlässigung des Bezugs zu natürlichen Gegebenheiten kritisiert. Beispielsweise der ontologische Beweis, der Gott aus dem Begriff selbst beweist, wirkt abwegig.
- Quote paper
- Barbara Krausz (Author), 1999, Gottesbeweise zu Zeit der Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99469