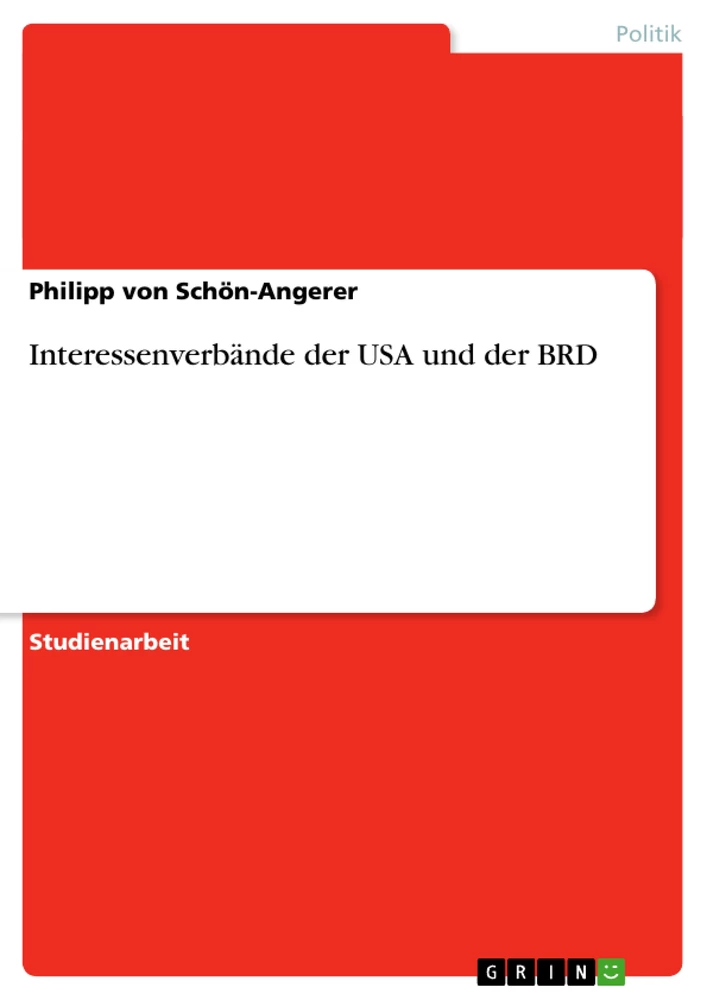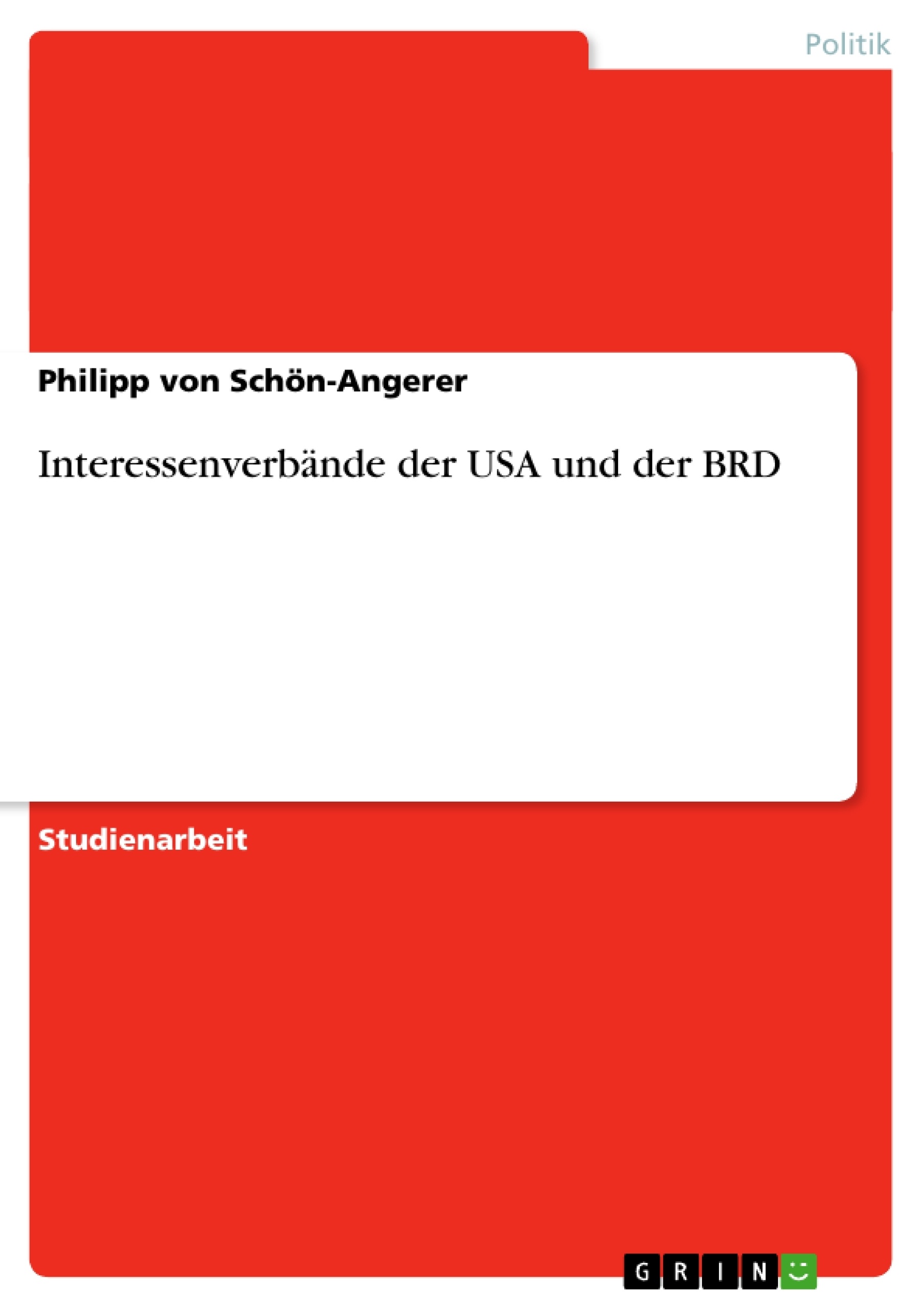1. Einleitung
In dieser Arbeit, soll eine Antwort gegeben werden auf die Frage, wie Interessenverbände im parlamentarischen System der Bundesrepublik und vergleichend dazu im präsidentiellen System der USA, Einfluß auf den Gesetzgebungsprozess nehmen und welcher Adressaten sie sich bedienen. Als erstes möchte ich die Rolle der Verbände im Grundmodell des Pluralismus und des Korporatismus vorstellen, um damit den theoretischen Hintergrund zu klären . Als nächsten Schritt dann Typologie und Adressaten des Verbandseinflusses in der Bundes- republik und in den USA darstellen, wobei ich nicht auf einzelne Verbände eingehen, sondern versuchen werde ein komplettes Bild für beide Länder zu zeichnen. Danach werde ich mich mit der vergleichenden Perspektive der beiden Länder beschäftigen. Als nächsten Schritt möchte ich einzelne Punkte in beiden Systemen kritisch betrachten, insbesondere Machtpositionen von Verbänden und Gleichberechtigung in der Vertretung von organisierten Interessen in beiden Systemen. Abschließend werde ich die Überlegungen zu den Modellen des Korporatismus und Pluralismus, die ich am Anfang der Arbeit dargestellt habe, noch einmal aufgreifen.
2. Verbände im Pluralismus
In pluralstischen Sytemen wird den Verbänden eine hohe Autonomie zugesprochen. Sie besitzen einen beträchtlichen Einfluß auf politische Prozesse. Jedoch geschieht dies von außen, ohne Zusammenarbeit mit dem Staat. Staat und Verbände stehen sich gegensätzlich gegenüber. Die Durchsetzung von Interessen bringen Sieger und Besiegte hervor, Ideen von Ausgleich oder Kompromiss sind dem Pluralismus fremd. Eine weniger radikale Sichtweise vertritt der Neopluralismus. Er versucht einen Mittelweg zwischen der Dominanz des Staates in der Repräsentationstheorie und seiner Einordnung in die Gesellschaft zu finden. Staat und Gesellschaft werden nicht einfach als unvereinbare Gegensätze definiert, zwischen beide schieben sich die gesamten intermediären Gewalten mit ihren vielfältig sozio-politisch organisierten Interessen.
Eine Pluralismustheorie, die besonders in den USA stark vertreten wird, sieht die Hauptfunktion der Interessengruppen als eine Art gesellschaftlichen ,,Input" im politischen System. Politische Forderungen innerhalb der Gesellschaft werden also über Verbände in die politischen Institutionen transferiert. Die Parteien bilden in dieser Sichtweise eine Art Scharnier zwischen dem ,,Input" der Gesellschaft und dem ,,Output" der Regierung, da sie zwar selber auch Forderungen eingeben, die Ergebnisse der Politik aber andersherum an die Gesellschaft zurückvermitteln. Verbände versuchen Parteien durch vielerlei Möglichkeiten zu beeinflussen, wie z.B. großzügige finanzielle Spenden, die Zusage von Stimmenpaketen zur nächsten Wahl, sowie durch die Schaffung personeller Verflechtungen zwischen Verbänden und Parteien. Die Gefahr, daß die Verbände zu mächtig werden, wird in der Pluralismustheorie nicht gesehen, denn die Vielfalt der Verbände, die freie Verbandswahl, die Mehrfachmitgliedschaft sowie die Konkurrenz der Verbände untereinander, führt dazu, daß sich die organisierten Interessen gegenseitig in Schach halten.1
3. Verbände im Korporatismus
Im Gegensatz zum Pluralismus sind Verbände in korporatistischen Systemen in den öffentlichen Bereich und die Politikentwicklung fest mit einbezogen. Der Staat beteiligt die Verbände verbindlich und regelmäßig an der Ausführung von Entscheidungen, inkorporiert diese gewissermaßen in die Politikentwicklung.
Der Staat versucht demnach die Verbände zu funktionalisieren, versucht die Kommunika- tionsstrukturen der Verbände zur Durchsetzung seiner eigenen Ziele zu benutzen. Die Verbände rücken im Neo-Korporatismus in eine intermediäre Stellung zwischen Staat und Gesellschaft, es bildeten sich enge Verhandlungssysteme und Politikverflechtungen zwischen den Parteien, den Ministerialverwaltungen sowie den Verbänden. Ein Verband hat nun nicht mehr nur die eigenen Interessen gegenüber der Politik, sondern auch die Interessen der Politik vor seinen eigenen Mitgliedern zu vertreten.
Es herrscht keine Konkurrenz mehr zwischen beiden, der Verband verliert sein Dasein als reine pressure group, der Staat ist sogar in hohem Maße auf sie angewiesen. Die Kompromißbereitschaft der einen Seite wird gekoppelt mit Zugeständnissen der anderen Seite. Vor allem in Schweden, aber auch in Österreich und Japan, ist dieses Zusammenspiel eine gängige Methode, mit der z.B. die Wirtschaftspolitik gesteuert wird. So halten sich die Gewerkschaften beispielsweise mit ihren Lohnforderungen zurück, bekommen im Gegenzug vom Staat soziale Maßnahmen zugesichert.2
Die Rolle der Verbände in der Bundesrepublik wird gerne mit dem Modell des ,,liberalen Korporatismus klassifiziert: ,,Das Modell des liberalen Korporatismus, mit dem häufig die politische Rolle der Bundesrepublik erklärt wird, ist durch eine Zentralisierung und Monopolisierung der Interessenverbände ,eine Einbindung der organisierten Interessen in übergreifende Verhandlungssyteme, und durch eine starke Verflechtung von organisierten Interessen und staatlichen Instanzen gekennzeichnet."3
4. Bedeutung der Verbände für die Bundesrepublik
In einem demokratischen System wie dem der Bundesrepublik, sind Verbände nicht wegzudenken.. Sie bilden das Rückgrat der komplexen und mutiblen Kommunikationsprozesse zwischen der Gesellschaft und der Regierung, wobei beide in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Es bildet sich eine Symbiose zwischen den Verbänden und dem Staat. Den Verbänden, etwa 1500, die auf der Lobbyliste des Bundestages aufgeführt sind, und somit offiziell bei Anhörungen berücksichtigt werden wollen, ist an der Förderung ihrer Interessen von Seiten des Staates gelegen, sie machen die Gesellschaft transparent, sind ein stabilisierender Ordnungsfaktor, umgekehrt sind Regierung und die Verwaltung auf das Sachwissen, das Informationspotential sowie die Adressatenkenntnis der Verbände angewiesen. Beide Seiten profitieren vom kooperativ-subsidiären Verhältnis.
Daß miteinander konkurrierende Verbände bei dem Kampf um größeren Einfluß im Staat, im Wettbewerb, um erfolgreiche Interessendurchsetzung durchaus miteinander oder dem mit dem Staat ins Gehege kommen, liegt in der Natur dieser Organisationen.4 Die Mittel der Verbände zur kontinuierlichen Einflußnahme auf die Politik sind vielfältig.
Sie arbeiten beratend an den Entwürfen von Gesetzen mit, begutachten Gesetzesentwürfe, wirken gezielt auf die Parlamentsfraktionen, die Abteilungen der verschiedenen Ministerien oder auf einzelne Beamte oder Abgeordnete ein, betreiben öffentliche Werbung für ihren Zweck. Oder mobilisieren ihr großes Potential an Mitgliedern. Kurz: je größer die öffentliche Bedeutung eines Interessenverbandes ist, um so eher können sie Einfluß auf politische Prozesse nehmen, umgekehrt entlasten Verbände den Staat indem sie in der pluralistischen Ordnung wichtige Teilbereiche selbst verwalten. So nehmen die Verbände in der Tarifautonomie und der Mitbestimmung rechtlich anerkannte Ordnungsfunktionen wahr. Durch den Art. 9 GG wird den Verbänden allerdings keine öffentlich rechtliche Teilhabe an der staatlichen Willensbildung eingeräumt, was eklatant von den Parteien unterscheidet. Verbände sind in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens präsent.
4.1 Typologie der Verbände in der Bundesrepublik
Um die Vielfalt der Aufgaben und Funktionen der Verbände zu klassifizieren bietet sich die Typologie von Ulrich von Alemann5 an, die fünf Gruppen von organisierten Interessen unterscheidet:
1. Organisierte Interessen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Hierzu zählen die Unternehmerverbände, Selbständigenverbände, Gewerkschaften und Konsumentenverbände.
2. Organisierte Interessen im sozialen Bereich Hierzu zählen Behindertenverbände, Wohlfahrtsverbände, Kriegsopferverbände.
3. Organisierte Interessen im Bereich der Freizeit und Erholung hierzu zählen Sportvereine, Sportverbände, Geselligkeitsvereine
4. Vereinigungen im Bereich von Religion, Kultur und Wirtschaft hierzu zählen religiöse Vereinigungen, Sekten, wissenschaftliche Vereinigungen, Kunstvereine.
5. Organisierte Interessen im gesellschaftlichen Querschnittsbereich Hierzu zählen ideele Vereinigungen, gesellschaftspolitische Vereinigungen ohne Eigeninteresse.
4.2 Adressaten des Verbandseinflusses in der BRD
Politische Einflußnahme in der BRD ist relativ schwierig zu klassifizieren, da sich Verbandshandeln weitgehend im informellen Bereich bewegt. Grob kann man die Adressaten des Verbandseinflusses wie folgt klassifizieren6:
4.2.1. Politische Ö ffentlichkeit
Verbände sind grundsätzlich in der politischen Öffentlichkeit präsent. Durch gezielte Information und Öffentlichkeitsarbeit, wie Kampagnen, Massenmedien, eigene Publikationsorgane, artikulieren sie sich entsprechend und versuchen die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
4.2.2. Parteien u. Parlamente
Bei der Betrachtung von Verbandsrepräsentanz in Parteien und Parlamenten wird ersichtlich, daß enge personelle Verflechtung zwischen Verbänden und Parteien existiert. Ein naheliegendes Beispiel wären u.a. die Gewerkschaften. Aber auch viel allgemeiner lassen sich bei den großen Bundestagsparteien Affinitäten zu bestimmten Verbänden ausmachen. Dies gilt insbesondere für die SPD und die CDU, mit ihren zahlenmäßig hohen verbandszugehörigen Abgeordneten.
Eines der wichtigsten Einflußmittel ist die ,,Mitgliedschaft" der Interessenverbände in Arbeitskreisen und Ausschüssen. ,, Die Interessenvertretung bei den Ausschüssen, die sog. ,,Verbandsdichte der Ausschüsse" spiegelt offenbar wider, auf welche Gesetzesmaterien die Spezialisten der Interessenverbände einzuwirken versuchen."7
Entscheidend ist hier die Mitarbeit in Parlamentsausschüssen und Fraktionsarbeitskreisen, die Mitwirkung von Verbandsexperten in öffentlichen Parlamentsanhörungen und Enquête- Kommissionen. ,,Die tatsächliche parlamentarische Willensbildung erfolgt (...) in spezialisierten Parlamentsausschüssen u. Fraktionsarbeitsgruppen, deren Vorschläge die übrigen Abgeordneten im Vertauen auf ihre jeweils beteiligten Parteifreunde zu folgen pflegen. Dementsprechend konzentriert sich der Verbandseinfluß konsequent auf diese parlamentarischen Schaltstellen8.
4.2.3. Regierung und Ministrialbürokratie
Gesetze entstehen allerdings zumeist meist nicht im Bundestag sondern in den Ministerien der Regierung. Interessenverbände versuchen deshalb schon im sog. ,,Referendenstadium", dem Entstehungsstadium von Gesetzen, direkt Einfluß zu nehmen - also in dem Stadium wo diese noch leicht veränderbar erscheinen. Interessenverbände agieren in diesem Fall aber auch als ,,Informanten und Experten" für die entsprechenden Ministerien, da sie Auswirkungen und Folgen von Gesetzen für ihre speziellen Interessen am besten abschätzen können.
Verbände haben so direkten Zugang zur sog. ,,Ministerialbürokratie".
4.2.4. Lobbying
Das Lobbying ist das wohl noch immer mit das wirkungsvollste Mittel der Verbandspolitik. Betrachtet man die größeren Verbände, so sieht man, daß fast alle Verbände Geschäftsstellen oder Verbindungsbüros in der Bundeshauptstadt, in den Landeshauptstädten und zunehmend auch in Brüssel unterhalten. Der ,,Lobbyist" hat zunächst die Funktion den Abgeordneten oder ,,nahestehende" Parlamentarier zu beeinflussen. Entweder durch gezielte Information, Unterlagen oder durch Argumente. Der Lobbyist wird umgekehrt über interessierende parlamentarische Entwicklungen informiert. ,,Empirische Untersuchungen über die Kontakte zwischen Abgeordneten und Verbandvertretern zeigen ein intensives Beziehungsgeflecht, wobei zwischen den einzelnen Verbänden erhebliche Unterschiede bei den bevorzugten Adressaten bestehen.9 Prinzipiell könnte man zwischen ,,Fraktionenlobbying" und ,,inneren Lobbying", unterscheiden.
4.2.5. Kontaktnetzwerke der Verbände
Zu guter Letzt sind Verbände aber auch gegenseitige Adressaten, um ihren Anliegen mehr politischen Nachdruck zu verleihen, werden Interessenkoalitionen mit anderen Verbänden geschlossen. Nach dem Motto ,,zwar getrennt maschieren aber vereint zuschlagen". So spielen Interessenkoalitionen und Konkurrenzverbände eine wichtige Rolle in der Verbandsarbeit bzw. in der Interessendurchsetzung.
5. Bedeutung von Verbänden in den USA
In den USA wird von Interessengruppen, ähnlich wie in Deutschland, zumeist im Zusammenhang mit Gesetzgebungsprozessen gesprochen. Der Einfluß von Interessengruppen bleibt aber keineswegs nur auf den Bereich der Legislative beschränkt. Vielmehr erstreckt er sich ebenso auf die anderen beiden Säulen Exekutive und Judikative , im amerikanischen Präsidialsystem. Leicht läßt sich allerdings feststellen, daß auch hier der Gesetzgebungs- prozeß primärer Ansatz zur Verbandseinflussnahme ist , da der Kongreß im allgemeinen am leichtesten zugänglich erscheint.
Verbände sind eine allgemeine Erscheinung moderner Massendemokratien.
Jedoch ist es ein Spezifikum der amerikanischen Demokratie sich zur Durchsetzung politischer Ziele in (Interessen-) Gruppen zu organisieren.
Allein die Entwicklung der Interessenverbände in den USA, zeigt, daß die Zahl der organisierten Gruppen in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist.
5.1 Typologie der Verbände in den USA
In Bezug auf Peter Lösche10, lassen sich sechs Verbandstypen gegeneinander abgrenzen nämlich:
1. Verbände von Kapital und Arbeit
Hierzu zählen business groups, Spitzenverbände, kleinere und mittlere Unternehmen Gewerkschaften.
2. Standes- und Berufsverbände
Hierzu zählen Interessen spezifischer Berufsgruppen, Ärzte, Lehrer usw.
3. Traditionelle Ein-Punkt-Organisationen
Hierzu zählen Gruppen die ein spezifisches politisches Anliegen oder die Interessen einer einzelnen politischen Gruppe vertreten.
4. Public Interest Groups (..)
Hierzu zählen ,,Gemeinwohlgruppen" für die Durchsetzung von öffentlichen Interessen.
5. Ideologische Gruppen
Hierzu zählen politisch ideologische Gruppen, religiöse Strömungen
6. Interessengruppen von politischen Körperschaften des öffentlichen Rechts (...)
Hierzu zählen staatliche Gebietskörperschaften, Intergovernmental Lobby
Zur allgemeinen Struktur von Verbänden in den USA läßt sich sagen, daß sie eher fragmentiert und dezentral organisiert sind. Es existieren eine Vielzahl von Interessen- gruppen auf regionaler bzw. lokaler Ebene die sich auf einzelstaatlicher oder zwischen- staatlicher Ebene zusammenschließen können. ,,Bundesweite Interessengruppen stellen daher unvollständige ,,Organisationen von Organisationen von Organisationen" bzw. Förderationen von Förderationen von Förderationen" dar.11
5.2 Adressaten des Verbandseinflusses in den USA
Die vergleichsweise Schwäche der US-amerikanischen Parteien erhöht den Einflußradius organisierter u. schlagkräftiger Interessengruppen. Die Hauptursache dafür ist strukturell bedingt durch die Unterschiede zwischen dem präsidialen und dem parlamentarischen System, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Zunächst soll erst einmal die Feststellung reichen, daß es keine sog. ,,Aktionseinheit zwischen Parlamentsmehrheit und Executive" gibt.
5.2.1 Legislative und Lobbyismus
In den USA sind gesetzgebende Gewalt und ausführende Gewalt klar getrennt, die Gesetzes- initiative geht von einzelnen Abgeordneten aus. Interessengruppen erstreben deshalb zuallererst Zugang (,,access") zu den politischen Entscheidungsträgern. Dieser Zugang wird zumeist schon vor Wahlkämpfen oder wichtigen Entscheidungen angepeilt. Hierbei kommt den PACs (Political Action Committees) eine entscheidende Bedeutung zu, welche ausschließlich zur Finanzierung von Wahlkämpfen gebildet werden. ,,PACs haben von der Kandidatenauswahl bis zur Wahlkampforganisation und -finazierung Aufgaben übernommen, die früher Parteien leisteten. Dem Lobbying der Interessengruppen ist oft die Arbeit der PACs vorgelagert.12 Durch die PACs ist es Interessengruppen möglich Kandidaten für wichtige Ämter zu unterstützen, oder ihnen ,,Steine in den Weg zu legen", ,,(...) um damit Türen aufzustoßen, durch die sie nach der erfolgreichen Wahl ,,ihres" Abgeordneten eintreten können13." Der sog. ,,access" kann aber auch durch andere Wege so z.Bsp. durch Parlamentsanhörung erreicht werden. Vergleichbar mit der Rolle der Verbände in der Bundesrepublik sind hier wiederum die Informationskapazität und das ,,Expertenwissen" der Verbandsvertreter, auf das die Abgeordneten angewiesen sind, von zentraler Bedeutung.
Die Art und Adressaten des Lobbying, sollen nun genauer untersucht werden. Wichtig ist zu allererst aber noch zu erwähnen, daß im amerikanischen System die Lobbyisten, die Parlamentarier und ihre Mitarbeiter sozusagen ,,von außen" beeinflussen, da Verbändevertreter im Vergleich zur Bundesrepublik nicht selbst in der Legislative sitzen. Dem amerikanischen Kongreß kommt im Gesetztgebungsprozess eine entscheidende Rolle zu. ,, Die Abgeordneten und Senatoren sind daher die bevorzugten Adressaten der Interessengruppen, zumal auch deren Möglichkeiten zur Einflußnahme auf den parlamentarischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess seit den Kongreßreformen der 1970er Jahre zugenommen hat."14 In den letzten Jahren haben sich die Methoden des Lobbying immer mehr verfeinert insbesondere die, indirekt auf die Mandatare Einfluß zu nehmen. Eine Variante besteht im Verfassen sog. ,,voting records" die die Mitglieder und potentielle Wähler über das Abstimmungsverhalten ,,ihres" Abgeordneten informieren. Eine zweite Möglichkeit ist das seit den siebziger Jahren betriebene ,,grassroots-lobbying", daß sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Hier wird auf die enge Wahlkreisbindung der Abgeordneten abgezielt. Durch Werbefeldzüge und Briefkampagnen usw. versuchen Interessengruppen Wähler bzw. Mitglieder zu mobilisieren, ihrerseits einen Abgeordneten zu kontaktieren. Gängige Methode die Organisation einer Brief- oder Faxflut, um eine große Stimmenmenge zu mobilisieren, die der Abgeordnete kaum ignorieren kann. Ziel beider Varianten ist die Sanktion, genauer , nämlich die Drohung bei der nächsten Wahl nicht für den bisherigen Abgeordneten zu stimmen. Ebenso ist Öffentlichkeitsarbeit und informelle Einflußnahme eine beliebte Praxis für die Einflußnahme auf die Legislative.
5.2.2 Executive
Neben dem Kongreß ist die Executive für die Interessengruppen zur wichtigsten Anlaufstelle geworden. Ähnlich wie in der Bundesrepublik ,,operieren Verbände auch durch ,,eingebaute Lobbyisten" d.h. durch Spitzenbeamte und Behördenleiter, die aus ihren eigenen Reihen stammen, und die sich in der Regel mit ihren spezifischen Anliegen identifizieren.15 Oder wie Klaus von Beyme16 bemerkt: ,, Bei der Ernennung von Untersekretären verlangen die Verbände in Amerika oft direkte Repräsentation , und bei den großen Ressorts, (...) mit vielen Unterabteilungen, wurden die leitenden Posten ,in den Unterabteilungen oft zwischen den Interessenvertretern verteilt, um ein gewisses Gleichgewicht herzustellen." Ein weiterer Ansatzpunkt ist die ,,zentrale politische Institution" des Präsidenten. Damit ein Präsident seine Zielvorstellungen realisieren kann braucht er eine breite Unterstützung. Da aber in der USA keine Fraktionsdisziplin herrscht, ist er auf Interessengruppen somit angewiesen. Da nicht alle Verbände über einen direkten Zugang zum Präsidenten verfügen haben sich auch die Verwaltungsbehörden , die die Verwaltungsvorschriften und Detailregelungen der beschlossenen Gesetze erlassen, als Zielgruppe organisierter Interessen herauskristallisiert. ,,In der Praxis sind Interessengruppen oft dermaßen eng mit ,,executive agencies" verbunden, daß die eigentlichen ,,decision-makers" kaum erkennbar sind17."
5.2.3. Judikative
Prinzipiell läßt sich erst einmal feststellen, daß Richter und Gerichte vergleichbar einem öffentlichen Druck ausgesetzt sind wie die Exekutive und die Legislative. Dies hängt eng mit der US-amerikanischen Vorstellung zusammen, daß Judikative, in diesem Falle die Rechtsfindung und die Machtausübung als zwei unterschiedliche Bereiche angesehen werden. In der Praxis führt das dahin, daß Interessenverbände die bei den anderen Instanzen kein Gehör gefunden haben, sich des Instruments des richterlichen Prüfungsrechts der Judikative bedienen um am Ende doch noch Gehör zu finden. Vor allem in Staaten, welche die Judikative per Volkswahl besetzen, spielt die generelle, verbandspolitische Einflußnahme eine große Rolle. Manche Interessengruppen sind mittlerweile sogar offiziell in institutionelle Entscheidungsprozesse eingebunden.
Ein Beispiel wäre hier die ABA, die für die Bestellung von Höchstrichtern des Bundes die Empfehlung abgibt. Am gefährlichsten scheint der Interessenteneinfluß auf die höchsten Gerichte, vor allem auf jene, denen die Verfassungsgerichtsbarkeit zusteht. An den Entscheidungen des ,,Supreme Court" in den Vereinigten Staaten wird von vielen kritisiert, daß sie Ergebnisse von Pressure und Gegenpressure sind. Andere Kritiker dagegen befürchten gerade das Gegenteil: daß das Prinzip des ,,judical review" das Resultat des Interessenausgleichs, wie er in einem Gesetz des Kongresses zustande gekommen ist, wieder zunichte zu machen droht und neue soziale Konflikte heraufbeschwört."18
6. Vergleich des Einflusses der Interessenverbände BRD/USA
Gesetzesvorlagen im amerikanischen Präsidialsystem werden mehrheitlich von den einzelnen Kongreßabgeordneten erstellt, während Vorlagen im bundesdeutschen Parlamentarismus meist im Regierungsbereich entstehen. Die prinzipielle Unterschiedlichkeit allein der
Legislative hat zur Folge, daß den Interessengruppen in beiden Systemen eine unterschiedliche Bedeutung zukommt. Aufgrund der geringen Relevanz von Parteien bzw. der ,,Überparteilichkeit" und der fehlenden eklatanten ideologischen Differenzierung, können US- Lobbyies Einfluß auf den einzelnen Abgeordneten nehmen, während diese Methode in Deutschland wegen der hohen Parteienstaatlichkeit und der Praxis der Fraktionsdiziplin weit weniger erfolgreich ist . D. h. einzelne Abgeordnete bzw. Ausschüsse sind Adressaten des Verbandeinflusses, während in parlamentarischen Systemen Parteien bzw. Regierungsmitglieder selbige sind. Grob könnte man sagen, daß sich Verbandseinfluss in den verschiedenen Systemen einmal durch ,,Druck von außen"(USA) bzw. ,,Mitsprache von innen" (BRD) kennzeichnet. In den USA wird ein eher offensiver bis konfrontativer lobbying-Stil praktiziert, während es sich in der Bundesrepublik um kooperative ,,Bargaining Systeme" handelt.
Diesen unterschiedlichen Stil faßt Lösche19 so zusammen: ,,Es gibt in den Vereinigten Staaten keine Aktionseinheit zwischen Parlamentsmehrheit und Exekutive. In parlamentarischen Systemen geht die Gesetzesinitiative fast immer von der Regierung aus, und die Gesetzesentwürfe werden in der Ministerialbürokratie bereits unter ausdrücklicher Hinzuziehung und Beteiligung der betroffenen Verbände formuliert. In den USA hingegen sind gesetzgebende und ausführende Gewalt klar getrennt, die Gesetzesinitiative geht von den einzelnen Abgeordneten aus,(...)."
Dies hat zur Folge, daß die Interessenvielfalt in den USA, die Aufsplitterung in viele Interessengruppen einen ganz andere Bedeutung entwickelt hat. Dies ist Ausdruck der allgemeinen Fragmentierung des politischen Systems. Während also das amerikanische Gesetzgebungsverfahren von dem Spannungsverhältniss Exekutive-Legislative unter Einbeziehung der Interessengruppen bestimmt ist, entfällt letztgenannte Komponente in Deutschland weitgehend. Umgekehrt spielt im Parlamentarismus die Opposition eine entscheidend wichtigere Rolle im legislativen Entscheidungsprozess. Wie schon erwähnt ist die dezentrale Organisation von Interessenverbänden in den USA ein Grund für die wenigen schlagkräftigen Verbände auf Bundesebene bzw. für die zahllosen lokalen und regionalen Interessengruppen.
Insbesondere am Beispiel der Gewerkschaften lassen sich eklatante Unterschiede sehr schnell erklären: Das pluralistische Modell stark fragmentierter Verbände wie in den USA läßt sich kaum mit dem korporativen Modell der Einheitsgewerkschaften in der Bundesrepublik vergleichen. ,,Deshalb darf der Einfluß von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften in den USA keinesfalls mit der großen Macht zentralistischer Arbeitgeber und Arbeitnehmer- vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich verwechselt werden."20
Allein schon geschichtlich haben die Gewerkschaften unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht, die starke ideologische Prägung der Gewerkschaften bzw. die Prägung als ,,sozialdemokratische Richtungsgewerkschaft."21
In der Bundesrepublik, die durch die Arbeiterbewegung maßgeblich beeinflußt wurde läßt beim amerikanischen Modell nicht in dieser Form vorfinden. Vielmehr bestehen unterschiedlichste Arbeitsbeziehungen der Gewerkschaften mit dem Staat. Ein entscheidender Punkt ist z.B. die geringe Bereitschaft der amerikanischen Gewerkschaften zur organisierten Kooperation und zur betrieblichen Mitbestimmung, im Gegenpart die hohe Bereitschaft der deutschen bzw. europäischen Gewerkschaften zur Mitbestimmung auf der betrieblichen Ebene und zur Kooperation auf höchster Ebene mit Staatsorganen und Arbeitgeberverbänden.
7. Kritische Betrachtung des Verbandseinflusses in beiden Ländern
Das Modell des ,,liberalen Korporatismus", mit dem oftmals die Rolle der Interessenverbände in der Bundesrepublik klassifiziert worden ist, wurde seit den fünfziger Jahren heftig diskutiert. Thedor von Eschenburg prägte in den fünfziger Jahren die Diskussion maßgeblich durch sein Buch ,,Herrschaft der Verbände?". (Eschenburg 1955) Von diesem Kritikpunkt aus entwickelten sich immer neue Diskussionen darum, ob sich Verbände eine Machtposition erobert haben , die mit dem parlamentarischen System nicht oder nur schwer zu vereinbaren sind, schlimmer noch, es sogar gefährden. Eben solche Ansätze lassen sich in diverser Literatur bezüglich der Rolle von Interessenverbänden im präsidentiellen System der USA ausmachen. Ein Ansatzpunkt der Kritik, bezüglich der Bundesrepublik, wäre zum einen die Frage, ob bestimmte Gruppeninteressen im etablierten Verbändesystem überhaupt Platz finden und am politischen Entscheidungsprozess mitwirken können. Dem steht wiederum gegenüber, das gerade diese Auswahlfunktion, bzw., Filterwirkung der Verbände, die Entscheidungsorgane entlaste und zur Ordnungsfähigkeit der staatlichen Organe beitrage22. Die unterschiedlichen Machtpositionen im Verbandspluralismus führen laut J. Weber zu folgenden Problemen: Da nicht alle gesellschaftlichen Interessen organisationsfähig und konfliktfähig sind, werden sie von etablierten Verbändesystem nicht aufgenommen und weitergeleitet, und daher verfüge das Verbändesystem über kein eingebautes Korrektiv gegen die Tendenz der Vernachlässigung und Diskriminierung. ,,Wenn gesellschaftliche Interessen lediglich über die auf Interessenvertretung spezialisierten Organisationen einschließlich der politischen Parteien an RV herangetragen werden, dann führt dies tendenziell zu einer Bevorzugung der kurzfristigen gegenüber den längerfristigen , der partikularen gegenüber den allgemeinen, der handfest materiellen gegenüber den nicht-ökö-nomischen und der organisierten gegenüber den nicht organisierten Interessen."23
Ähnliches läßt sich auch in Bezug auf die USA feststellen. Die Zahl der Interessengruppen in Amerika hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht, jedoch ergeben Untersuchungen, daß sich Angehörige der sozialen und ökonomischen Oberschicht am ehesten zu Interessen- gruppen zusammenschließen. ,,Nicht alle Interessengruppen sind in der Lage , wirksame Meinungskampagnen zu organisieren. Das öffentliche Ansehen einer Gruppe, ihre Organisation und last but not least ihre Geldmittel sind dabei von entscheidender Bedeutung."24 Trotz gesetzlich vorgeschriebener Transparenz zeigt sich in den USA, daß ,,die Ressourcen für politische Einflußnahme ungleich verteilt sind. Professionelles ,,Lobbying- know-how" und Zugang zu Politikern und Massenmedien stehen im Regelfall nur privilegierten Gruppen zur Verfügung. Aktive Einflußnahme setzt kognitive und finanzielle Ressourcen voraus, die in der Gesellschaft ungleich verteilt sind (upper class bias)."25 Der Rolle der PACs kommt hier entscheidende Bedeutung zu. Der Einfluß der PACs auf einzelne Abgeordnete ist unbestritten. Es läßt sich ein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe der Wahlkampfausgaben und Erfolgsaussichten bei z.B. innerparteilichen Vorwahlen feststellen.26 Ferner trägt die Rolle der PACs dazu bei, daß einzelne Kongreßmitglieder, die nur gering von ihren Parteien im Wahlkampf finanziert werden, immer mehr von den PACs abhängig zu machen, das Stimmverhalten dieser ,,gesponserten" Abgeordneten wird wohl kaum gegen die Interessen der sie unterstützenden PAC, tendieren.
Doch- daß wie Kritiker behaupten, unter dem Deckmantel des Pluralismus ein Machtmonopol von Herrschaftseliten verberge, beschreibt auch nicht die politische Wirklichkeit. Man kann zwar von einem ,,Elite-Establishment" in den USA sprechen, allerdings zeigen auch viele Entscheidungen des politischen Systems, gerade im Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz, daß Interessenverbände nicht das ,,regieren" übernommen haben. Auch die wachsende Bedeutung der ,,public-intrest-groups", belegen, daß auch allgemeine Interessen teilweise durchsetzbar sind. Auch im Bereich der Legislative läßt sich aufzeigen, daß rüde Druckversuche eher kontraproduktiv wirken, und daß im Gegenteil Verläßlichkeit und Glaubwürdigkeit beim Informationsaustausch ein höherer Stellenwert zukommt.27 Aber auch die Strategien der Verbände im deutschen System, insbesondere die frühe Einbindung der Interessengruppen in den Gesetzgebungsprozess, zeigt Probleme auf. So hat der höchst effektive ,,Expertenstatus" der Verbände auch mindestens zwei negative Konsequenzen. Ein einmal erreichter Kompromiß der in der parlamentarischen Beratung mit den Verbänden entstanden ist, nur noch schwer durch das Parlament abänderbar. Dadurch werden die Möglichkeiten der parlamentarischen Gestaltung erheblich eingeschränkt. Ein zweiter negativer Effekt bei der Einbindung von Interessengruppen in den Entscheidungsprozess, besteht im fast unausweichlichen Zwang zum Kompromiß, was sich als strukturkonservativ erweist. In bestimmten politischen Situationen in denen Neulösungen angebracht wären, verhindert die Tatsache der Kompromiß-Findung jegliche strukturelle Veränderung. Zuletzt gibt es fast keinen Bereich der Politik mehr der von Verbandseinfluß frei ist.
Eine Politik gegen die Interessen der Verbände ist so schier unmöglich. ,,Hierin liegt unter demokratietheoretischen Aspekten auch dann eine Gefahr, wenn man den Verbänden in einer pluralistischen Gesellschaft eine wichtige Rolle zuerkennt. Es geht um die Frage der Handlungsfähigkeit der demokratisch legitimierten Institutionen, vor allem des Parlaments und der Regierung.(..) Dieser Zwang zu Konsens mag die Entscheidungsfähigkeit der politischen Institutionen schwächen, (...) auf der anderen Seite trägt er dazu bei, größere, daß soziale und politische Gefüge gefährdende Konflikte zu vermeiden."28
8. Schlußbetrachtung bezüglich des Modells des Neo-Korporatismus / Pluralismus
Abschließend läßt sich sagen, daß Interessenverbände in beiden Systemen, wenn gleich sie auch unterschiedliche Methoden anwenden, einen beträchtlichen Einfluß auf nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens ausüben. Wir haben gesehen ,daß in der Bundesrepublik eher eine Korporation ,,herrscht", also gewissermaßen der ,,Konsens", eine Form der Austauschlogik, die beiden Seiten , den Verbänden wie auch dem Staat, Vorteile bringt, sei es in der Aufgabe der Verbände organisierte Interessen zu kanalisieren und den Verwaltungen Expertenwissen zur Verfügung zu stellen oder sei es von Seiten des Staates , organisierten Interessen bessere Durchsetzungsmöglichkeiten für ihre Forderungen darzubieten. Nur ist dies keine neue Form des Korporatismus, ,,die verschiedenen Spielarten korporatistischer Arangements zwischen Staat und Verbänden finden jedoch unter dem Dach des Pluralismus statt, und sind keine Alternative dazu." Dieser Neokorporatistische Ansatz, bundesrepublikanischen Musters, kann allerdings die Machtprozesse der USA nicht angemessen erfassen. Arbeit und Kapital haben bis heute keine starken Dachverbände geschaffen, wie dies für die Bundesrepublik der Fall ist, sondern bestehen eher fragmentiert, wie in dieser Arbeit vorgestellt wurde. Durch Strategien wie das ,,grassroots lobbying" haben sich die Methoden der Einflußnahme zwar verfeinert jedoch werden vorherrschend die Formen des ,,direct lobbying" praktiziert. Wichtig zu erwähnen ist jedoch, daß in den USA kein ,,pluralistisches Kräfteparallelogramm" existiert, wie manche Autoren erwähnen, das den demokratietheoretischen Postulat des Pluralismuses, wie am Anfng der Arbeit dargestellt, entspricht.
Das unter anderem daran, daß wie schon erwähnt, die sozio-ökonomische Gleicheit bei der Vertretung spezifischer Interessen, in den USA nicht gegeben ist, und ressourcenstarke Verbände größere Einflußmöglichkeiten auf das amerikanische System haben.
Literaturverzeichniss
Alemann, Ulrich von: Der Wandel organisierter Interessen in der Bundesrepublik- Erosion oder Transformation ?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49 ,1985, Seite 3-21
Beyme, Klaus von , Interessengruppen in der Demokratie, München 1980
Filzmaier, Peter/Plasser,Fritz, Die amerikanische Demokratie, Wien 1997, S. 217-233
Glaeßner, Gert-Joachim, Demokratie und Politik in Deutschland, Leske+Buderich, Opladen 1999
Lösche, Peter: Interessenorganisationen, in Adams/ Czempiel / Ostendorf / Shell/ Spahn/ Zöller: Die vereinigten Staaten von Amerika, Bnd 6, Bonn 1990, S. 419- 441
Merkel, Peter/Raabe, Dieter, Politische Soziologie der USA , Wiesbaden 1977, S. 105- 120
Pilz/Ortwein, Das politische System Deutschlands, München 1997
Rudzio, Wolfgang, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Leske+Budrich, Opladen1996
Triesch,G./Ockenfels: Interessenverbände in Deutschland, München und Landsberg am Lech 1995
Wasser, Hartmut, Die Interessengruppen,in: Jäger/Welz, Regierungssystem der USA , München 1995, S. 297-312
Weber, Jürgen, Die Interessengruppen im politischen System der BRD, Berlin 1977, S. 363- 375
Zeigler, 1965, S. 310, hier in Beyme, Klaus von, Interessengruppen in der Demokratie, a.a.O. S. 193
[...]
1 Alemann, Ulrich von: Der Wandel organisierter Interessen in der Bundesrepublik- Erosion oder Transformation?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,B 49 ,1985, Seite 11 f.
2 von Alemann, Der Wandel organisierter Interessen in der Bundesrepublik, a.a.O., S. 13 f.
3 Vgl. Glaeßner, Gert-Joachim, Demokratie und Politik in Deutschland, Leske+Buderich, Opladen 1999, S. 371 f
4 Vgl. Triesch,G./Ockenfels: Interessenverbände in Deutschland, München und Landsberg am Lech 1995, S. 181 f
5 von Alemann, Der Wandel organisierter Interessen in der Bundesrepublik, a.a.O., S.6 f
6 Glaeßner, Demokratie und Politik in Deuschland, a.a.O., S. 382
7 Pilz/Ortwein, Das politische System Deutschlands, München 1997, S.309
8 Rudzio, Wolfgang, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Leske+Budrich, Opladen1996,S.89
9 Glaeßner, Demokratie und Politik in Deutschland, a.a.O. S. 383
10 Lösche, Peter: Interessenorganisationen, in Adams/Czempiel/Ostendorf/Shell/Spahn/Zöller: Die vereinigten Staaten von Amerika, Bnd 6, Bonn 1990, S. 421
11 Filzmaier, Peter/Plasser,Fritz, Die amerikanische Demokratie, Wien 1997, S. 223
12 Filzmaier,Peter/Plasser,Fritz, Die amerikanische Demokratie, a.a.O. S. 227
13 Wasser, Hartmut, Die Interessengruppen,in: Jäger/Welz, Regierungssystem der USA , München 1995, S. 304
14 Wasser, Hartnut, Die Interessengruppen,a.a.O., S. 305
15 Wasser, Hartmut, Die Intreessengruppen, a.a.O. S. 306
16 Beyme, Klaus von , Interessengruppen in der Demokratie, München 1980, S. 185
17 Filzmaier,Peter/Plasser, Fritz, Die amerikanische Demokratie, a.a.O. S. 230
18 Zeigler, 1965, S. 310, hier in Beyme, Klaus von, Interessengruppen in der Demokratie, a.a.O. S. 193
19 Lösche, Peter, Interessenorganisationen, a.a.O. S.432
20 Filzmaier,Peter/Plasser,Fritz, Die amerikanische Demokratie, a.a.O. S. 223
21 Beyme,Klaus von, Interessengruppen in der Demokratie, a.a.O. S. 76
22 Weber, Jürgen, Die Interessengruppen im politischen System der BRD, Berlin 1977, S. 363
23 Weber, Jürgen, Die Interessengruppen im politischen System der BRD, a.a.O., S. 364
24 Merkel, Peter/Raabe, Dieter, Politische Soziologie der USA , Wiesbaden 1977, S.
25 Filzmaier, Peter/Plasser,Fritz, Die amerikanische Demokratie, a.a.O., S. 224
26 Vgl. Filzmaier, Peter/Plasser, Fritz, Die amerikanische Demokratie, a.a.O, S. 228
27 Wasser, Hartmut, Die Interessengruppen, a.a. O. S. 305
Häufig gestellte Fragen
Was ist der thematische Schwerpunkt dieser Arbeit über Interessengruppen in Deutschland und den USA?
Diese Arbeit untersucht, wie Interessensverbände im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland und im präsidentiellen System der USA Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen. Sie analysiert, an welche Adressaten sich diese Verbände wenden und vergleicht die beiden Systeme.
Welche theoretischen Modelle werden zur Analyse der Rolle von Verbänden herangezogen?
Die Arbeit stellt zunächst die Rollen der Verbände im Grundmodell des Pluralismus und des Korporatismus vor, um den theoretischen Hintergrund zu klären.
Wie werden die Verbände im Pluralismus charakterisiert?
In pluralistischen Systemen wird den Verbänden eine hohe Autonomie zugesprochen. Sie beeinflussen politische Prozesse von außen, ohne direkte Zusammenarbeit mit dem Staat. Staat und Verbände stehen sich eher gegensätzlich gegenüber. Der Neopluralismus versucht, einen Mittelweg zu finden, indem er die intermediären Gewalten mit ihren vielfältigen Interessen zwischen Staat und Gesellschaft einordnet.
Wie wird die Rolle der Verbände im Korporatismus beschrieben?
Im Korporatismus sind Verbände fest in den öffentlichen Bereich und die Politikentwicklung einbezogen. Der Staat beteiligt sie verbindlich an Entscheidungen und inkorporiert sie in die Politikentwicklung. Es entstehen enge Verhandlungssysteme und Politikverflechtungen zwischen Parteien, Ministerialverwaltungen und Verbänden. Die Rolle der Verbände in der Bundesrepublik wird oft mit dem Modell des "liberalen Korporatismus" klassifiziert.
Welche Bedeutung haben Verbände für die Bundesrepublik Deutschland?
Verbände bilden das Rückgrat der Kommunikationsprozesse zwischen Gesellschaft und Regierung. Sie machen die Gesellschaft transparent und sind ein stabilisierender Ordnungsfaktor. Regierung und Verwaltung sind auf das Sachwissen und die Informationen der Verbände angewiesen.
Welche Typen von Verbänden gibt es in der Bundesrepublik Deutschland?
Ulrich von Alemann unterscheidet fünf Gruppen von organisierten Interessen:
- Organisierte Interessen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt
- Organisierte Interessen im sozialen Bereich
- Organisierte Interessen im Bereich der Freizeit und Erholung
- Vereinigungen im Bereich von Religion, Kultur und Wissenschaft
- Organisierte Interessen im gesellschaftlichen Querschnittsbereich
An wen richten sich die Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, um Einfluss auszuüben?
Die Verbände wenden sich an die politische Öffentlichkeit, Parteien und Parlamente, Regierung und Ministerialbürokratie. Auch Lobbying und der Aufbau von Kontaktnetzwerken sind wichtige Instrumente der Verbandspolitik.
Welche Bedeutung haben Verbände in den USA?
Auch in den USA wird über den Einfluss von Interessengruppen häufig im Zusammenhang mit Gesetzgebungsprozessen gesprochen. Der Einfluss beschränkt sich aber nicht nur auf die Legislative, sondern erstreckt sich ebenso auf Exekutive und Judikative.
Welche Typen von Verbänden gibt es in den USA?
Peter Lösche grenzt sechs Verbandstypen ab:
- Verbände von Kapital und Arbeit
- Standes- und Berufsverbände
- Traditionelle Ein-Punkt-Organisationen
- Public Interest Groups
- Ideologische Gruppen
- Interessengruppen von politischen Körperschaften des öffentlichen Rechts
An wen richten sich die Verbände in den USA, um Einfluss auszuüben?
Die vergleichsweise Schwäche der Parteien erhöht den Einfluss organisierter Interessengruppen. Die Verbände versuchen, Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu erhalten, insbesondere durch PACs (Political Action Committees), die Wahlkämpfe finanzieren.
Wie werden die unterschiedlichen Einflüsse von Interessengruppen in Deutschland und den USA verglichen?
Gesetzesvorlagen in den USA werden meist von einzelnen Kongressabgeordneten erstellt, während sie in Deutschland meist im Regierungsbereich entstehen. Dies führt dazu, dass Interessengruppen in beiden Systemen eine unterschiedliche Bedeutung zukommt. In den USA wird eher ein offensiver Lobbying-Stil praktiziert, während es sich in der Bundesrepublik um kooperative Verhandlungssysteme handelt. Die Gewerkschaften in den USA sind stark fragmentiert und weniger einheitlich als in der Bundesrepublik.
Welche kritischen Aspekte werden in Bezug auf den Einfluss von Interessengruppen in beiden Ländern betrachtet?
Kritisiert wird, dass nicht alle Gruppeninteressen im etablierten Verbandssystem Platz finden. Es besteht die Gefahr, dass kurzfristige, partikulare, materielle und organisierte Interessen bevorzugt werden. In den USA sind die Ressourcen für politische Einflussnahme ungleich verteilt, und professionelles Lobbying-Know-how steht oft nur privilegierten Gruppen zur Verfügung. Auch der frühe Einbezug der Interessengruppen in den Gesetzgebungsprozess in Deutschland kann die parlamentarische Gestaltung einschränken und strukturkonservativ wirken.
Welches Fazit wird in Bezug auf die Modelle des Neo-Korporatismus/Pluralismus gezogen?
Interessenverbände üben in beiden Systemen einen beträchtlichen Einfluss aus, auch wenn sie unterschiedliche Methoden anwenden. In der Bundesrepublik herrscht eher eine Form der Austauschlogik, die beiden Seiten Vorteile bringt. Die Machtprozesse der USA lassen sich damit allerdings nicht angemessen erfassen. Auch in den USA ist die sozioökonomische Gleichheit bei der Vertretung spezifischer Interessen nicht gegeben, und ressourcenstarke Verbände haben größere Einflussmöglichkeiten.
- Quote paper
- Philipp von Schön-Angerer (Author), 2000, Interessenverbände der USA und der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99379