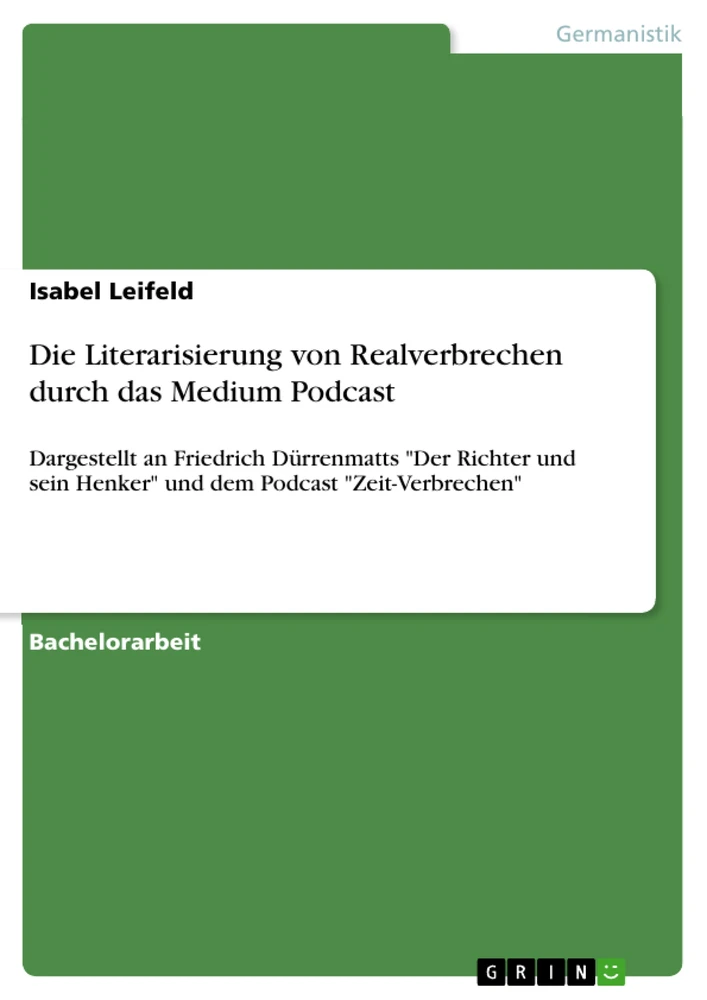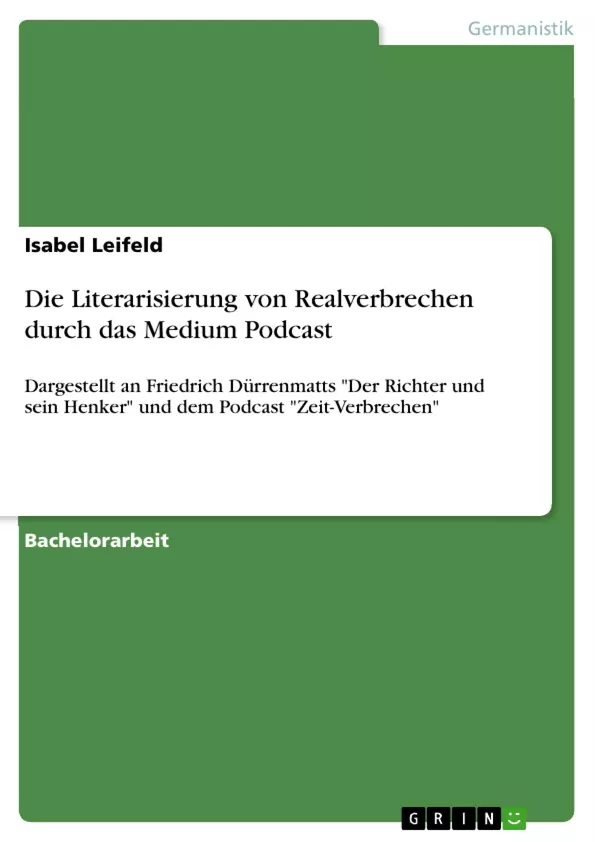Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage nach Literarisierung von Realverbrechen. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Hörbuch, einem Podcast und einem Kriminalroman und welche literarischen Strukturen finden wir in auditiv übermittelten Verbrechenserzählungen. Anhand eines Vergleichs zwischen Friedrich Dürrenmatts "Der Richter und sein Henker" aus dem Jahr 1992 und vier Folgen des Podcasts "Zeit Verbrechen" aus dem Jahr 2019 werden typische Genrestrukturen sichtbar gemacht und gleichzeitig verdeutlicht, wie sich literarische Formate gegenseitig bedingen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klassische Strukturen eines Detektivromans
- 2.1 Erzählmuster
- 2.2 Der Richter und sein Henker
- 2.3 Das Figurentableau
- 3. True Crime – von Robert-François Damien zu Steven Avery
- 4. Das Podcast Phänomen
- 4.1 Hören versus Lesen
- 4.2 Bestimmung der Gattung Podcast
- 5. Der Fall Amelie
- 5.1 Narrative Strukturen
- 5.2 Sabine Rückert als zentrale Ermittlungsinstanz
- 5.3 Die Rolle der Schriftlichkeit
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarischen Strukturen und Motive klassischer Detektivromane im Medium Podcast. Der Roman "Der Richter und sein Henker" dient als Vergleichsbasis zum Podcast "Zeit-Verbrechen". Die Analyse umfasst gattungstheoretische Überlegungen zum Detektivroman und zum Podcast, sowie einen Vergleich der Figuren und Erzählstrukturen beider Medien. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit ein Podcast als literarisches Werk verstanden werden kann.
- Vergleich der Strukturen von klassischem Detektivroman und Podcast
- Analyse der Erzählperspektiven und Figuren in "Der Richter und sein Henker" und "Zeit-Verbrechen"
- Untersuchung des Genres "True Crime" und seiner Entwicklung
- Gattungsbestimmung des Podcasts im Vergleich zu ähnlichen Medien
- Die Rolle der Schriftlichkeit im Vergleich zwischen Roman und Podcast
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: einen Vergleich der kriminalliterarischen Strukturen und Motive eines klassischen Detektivromans mit denen eines Podcasts. "Der Richter und sein Henker" von Friedrich Dürrenmatt wird als Schablone für den Podcast "Zeit-Verbrechen" verwendet. Die Einleitung führt in die gattungstheoretische Kontextualisierung des Detektivromans ein, thematisiert die Rolle des Lesers und der Figurenperspektiven und betont den Unterschied im Wahrheitsgehalt zwischen fiktionaler Erzählung und True Crime. Die Analyse der beiden Medien wird an Hand klassischer Merkmale des Detektivromans erfolgen.
2. Klassische Strukturen eines Detektivromans: Dieses Kapitel definiert die klassischen Strukturen des Detektivromans, indem es Erzählmuster, das Figurentableau und die spezifischen Merkmale von Detektivromanen untersucht. Es legt die Grundlage für den späteren Vergleich mit dem Podcast "Zeit-Verbrechen" und identifiziert Schlüsselmerkmale, die im Laufe der Arbeit auf ihre Übereinstimmung und Abweichungen hin analysiert werden. Die Bedeutung der Leserschaft und ihre Rolle im Rätsel wird ebenfalls betont.
3. True Crime – von Robert-François Damien zu Steven Avery: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Genres "True Crime", von seinen Anfängen bis zu modernen Beispielen. Es analysiert die Verschiebung des Fokus vom abschreckenden Beispiel hin zu einem besseren Verständnis der Täterbiografien und die unterschiedlichen Intentionen hinter der Darstellung von Verbrechen im Laufe der Geschichte. Dieser historische Überblick bildet den Kontext für die Analyse von "Zeit-Verbrechen" als True Crime Podcast.
4. Das Podcast Phänomen: Dieses Kapitel untersucht das Medium Podcast, insbesondere seine Besonderheiten im Vergleich zu anderen Medien, wie dem Hörspiel. Es beleuchtet den Unterschied zwischen gehörter und gelesener Literatur und versucht, das Phänomen des Podcasts im Kontext seines aktuellen Booms in Deutschland zu erklären. Aufgrund der relativen Neuheit des Mediums wird die Gattung über die Abgrenzung zu etablierten Medien definiert.
5. Der Fall Amelie: Dieses Kapitel analysiert den Podcast "Zeit-Verbrechen" und den Kriminalfall um Amelie S., der im Mittelpunkt steht. Es untersucht die narrativen Strukturen des Podcasts, die Rolle von Sabine Rückert als Ermittlerin und die Bedeutung von Schriftlichkeit im Kontext der auditiven Präsentation. Der Fall Amelie wird als Beispiel für True Crime herangezogen, wobei der Fokus auf den Vergleich zu den Merkmalen des klassischen Detektivromans liegt.
Schlüsselwörter
Detektivroman, Podcast, True Crime, Zeit-Verbrechen, Der Richter und sein Henker, Friedrich Dürrenmatt, Sabine Rückert, Erzählstrukturen, Figurenkonstellation, Gattungstheorie, Hörliteratur, literarische Adaption, Wahrheitsgehalt, fiktionale Erzählung, reale Verbrechen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Detektivromanen im Medium Podcast
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die literarischen Strukturen und Motive klassischer Detektivromane mit denen von Podcasts, insbesondere im Genre True Crime. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit ein Podcast als literarisches Werk verstanden werden kann.
Welche Texte/Podcasts werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Friedrich Dürrenmatts Roman "Der Richter und sein Henker" als Beispiel für den klassischen Detektivroman und den Podcast "Zeit-Verbrechen" (Fall Amelie S.) als Beispiel für True Crime im Podcast-Format. Diese beiden werden vergleichend untersucht.
Welche Aspekte werden verglichen?
Der Vergleich umfasst Erzählmuster, Figurenkonstellationen, die Rolle der Erzählperspektive, die Bedeutung von Schriftlichkeit (im Roman) versus Oralität (im Podcast) und die Gattungstheorie beider Medien. Die Arbeit untersucht auch die Entwicklung des Genres "True Crime" und die Besonderheiten des Mediums Podcast.
Wie wird der Vergleich durchgeführt?
Die Analyse basiert auf der Identifizierung klassischer Merkmale des Detektivromans, die dann auf ihre Übereinstimmung und Abweichung im Podcast "Zeit-Verbrechen" hin untersucht werden. Die Arbeit berücksichtigt dabei auch die Unterschiede zwischen fiktionaler Erzählung und der Darstellung realer Verbrechen in True Crime-Formaten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Vergleich der Strukturen von klassischem Detektivroman und Podcast; Analyse der Erzählperspektiven und Figuren in beiden Medien; Untersuchung des Genres "True Crime"; Gattungsbestimmung des Podcasts; und die Rolle der Schriftlichkeit im Vergleich zwischen Roman und Podcast.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Klassische Strukturen eines Detektivromans, True Crime, Das Podcast-Phänomen, Der Fall Amelie (Analyse von "Zeit-Verbrechen"), Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt des Vergleichs oder der Kontextualisierung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Fazit der Arbeit dargestellt und sind in dieser Zusammenfassung nicht enthalten.) Die Arbeit zielt darauf ab, die literarischen Qualitäten und Strukturen von Podcasts im Kontext des True Crime Genres zu beleuchten und sie mit den traditionellen Strukturen des Detektivromans zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Detektivroman, Podcast, True Crime, Zeit-Verbrechen, Der Richter und sein Henker, Friedrich Dürrenmatt, Sabine Rückert, Erzählstrukturen, Figurenkonstellation, Gattungstheorie, Hörliteratur, literarische Adaption, Wahrheitsgehalt, fiktionale Erzählung, reale Verbrechen.
- Citation du texte
- Isabel Leifeld (Auteur), 2020, Die Literarisierung von Realverbrechen durch das Medium Podcast, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/993515