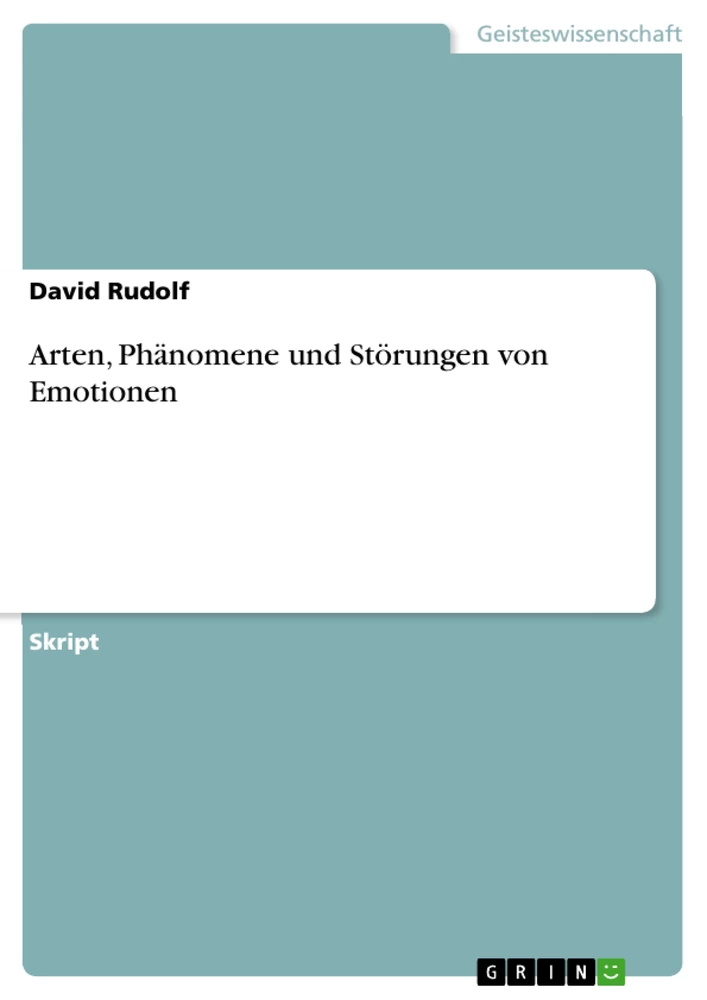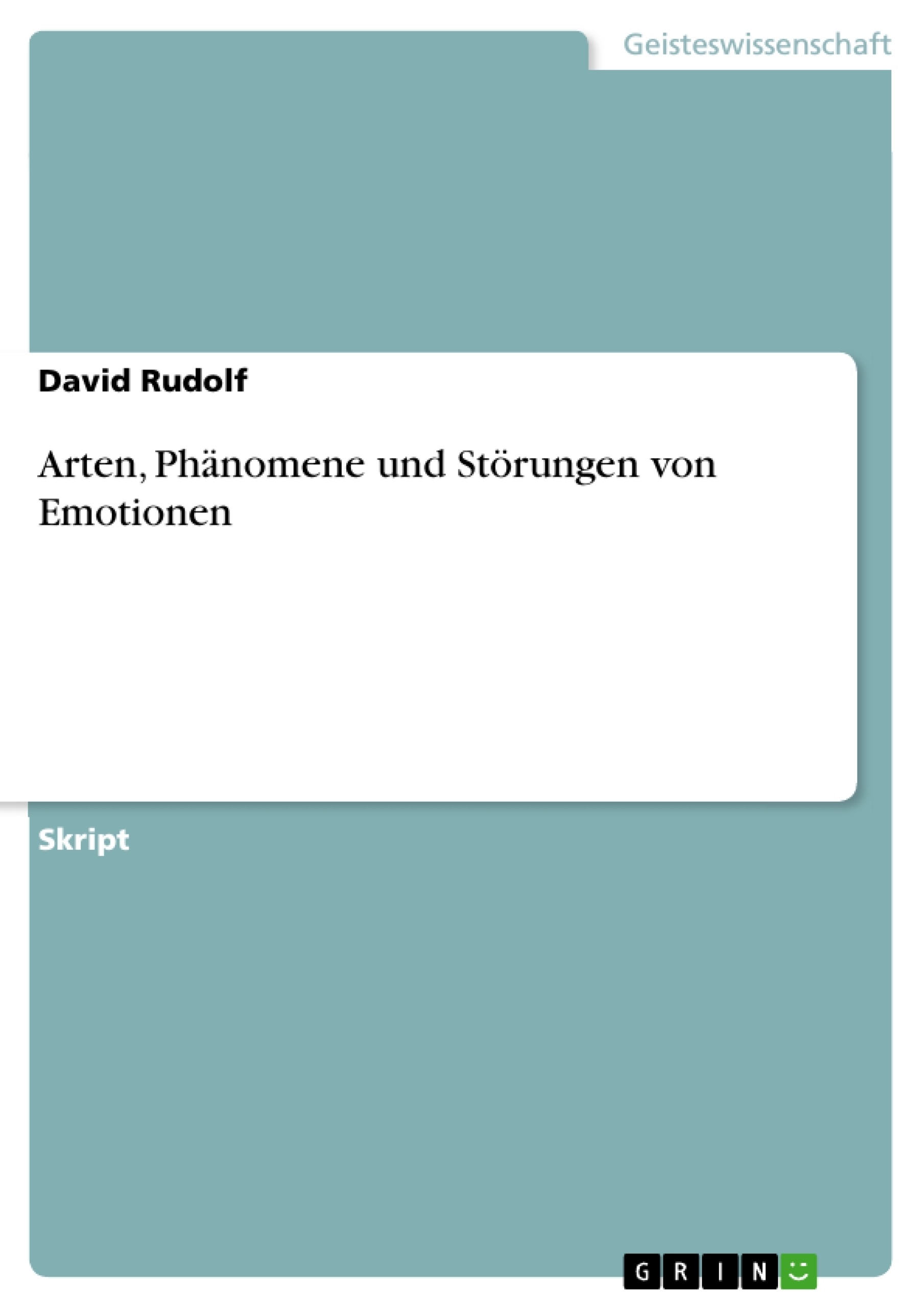Emotionen
Emotion ein Sammelbegriff für verschiedene Phänomene, wie Gefühle, Stimmungen, Affekte, usw. Allgemein kann man sagen, dass Emotionen handlungssteuernde Erregungszustände von Lebewesen sind. Emotionen spiegeln dabei immer den psychophysischen Gesamtzustand des Organismus, sie sind immer gleichzeitig psychisch, wie physisch. Gefühle lassen sich anhand von folgenden Dimensionen beschreiben:
1. Körperlich-vegetativ: Die Verarbeitung eines Reizes wirkt sich auf unser vegetatives Nervensystem aus, im Falle der Angst wird z.B. die Atmung, das Herz- Kreislauf-System, Verdauung, usw. beeinflusst. Gleichzeitig wirkt sich eine Emotion auf unsere willkürliche und unwillkürliche Motorik aus: an der Mimik oder der Körperhaltung (Ausdrucksverhalten) ist oft zu erkennen, wie sich jemand fühlt.
2. Erleben: Emotionen sind erlebte Zustände, die benannt und beschrieben werden können. In ihnen manifestieren sich immer wertende Beziehungen zu den auslösenden Ereignissen. Dadurch stehen sie auch in enger Wechselwirkung mit anderen kognitiven Funktionen, wie dem Denken. Emotionen sind phylogenetisch ältere Formen der Kognition.
3. Handeln: Emotionen gehören zu den wichtigsten Motiven unseres Handelns. Durch ihre bewertende Funktion zeigen sie eine Ist-Soll-Diskrepanz auf und verweisen damit implizit auch auf ein Handlungsziel im Sinne der Selbstregulation. Zudem dient das Ausdrucksverhalten der Emotion (Mimik, Körpersprache, s.1.) auch der zwischen-menschlichen Kommunikation. Es informiert über den momentanen Zustand und das zukünftige Verhalten eines Organismus und hat somit eine wichtige soziale, kommunikative Funktion.
Emotionen sind also komplexe Interaktionsgefüge verschiedener Teilprozesse. So bestimmt bspw. das emotionale Erleben den Ausdruck von Gefühlen; gleichzeitig wirken aber der Ausdruck und die damit einhergehenden physiologischen Veränderungen zurück auf das emotionale Erleben.
Folgende emotionalen Phänomene werden unterschieden:
3913T Gefühle: Dieser Begriff bezieht sich auf eine nicht weiter reduzierbare Bewusstseinsqualität, es sind unmittelbar gegebene, erlebte Phänomene. Als solche sind sie so schwer analysierbar, wie z.B. Sinnesqualitäten, Farbwahrnehmungen, etc. Folgende Eigenschaften charakterisieren Gefühle:
1. Gefühle durchdringen das gesamte Erleben.
2. Gefühle sind nicht wie z.B. optische Wahrnehmugen strukturiert und gestaltet, sie sind diffus und verschwommen gegliedert.
3. Gefühle entstehen autogen und lassen sich nicht bewusst verdrängen oder abblocken.
4. Gefühle sind Reaktionen auf innere oder äussere Ereignisse.
1. Affekte: Affekte sind Erlebniszustände von ganz besonderer Intensität. Sie sind in der Regel sehr heftig, von kürzerer Dauer als Emotionen und oft von deutlich sichtbaren körperlichen Veränderungen begleitet: Erröten, Schweissausbrüche, Zittern, etc. Während eines Affektzustandes nimmt die geistige Klarheit deutlich ab. Solche Bewusstseinsstörungen spielen in der forensischen Psychologie und in der Psychiatrie eine wichtige Rolle.
2. Stimmungen: Während Gefühle durch einen aktuellen Anlass ausgelöst werden und in ihrer Dauer begrenzt sind und im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen (Figur), sind Stimmungen relativ gleichförmige Dauertönungen (Grund) des Erlebens.
Gefühlsdimensionen
Es wurden viele Versuche unternommen die Vielfältigkeit des Gefühlserlebens zu ordnen und wissenschaftlich beschreibbar zu machen. Heute kann man 2 hauptsächliche Erlebnisdimensionen empirisch nachweisen: Lust-Unlust / Aktivierung-Desaktivierung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gefühlsentstehung
Evolutionstheoretiker behaupten, dass Emotionen ein Produkt der Entwicklungsgeschichte sind und, und innerhalb jeder Spezies die jeweiligen Überlebenserfordernisse widerspiegeln. Emotionen sind demnach Reaktionen auf relevante Situationen.
Diese Situationen werden, falls sie schnelles Handeln fordern, primär reflexartig über körperliche Prozesse verarbeitet (z.B. löst ein rasendes Auto Fluchtreflexe aus). Dieses Verhalten (Muskelaktivität, erhöhter Puls und Atemfrequenz, Verengung der Pupillen, etc.) wird dann erst sekundär kognitiv bewertet und interpretiert, was zu weiterem körperlichem Verhalten führt (schneller Rennen bei nahendem Auto). Der primäre Auslöser von Emotionen können also Körperprozesse sein, kognitive Faktoren wirken dabei bloss sekundär verstärkend auf das Gefühlserleben.
Andererseits kann die Situation, falls sie nicht derart dringlich ist, auch zuerst kognitiv verarbeitet werden. Je nach Bewertung setzen dann körperliche Reaktionen ein, z.B. Entspannung nach getaner Arbeit. Diese Reaktionen (vermehrte Verdauungstätigkeit, Lächeln, Gefässerweiterung, etc.) werden wiederum wahrgenommen und als lustvoll/desaktivierend interpretiert. Bei dieser Variante sind die kognitiven Prozesse primär, die körperlichen Reaktionen wirken lediglich verstärkend auf das Gefühlserleben. Die körperlichen und kognitiven Gefühlskomponenten sind aber immer untrennbar miteinander verbunden.
Emotion und Denken
Wie gesagt, geht man davon aus, dass Emotionen phylogenetische Vorgänger des rationalen Denkens sind. Daher liegt es nahe eine gegenseitige Beeinflussung von Gedanken und Gefühlen anzunehmen. Zahlreiche empirische Studien haben Anhaltspunkte dazu geliefert.
3913T Emotion und Gedankeninhalt: Versuchspersonen, die in Einkaufszentren über die Qualität von irgendwelchen Gebrauchsgegenständen befragt werden, schätzen diese markant positiver ein, wenn sie zuvor scheinbar unabhängig ein kleines Werbegeschenk erhalten haben, das ihre allgemeine Zufriedenheit erhöhte.
Diese sogenannte emotionskongruente Verarbeitung kann als ein Spezialfall der hypothesen- oder konzeptgesteuerten Wahrnehmung und Verarbeitung (top-down) verstanden werden. Die Verarbeitung beruht in diesem Fall also wenig auf konkret vorliegender Information, vielmehr haben Voreingenommenheiten und Vorurteile einen starken Einfluss.
Dieser Effekt kann durch assoziative Bahnungen erklärt werden. Positive Gedächtnisinhalte sind stärker mit anderen positiven, als mit negative Gedächtnisinhalten verknüpft.
Eine andere Erklärung greift auf oft verwendete Heuristiken zurück. Die sogenannte ·Was- empfinde-ich-dabei?`-Heuristik besagt, dass wenn Menschen eine Bewertung vornehmen sie häufig ihr eigenes Empfinden gegenüber diesem Sachverhalt als Grundlage ihrer Bewertung nehmen. "Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Auto?" Man könnte eine genaue Analyse der Vor- und Nachteile des Wagens auf diese Frage aufstellen und anschliessend ein fundiertes Urteil abgeben. Im Normalfall wird jedoch nur das eigene Gefühl gegenüber dem Wagen abgefragt. Diese gefühlsmässige Einstellung dem Wagen gegenüber kann stark von der momentanen Stimmung überlagert und beeinflusst werden. Der eigene emotionale Zustand wird auf das zu bewertende Objekt projiziert.
Diesem Projektionsmechanismus kann man jedoch bewusst entgegensteuern. Eine Projektion findet nämlich nur statt, wenn es keine Gründe gibt, die eigene Stimmung als Grundlage für die Gefühlsheuristik abzuwerten. Man befragte z.B. Personen telefonisch an Tagen mit gutem und schlechtem Wetter nach ihrer Lebenszufriedenheit. Wie nach der Gefühlsheuristik zu erwarten ist, wurde die Lebenszufriedenheit bei gutem Wetter für besser empfunden, als bei schlechtem Wetter.
Der Unterschied verschwand jedoch, wenn zu Beginn des Telefonats die Aufmerksamkeit mit der Frage "Wie ist das Wetter bei Ihnen?" auf das Wetter gelenkt wurde. Durch die Beantwortung dieser Frage wird die eigene Stimmung vermehrt mit dem Wetter in Zusammenhang gebracht. Dadurch sank der Informationsgehalt der eigenen Gefühlslage für die Frage nach der Lebenszufriedenheit, so dass die Gefühlsheuristik entsprechend korrigiert wurde. Der Zusammenhang Lebenszufriedenheit - Wetter nahm deutlich ab.
3913T Emotion und Denkstile: Bei schlechter Gestimmtheit herrscht ein analytischer Denkstil vor: negative Emotionen signalisieren eine Gefahr oder einen Handlungsbedarf, weshalb es Sinn macht mit einer analytischen Verarbeitung die Fehlerrate zu reduzieren. Der analytische Denkstil bedient sich nämlich weniger Heuristiken und verarbeitet die gegebenen Informationen genauer. Schlecht gelaunte Menschen sind dadurch auch deutlich weniger einfach von etwas zu überzeugen.
Gut gelaunte Menschen tendieren dazu auf allgemeine Wissensstrukturen und Heuristiken zu vertrauen. Dadurch wird aber auch die Verarbeitungskapazität erhöht, es können mehr Gedächtnis- und Wahrnehmungsinhalte miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das wiederum führt zu einem intuitiven Denkstil, der durch grössere Kreativität gekennzeichnet ist.
Emotionale Intelligenz
Der Begriff der emotionalen Intelligenz steht für den begabten Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen. Der herkömmliche Intelligenzquotient misst in erster Linie kognitive Fähigkeiten und erfasst damit nur zu einem kleinen Teil das, was berufliche und private Zufriedenheit garantiert. Emotionale Intelligenz umfasst folgende Qualitäten:
1. Interpretation und Ausdruck von Emotionen: Hier geht es darum, wie gut wir eigene Gefühle wahrnehmen und zum Ausdruck bringen können du zum anderen, wie adäquat wir die Emotionen anderer wahrnehmen, interpretieren und nachempfinden können. Diese Fähigkeiten sind vor allem für die soziale Kommunikation notwendig.
2. Regulation von Emotionen: Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz zeichnen sich dadurch aus, dass sie Strategien der Emotionsregulation flexibel beherrschen und zum eigenen Wohl einsetzen können. Zu diesen Strategien zählen selbstwertdienliche Attributionsmuster, kognitive Umstrukturierung, angemessene Problemlösestrategien (Coping), Techniken der Entspannung und Regeneration, usw.
3. Produktive Nutzung von Emotionen: Gefühle kontrollieren zu können, hat nur einen Sinn, wenn sie auch eine Funktion für die Verhaltensregulation erfüllen. Der emotional Intelligente weiss um die Auswirkungen von Emotionen und kann von ihnen abstrahieren. So kann er seinen Denkstil, Denkinhalte, Motivation, usw. der Situation anpassen und ein grösseres Spektrum an (Zukunfts-)Szenarien berücksichtigen.
Emotionale Störungen
Emotionsstörungen stehen im Zentrum vieler psychopathologisher Syndrome, stellen also zentrale Komponenten komplexer Störungen dar. Im folgenden wird kurz der Stellenwert von emotionalen Störungen für einige wichtige klinische Syndrome geschildert:
3913T Phobische Störungen: Phobische Störungen umfassen objektspezifische Angst und damit einhergehendes Vermeidungsverhalten. Dabei ist klar, dass Angst für das jeweilige Vermeidungsverhalten verantwortlich ist. Vermeidungsverhalten wirkt aber seinerseits aufrechterhaltend auf die Angst zurück: Da der Konfrontation mit dem gefürchteten Verhalten aus dem Weg gegangen wird, besteht keine Chance positive Assoziationen zum angstauslösenden Objekt zu knöpfen.
3913T Zwangsstörungen: Zwangsverhalten kann subjektiv der Vermeidung von Ereignissen dienen, vor denen Angst besteht (s.o.). Sind solche Gedanken und Handlungen so übergreifend, dass sie die täglichen Lebensvollzüge beeinträchtigen, kommt es sekundär zu einem Verlust an positiven Lebensereignissen.
3913T Affektive Störungen: Z.B. Depression: Negative Kognitionen führen zu Traurigkeit, die aus gedächtnispsychologischen Gründen negative Kognitionen begünstigt. Dadurch wird die Motivation eingeschränkt (Rückzug), was ein weiteres Ausbleiben positiver Ereignisse fördert.
3913T Psychosomatische Störungen: Psychosomatische Störungen sind körperliche Störungen, die durch subjektiven Stress und die damit einhergehenden körperlichen Prozesse mitverursacht werden. Eine wesentliche Art von erlebtem Stress sind negative Emotionen.
Exkurs - Stress:
Ein Stressor ist ein Reiz, der vom Organismus eine Anpassungs-Reaktion verlangt. Stress ist ein Muster spezifischer und unspezifischer Reaktionen auf Reize, die das Gleichgewicht des Organismus stören.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Emotionen?
Emotionen sind handlungssteuernde Erregungszustände von Lebewesen, die den psychophysischen Gesamtzustand des Organismus widerspiegeln. Sie sind gleichzeitig psychisch und physisch und lassen sich anhand von körperlich-vegetativen Reaktionen, Erleben und Handeln beschreiben.
Welche Dimensionen beschreiben Gefühle?
Gefühle lassen sich durch drei Dimensionen beschreiben:
- Körperlich-vegetativ: Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem und die Motorik.
- Erleben: Bewusste Zustände mit wertenden Beziehungen zu Auslösern.
- Handeln: Motive für unser Handeln und Ausdrucksverhalten zur Kommunikation.
Welche emotionalen Phänomene werden unterschieden?
Es werden unterschieden: Gefühle (unmittelbar gegebene Bewusstseinsqualitäten), Affekte (intensive, kurzfristige Erlebniszustände mit körperlichen Veränderungen) und Stimmungen (gleichförmige Dauertönungen des Erlebens).
Welche Gefühlsdimensionen gibt es?
Zwei hauptsächliche Erlebnisdimensionen sind empirisch nachweisbar: Lust-Unlust und Aktivierung-Desaktivierung.
Wie entstehen Gefühle laut Evolutionstheoretikern?
Emotionen sind ein Produkt der Entwicklungsgeschichte und spiegeln die Überlebenserfordernisse der jeweiligen Spezies wider. Sie entstehen als Reaktionen auf relevante Situationen, entweder primär reflexartig über körperliche Prozesse oder zuerst kognitiv verarbeitet.
Wie beeinflussen Emotionen das Denken?
Emotionen und Denken beeinflussen sich gegenseitig. Emotionskongruente Verarbeitung und Heuristiken wie die "Was-empfinde-ich-dabei?"-Heuristik spielen eine Rolle. Die aktuelle Stimmung kann die Bewertung von Sachverhalten beeinflussen.
Was ist emotionale Intelligenz?
Emotionale Intelligenz steht für den begabten Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen und umfasst die Interpretation und den Ausdruck von Emotionen, die Regulation von Emotionen und die produktive Nutzung von Emotionen.
Welchen Stellenwert haben Emotionen bei emotionalen Störungen?
Emotionsstörungen sind zentrale Komponenten vieler psychopathologischer Syndrome, wie z.B. phobische Störungen, Zwangsstörungen, affektive Störungen (z.B. Depression) und psychosomatische Störungen. Angst und negative Kognitionen spielen hier eine wichtige Rolle.
Was versteht man unter Stress und wie hängt er mit Emotionen zusammen?
Ein Stressor ist ein Reiz, der eine Anpassungsreaktion des Organismus erfordert. Stress ist eine Reaktion auf Reize, die das Gleichgewicht des Organismus stören. Negative Emotionen können eine wesentliche Art von erlebtem Stress darstellen und psychosomatische Störungen mitverursachen.
- Quote paper
- David Rudolf (Author), 1998, Arten, Phänomene und Störungen von Emotionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99344