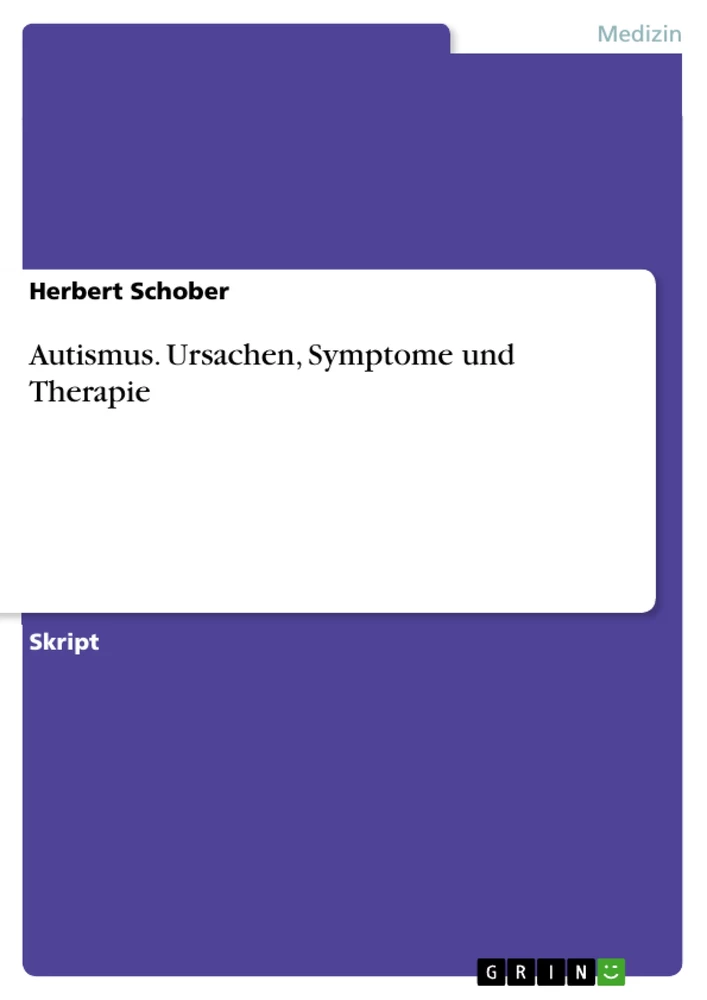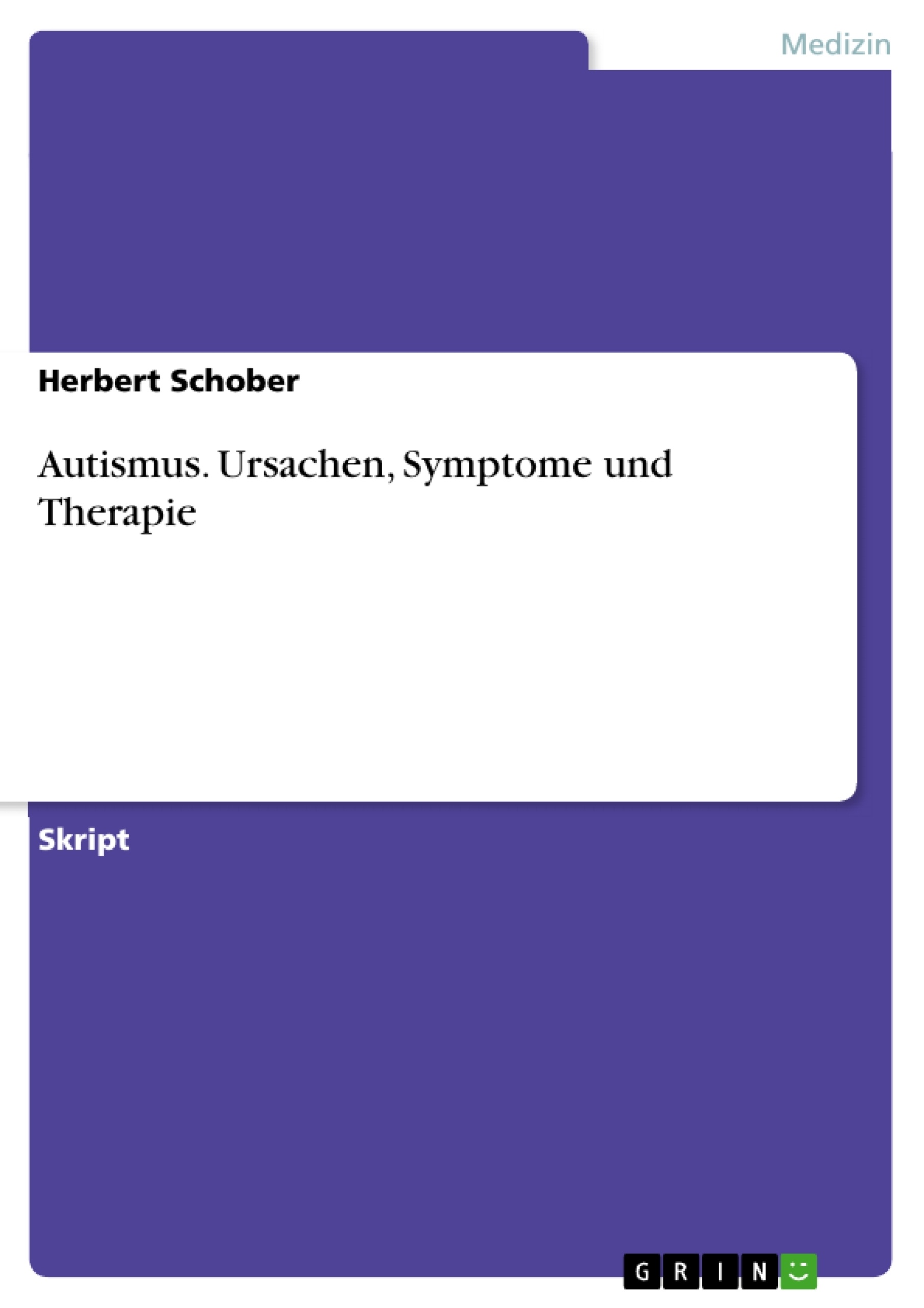Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die einfachsten Sinnesreize zu einer überwältigenden Kakophonie werden, in der zwischenmenschliche Beziehungen wie unüberwindbare Mauern erscheinen und die eigene innere Welt zum einzigen Zufluchtsort wird. Dieses Buch enthüllt auf einfühlsame und wissenschaftlich fundierte Weise das komplexe Universum des Autismus, einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, die das Leben von Kindern und ihren Familien grundlegend verändert. Von den subtilen Anzeichen im Säuglingsalter, wie mangelndem Blickkontakt und Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Sinnesreizen, bis hin zu den charakteristischen Verhaltensweisen im Kleinkindalter, wie Echolalie, Stereotypien und der Fixierung auf bestimmte Objekte, werden die vielfältigen Facetten des Autismus detailliert beleuchtet. Die Leser erhalten einen umfassenden Einblick in die aktuellen Forschungsergebnisse zu den Ursachen, wobei sowohl genetische als auch hirnorganische Faktoren berücksichtigt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Früherkennung und den verschiedenen Therapieansätzen, die von lerntheoretisch begründeten Verfahren über Basaltherapien zur Förderung der Körperwahrnehmung bis hin zu kreativen Ansätzen wie Musik- und Tiertherapie reichen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Eltern, Angehörige, Pädagogen und Therapeuten, die autistische Kinder verstehen, unterstützen und ihnen helfen möchten, ihr volles Potenzial zu entfalten. Es bietet nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch Hoffnung und Inspiration für eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit Autismus ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen können. Tauchen Sie ein in die Welt des Autismus, erweitern Sie Ihr Verständnis und entdecken Sie die einzigartigen Stärken und Perspektiven, die diese Menschen in unsere Gesellschaft einbringen. Lernen Sie die vielfältigen Therapieansätze kennen, von der Verhaltenstherapie bis hin zu innovativen Methoden, und erfahren Sie, wie Sie autistischen Kindern helfen können, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, soziale Kompetenzen zu entwickeln und ein selbstständiges Leben zu führen. Dieses Buch ist ein Wegweiser durch den Dschungel der Informationen und bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um eine positive Veränderung im Leben eines autistischen Kindes zu bewirken. Es ist eine Einladung, Vorurteile abzubauen, Empathie zu entwickeln und eine inklusive Welt zu schaffen, in der jeder Mensch, unabhängig von seinen Besonderheiten, seinen Platz findet und wertgeschätzt wird. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Wahrnehmung und lernen Sie, die Welt aus den Augen eines autistischen Kindes zu sehen.
1. Allgemeines
Der Begriff ,,Autismus" leitet sich vom griechischen Wort autos = selbst ab.
Das Lexikon erklärt Autismus als psychische Störung mit krankhafter Ichbezogenheit, Apathie, Verlust des Umweltkontakts und Flucht in eine eigene Fantasiewelt.
Nach internationalen Untersuchungen sind 4 - 6 von 10 000 Kindern betroffen.
Das bedeutet, dass bei ca. 40 Kindern eines Geburtsjahrganges in Österreich ein Fall von Autismus auftritt.
Rechnet man die Dunkelziffer hinzu, so übersteigt die Zahl der autistischen Kinder jene der Sehbehinderten und Blinden.
,,Frühkindlicher Autismus" bedeutet, dass diese Störung nicht unbedingt schon von Geburt an bestehen muß.
Das autistische Verhalten kann in der frühen Kindheit am stärksten auftreten und später zurückgehen.
2. Symptome
Autismus äußert sich nicht phänotypisch. Die betroffenen Kinder sehen ganz ,,normal" aus, manchmal sind sie sogar außergewöhnlich hübsch.
Betroffene Kinder können zwar sehen, hören, tasten, riechen und schmecken, die vielen Sinnesreize jedoch Nur schwer zu einem sinnhaften Ganzen verarbeiten.
Das Kind kann die Zusammenhänge seiner Umwelt nicht verstehen. Somit entsteht keine richtige Wahr- nehmung.
Die Folge ist, dass sich betroffene Kinder ihre eigene Welt schaffen, in der sie die Sicherheit finden, die sie Brauchen.
Dies erfolgt in den ersten Lebensmonaten. Eine Mutter-Kind-Beziehung bleibt dem Kind verschlossen.
Damit ist jedoch auch Lernen durch Nachahmung unmöglich und das Kind verharrt in den Verhaltensweisen der frühesten Entwicklungsstufe.
Vorhandene Anlagen, die sich erst durch das Tun entwickeln, müssen verkümmern.
In sich eingesponnen fühlt sich das Kind wohl, es greift zu Ersatzhandlungen (Stereotyopen) und wehr sich aktiv gegen jeden Einbruch von außen, der die Ordnung der bestehenden Situation stört.
Hinter diesem Verhalten steht wahrscheinlich der unbewußte Wunsch nach Fortsetzung des geborgenen Zustandes im Mutterleib.
2.1 Symptome im Säuglingsalter
Die Säuglinge reagieren nur geringfügig auf ihre Umwelt. Die Kinder sind laut Auskunft ihrer Mütter ,,nicht anschmiegsam" und strecken niemals die Arme aus, wenn sie hochgenommen werden wollen.
Manche Babys schreien sowohl tags über, als auch nachts sehr viel und sind oft kaum zu beruhigen.
Andere wiederum verhalten sich auffallend ruhig und zeigen wenig Interesse an ihrer Umgebung.
Oft sind sie von Lichtern fasziniert, zeigen andererseits jedoch keinerlei Interesse an Dingen, welche die Aufmerksamkeit eines gesunden Babys wecken.
2.2 Symptome im Alter von zwei bis fünf Jahren
In dieser Altersgruppe ist das autistische Verhalten am auffälligsten.
- ungewöhnliche Reaktionen auf Geräusche:
Autistische Kinder haben häufig Schwierigkeiten mit der Verarbeitung gehörter Informationen.
Typisch ist die fehlende Reaktion auf Geräusche. Oft entsteht der Eindruck, sie wären taub.
- Sprachverständnis:
Autistische Kinder verstehen meist mehr., als sie sprechen können.
Erst mit etwa fünf Jahren entwickeln viele Kinder ein begrenztes Verständnis für die Sprache. Sie gehorchen einfachen Befehlen, wobei jegliche Komplikation so verwirrt, dass es wütend wird oder sich zurückzieht.
- Sprachabnormitäten:
Besonders typisch ist die ,,Echolalie": Dabei wiederholt das Kind das letzte Wort oder die letzen Worte eines Satzes. Oft werden sogar der genaue Akzent und die Tonhöhe des Sprechens nachgeahmt. Fragen werden nicht beantwortet, sondern als Echo nachgesprochen.
Ein weiteres typisches Merkmal ist die ,,verzögerte Echolalie": Dabei gibt das Kind Abschnitte von Unter- haltungen wieder, die es früher einmal gehört hat. Manchmal werden diese Wörter tagelang wiederholt.
Auch die Namen von Dingen, die gewöhnlich zusammengehören können durcheinandergebracht werden.
Dabei werden zum Beispiel die Namen von Gegenständen verwechselt, nicht jedoch die Gegenstände selbst (zum Beispiel ,,Kamm" und ,,Haarbürste").
Oft werden Wörter in die falsche Reihenfolge gesetzt (,,...geht mit dem Park zum Hund...")
Autistische Kinder haben meist auch Probleme mit der Kontrolle der Lautstärke ihrer Stimme. Daher klingt diese oft rein mechanisch.
Ein weiteres typisches Kennzeichen ist die seltene Verwendung von Gestik und Mimik.
- Probleme der visuellen Wahrnehmung:
Autistische Kinder haben Schwierigkeiten, gesehene Dinge wirklich zu erfassen und zu begreifen.
Schon als Babys ignorieren sie Dinge, auf welche gesunde Kinder gerne schauen. Dafür sind sie fasziniert von glänzenden Metallen oder Lichtern.
Mit Vorliebe schauen sie auf bewegte Objekte. Dieser Zustand reicht bis ins Kindergartenalter.
Autistische Kinder sehen darüber hinaus Menschen und Gegenstände nicht lange an, sondern werfen nur kurze Blicke darauf und schauen dann wieder weg. Der Blickkontakt mit anderen Personen wird vermieden.
Diese ,,visuelle Meidung" ist sehr häufig.
Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Verarbeitung visueller Reize zu sinnvollen Strukturen wird versucht, komplexe visuelle Strukturen überhaupt nicht erst zu sehen.
Eine sehr vielfältige und schnell wachsende Umgebung kann autistische Kinder aus der Falssung bringen und Wutanfälle auslösen.
- Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn:
Vorwiegend über diese Sinne erschließen sich autistische Kinder ihre Umwelt.
So be"greifen" sie oft lange glattes Holz, weichen Pelz oder Plastik und riechen gerne an den Händen ihrer Eltern.
Gleichzeitig kann oft eine Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz oder Kälte festgestellt werden.
- Motorisches Verhalten:
Typisch sind Unvollkommenheiten in den Bewegungen.
Häufig besteht eine Neigung zu Zehenspitzengang, wobei die Beine manchmal steif gehalten werden.
Charakteristisch sind auch besondere Bewegungen wie ,,Auf-und-ab-hüpfen", Schaukelbewegungen oder Verdrehen der Handgelenke.
2.3 Charakteristische Verhaltensweisen
Nachdem autistische Kinder in ihrem Wortverständnis begrenzt und unreif sind, legen sie oft Verhaltensweisen an den Tag, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden.
Während einige ruhig und passiv sind, sind andere wiederum sehr tatkräftig und zielstrebig.
Oft haben betroffene Kinder keinerlei Tischmanieren, schreien in der Öffentlichkeit und entkleiden sich, wann immer sie Lust dazu haben.
Solchen Kindern fehlt oft die Furcht vor realen Gefahren: sie rennen oft direkt vor ein fahrendes Auto oder klettern auf ein Dach.
Auf der anderen Seite wiederum fürchten sie sich vor harmlosen Dingen (Baden in einer Wanne, Luftballons, nasse Flecken auf dem Teppich ...).
Oft werden verschiedene Gegenstände gehortet (Blechdosen, Steine usw.).
2.4 Veränderungen nach dem fünften Lebensjahr
Zwischen dem fünften und siebenten Lebensjahr tritt im allgemeinen eine deutliche Besserung ein.
Die Kinder werden zärtlicher und geselliger, sträuben sich weniger gegen Veränderungen. Auch leiden sie weniger oft an unbegründeten Ängsten, werden sich dafür realen Gefahren bewußter.
Auch Sprachprobleme und Bewegungsschwierigkeiten treten etwas zurück.
2.5 Besondere Fertigkeiten
Einige Autisten verfügen über besondere Fertigkeiten.
Die meisten Kinder lieben Musik und rhythmische Geräusche, einige können mit großer Geschwindigkeit Zahlenreihen im Kopf addieren.
Manche sind imstande, lange Gedichte aufzusagen oder sich Details von Bahn- oder Busfahrplänen einzuprägen.
Auch kann ein überdurchschnittliches Orientierungsvermögen vorliegen.
Autisten sind i.A. bei jenen Fertigkeiten anderen überlegen, welche keine Sprache erfordern.
3. Ursachen
Über die Ursachen des frühkindlichen Autismus gibt es bis heute keine gesicherten Kenntnisse.
Medizinische Forschungen haben jedoch gezeigt, dass es verschiedene Einflüsse gibt, die das Erscheinungsbild des Autismus hervorrufen können.
Die Vielfalt dieser Faktoren zeigt, dass es für Autismus keine einheitliche Ursache gibt.
Es ist daher unzulässig, das autistische Syndrom ausschließlich auf psychosoziale Ursachen zurückzuführen.
Bezüglich der Ursachen existieren mehrere Theorien. Die meiste Bedeutung kommt dabei den beiden
Folgenden zu:
- Autistische Kinder werden gesund geboren. Durch die Art der Erziehung wird jedoch ihre emotionale
Entwicklung gestört (Sozialisation)
- Autismus ist hirnorganisch bedingt (Anomalie des Gehirn)
Die Annahme einer körperlichen Ursache für den Autismus wird von vielen Fachleuten geteilt.
Es steht fest, dass bei voll ausgeprägtem autistischen Syndrom eine Störung der Wahrnehmungsverarbeitung vorliegt. Daher ist das betroffene Kind nicht in der Lage, die Reize aus seiner Umwelt - wahrscheinlich auch aus seinem eigenen Körper - richtig zu koordinieren.
3.1 Verursachungstheorien des Autismus
Aus der Vielzahl von Theorien über die Entstehung autistischer Störungen seien die folgenden genannt:
a) Psychogenetische Theorie
Danach besteht bereits vor der Geburt des Kindes bei der Mutter eine Persönlichkeitsstörung. Daher fehlt die Möglichkeit, während der ersten Lebenswochen zu dem sonst ganz normalen Säugling eine liebevolle Beziehung aufzubauen.
Die Grundaussagen dieser Theorie lassen sich allerdings sehr leicht widerlegen.
b) Genetische Verursachungstheorien
Danach gibt es eine Erbkomponente: Die Geschwister autistischer Kinder weisen viel häufiger Wahrnehmungsstörungen, Sprachentwicklungsverzögerungen, Lernschwierigkeiten, ja sogar geistige Behinderungen auf als die Geschwister gesunder Kinder.
Die Bedeutung einer eventuellen erblichen Disposition sollte jedoch in keinem Fall überbewertet werden.
c) Biomechanische Störungen
Reaktionen und Verhaltensweisen bei frühkindlichem Autismus könnten mit Störungen im Haushalt der Neurotransmitter zusammenhängen.
So weiß man, dass der am besten untersuchte Neurotransmitter Serotonin u.a. folgende Verhaltensweisen und Funktionen beeinflußt: Schlaf, Körpertemperatur, Schmerzempfinden, motorische Funktionen sowie Gedächtnis und Lernen.
Untersuchungen zeigten bei ca. einem Drittel der Autisten einen erhöhten Serotoninspiegel.
Aufgrund der bei vielen autistischen Kindern vorliegenden verminderten Schmerzempfindung könnte ein Zusammenhang zwischen Autismus und Endorphinen bestehen.
Endorphine sind Eiweißstoffe, die im Gehirn bzw. in der Hypophyse gebildet werden und bei Verletzungen
Bewirken, dass Schmerz und Durchblutung der vereltzen Stelle vermindert werden bzw. zusätzlich eine Beruhigung eintritt.
Bei elf von zwanzig autistischen Kindern konnte man erhöhte Endorphinwerte feststellen.
d) Organische Theorien
Der frühe Beginn autistischer Störungen mit Anzeichen für eine Hirnschädigung (Eßschwierigkeiten, Schreien), die Besserung der Symptome mit zunehmender Reifung und besonders das Wesen der Wahrnehmungs- und Sprachprobleme selbst weisen auf Störungen des Zentralnervensystems hin.
Zahlreiche Einflüsse vor, während und nach der Geburt können Hirnschädigungen verursachen.
Pränatale Einflüsse:
Atemstörungen, Sauerstoffmangel, zu geringer Blutzuckerspiegel während der Geburt können Hirnschädigungen hervorrufen
Postnatale Einflüsse:
Die Pockenimpfung oder auch mangelnde Sauerstoff- bzw. Nährstoffzufuhr zum Gehirn bei schweren Ernährungsstörungen im Säuglingsalter können offenbar Ursachen der Entstehung des autistischen Syndroms sein.
Da es jedoch keine einheitliche Ursache für das Auftreten von Autismus gibt, ist die Generalisierung einer einzigen Theorie sicher unzulässig.
4. Früherkennung
Frühkindlicher Autismus ist das Ergebnis einer sich allmählich entwickelnden Entfremdung zwischen dem Kind und den Menschen seiner Umgebung.
Die Aussichten auf Wiederherstellung sind daher umso besser, je eher diese Entfremdung erkannt und therapiert wird.
Leider wird jedoch gerade der frühkindliche Autismus meist erst spät diagnostiziert.
Kinder, bei denen der Verdacht auf Autismus besteht, sollten von ihren Eltern besonders aufmerksam beobachtet werden.
In der Praxis der Früherkennung und Diagnose haben sich immer mehr sogenannte Merkmallisten durchgesetzt.
Keinesfalls treffen jedoch alle diese Merkmale auf ein autistisches Kind zu, da sich die einzelnen Merkmale teilweise sogar gegenseitig ausschließen.
Einige dieser Merkmale sind:
- Vermeidung von Körperkontakt
- Zurückhaltung anderen gegenüber
- spricht nicht, sondern drückt Wünsche non-verbal aus
- Vermeidung von Blickkontakten
- spielt nicht mit anderen
- auffallende Hyperaktivität
- keine Angst vor realen Gefahren
- Lachen ohne ersichtlichen Grund
- wirkt wie taub
- spielt ununterbrochen absonderliche Spiele
- Ablehnung von Nahrung
- Fixierung auf Gegenstände
- Drehen von Gegenständen
- Widerstand gegen Belehrungen
5. Therapie
Eine eingehende und v.a. spezifische Beobachtung sollte Voraussetzung einer jeden Förderung sein.
,,Spezifisch" bedeutet eine genaue Überprüfung der Wahrnehmungsleistungen sowie der speziellen Fähigkeiten des Kindes.
Therapie bedeutet alle Maßnahmen psychosozialer, pädagogischer oder medizinischer Art.
Grundlage der Entscheidung für eine besondere Behandlungsform muß die Berücksichtigung der inneren Welt des Kindes, seiner speziellen Behinderung und seiner äußeren Umwelt einschließlich der Menschen in ihr Und seiner besonderen Bedürfnisse sein (synthetischer Ansatz).
Eine einzig hilfreiche Therapie des Autismus gibt es nicht.
Es genügt nicht bloß eine Methode zur Besserung der Symptomatik. Vielmehr muß versucht werden, das betroffene Kind mit über die Psyche wirkenden bzw. den Körper beeinflussenden Mitteln zu behandeln.
Wichtig ist die Erstellung eines gut durchdachten Bahandlungsplanes. Im Zuge der Autismus-Therapie gibt es Ziele, aber auch Hindernisse: Ziele:
- Kontakt zu Gleichaltrigen
- Aufgabe der Isolation
- Gruppenfähigkeit (Schule)
- Selbständigkeit usw.
Hindernisse (für normales Verhalten):
- Unruhe
- Stereotypien
- Aggression usw.
Diese und andere Hindernisse sind abzubauen.
Daneben ist es wichtig, sogenannte Verhaltenslücken im Zuge der Therapie aufzubauen:
- Rückzug, Isolation
- mangelnder Kontakt zu Mitmenschen
- Apathie, Antriebslosigkeit
- Mängel in der Sprache bzw. Selbständigkeit
5.1 Lerntheoretisch begründete Verfahren
Das autistische Kind soll lernen, mit seinen vorhandenen geistig-seelischen Kapazitäten die Umwelt zu verstehen und das Leben zu bewältigen.
Der beste Weg zum Aufbau einfacher Verhaltensweisen (Blickkontakt) besteht in der Anwendung des operanten Konditionierens, d.h. der Vergabe von individuell ausgesuchten Verstärkern (materiell oder sozial) oder im Entzug sozialer Verstärker.
Dazu gehört das Üben von sellbständigem An- und Ausziehen, die Benützung der Toilette, selbständiges Essen usw.
5.2 Basistherapie
Dazu zählen v.a. Theorien zur Aktivierung der Körperwahrnehmung.
Die Entwicklung des Körpergefühls und der Wahrnehmung des eigenen Körpers spielt sich als Vorstufe zur Wahrnehmung der äußeren Umwelt ab.
5.3 Festhaltetherapie
Hier wird von der Annahme ausgegangen, dass die Bindungen zwischen Mutter und Kind gestört waren.
Das Kind wird - oft stundenlang - festgehalten und eng an deren Körper gedrückt, bis es den Widerstand gegen diese als Liebkosung gemeinte Fixierung aufgibt und sich beruhigt. Dabei soll das Kind die Erfahrung machen, dass der Körperkontakt mit der Mutter angenehm ist.
5.4 Musiktherapie
Klänge wecken das Interesse autistischer Kinder. Sie interessieren sich für die Person, die sie hervorbringt und vielleicht auch für das Instrument.
Ziel wäre, dass das Kind sich selbst produziert, mitspielt oder gar mitsingt.
5.5 Physikalische Therapie
Dazu zählen Methoden wie Krankengymnastik und andere.
Es ist ein meist langer, mühevoller Weg, dem Kind beizubringen, seinen aktiven und passiven Bewegungsapparat sinnvoll einzusetzen.
Gerade Methoden der Krankengymnastik lassen sich sehr gut mit Musik kombinieren.
5.6 Medikamentöse Therapie
Die verwendeten Medikamente wirken psychogen auf das Zentralnervensystem. Therapeut ist hier ausschließlich der Mediziner.
5.7 Neurotransmitter-Therapie
Dabei wurde Fenfluramin eingesetzt, ein Stoff, der den Serotoninspiegel im Körper (Blut, Gehirn) um ca. 60% senkt.
Daraufhin kam es zu einer Besserung des Aktivitätsgrades, der Aufmerksamkeit sowie der motorischen Störungen.
5.8 Außenseitermethoden
Hier sind Behandlungsarten gemeint, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte angewandt wurden, obwohl meist deren theoretische Begründung fehlt.
Dazu zählen u.a. die Vitamintherapie, die Dunkelzimmertherapie sowie die Therapie mit Tieren (v.a. Pferde und Delphine), wobei gerade bei der letztgenannten Form große Erfolge erzielt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Autismus laut diesem Text?
Autismus wird als eine psychische Störung mit krankhafter Ichbezogenheit, Apathie, Verlust des Umweltkontakts und Flucht in eine eigene Fantasiewelt beschrieben. Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort "autos" (selbst) ab.
Wie häufig tritt Autismus auf?
Nach internationalen Untersuchungen sind 4-6 von 10.000 Kindern betroffen. In Österreich bedeutet das, dass bei ca. 40 Kindern eines Geburtsjahrganges ein Fall von Autismus auftritt. Unter Berücksichtigung der Dunkelziffer könnte die tatsächliche Zahl höher liegen.
Welche Symptome zeigen sich im Säuglingsalter?
Säuglinge mit Autismus reagieren oft nur geringfügig auf ihre Umwelt, sind nicht anschmiegsam, strecken nicht die Arme aus, wenn sie hochgenommen werden wollen, schreien viel oder sind auffallend ruhig und zeigen wenig Interesse an ihrer Umgebung. Sie können von Lichtern fasziniert sein.
Welche Symptome sind im Alter von zwei bis fünf Jahren typisch?
In dieser Altersgruppe sind die Symptome oft am auffälligsten. Dazu gehören ungewöhnliche Reaktionen auf Geräusche (scheinbare Taubheit), Sprachverständnisprobleme, Sprachabnormitäten (Echolalie, falsche Wortreihenfolge), Probleme der visuellen Wahrnehmung (vermiedener Blickkontakt, Faszination für bewegte Objekte) und Besonderheiten im Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn. Motorisch können Unvollkommenheiten in den Bewegungen auftreten (Zehenspitzengang, Schaukelbewegungen).
Was ist Echolalie?
Echolalie ist eine Sprachabnormität, bei der das Kind das letzte Wort oder die letzten Worte eines Satzes wiederholt. Dies kann sofort oder verzögert geschehen (verzögerte Echolalie).
Wie verändert sich das Verhalten nach dem fünften Lebensjahr?
Im Allgemeinen tritt zwischen dem fünften und siebenten Lebensjahr eine Besserung ein. Die Kinder werden zärtlicher und geselliger, sträuben sich weniger gegen Veränderungen, haben weniger unbegründete Ängste und werden sich realen Gefahren bewusster. Sprachprobleme und Bewegungsschwierigkeiten können ebenfalls zurückgehen.
Gibt es besondere Fertigkeiten bei Autisten?
Einige Autisten verfügen über besondere Fertigkeiten, z.B. Liebe zur Musik, schnelles Addieren von Zahlenreihen im Kopf, Aufsagen langer Gedichte, Einprägen von Details von Fahrplänen oder ein überdurchschnittliches Orientierungsvermögen. Sie sind oft in nicht-sprachlichen Fertigkeiten überlegen.
Was sind die Ursachen für Autismus?
Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über die Ursachen. Es gibt verschiedene Theorien, die sowohl psychosoziale als auch hirnorganische Ursachen in Betracht ziehen. Medizinische Forschungen haben gezeigt, dass es verschiedene Einflüsse gibt, die das Erscheinungsbild des Autismus hervorrufen können.
Welche Verursachungstheorien des Autismus werden im Text genannt?
Genannt werden: Psychogenetische Theorien (Persönlichkeitsstörung der Mutter), Genetische Verursachungstheorien (Erbkomponente), Biomechanische Störungen (Störungen im Haushalt der Neurotransmitter wie Serotonin und Endorphine) und Organische Theorien (Hirnschädigungen).
Wie kann Autismus frühzeitig erkannt werden?
Eine aufmerksame Beobachtung des Kindes ist wichtig. Es gibt Merkmallisten zur Früherkennung, wobei nicht alle Merkmale auf ein autistisches Kind zutreffen müssen. Beispiele sind: Vermeidung von Körperkontakt, Zurückhaltung anderen gegenüber, nonverbale Kommunikation von Wünschen, Vermeidung von Blickkontakten, kein Spielen mit anderen, Hyperaktivität, keine Angst vor realen Gefahren, Lachen ohne ersichtlichen Grund, scheinbare Taubheit, absonderliche Spiele, Ablehnung von Nahrung, Fixierung auf Gegenstände, Drehen von Gegenständen, Widerstand gegen Belehrungen.
Welche Therapieansätze gibt es?
Es gibt keine "eine" hilfreiche Therapie. Ein spezifischer Behandlungsplan muss auf die innere Welt des Kindes, seine Behinderung, seine Umwelt und seine Bedürfnisse zugeschnitten sein. Genannt werden: Lerntheoretisch begründete Verfahren (operantes Konditionieren), Basistherapie (Aktivierung der Körperwahrnehmung), Festhaltetherapie, Musiktherapie, Physikalische Therapie (Krankengymnastik), Medikamentöse Therapie, Neurotransmitter-Therapie und Außenseitermethoden (Vitamintherapie, Dunkelzimmertherapie, Therapie mit Tieren).
Was ist das Ziel der Therapie?
Ziele sind u.a. Kontakt zu Gleichaltrigen, Aufgabe der Isolation, Gruppenfähigkeit (Schule), Selbständigkeit. Hindernisse wie Unruhe, Stereotypien und Aggression sollen abgebaut werden. Verhaltenslücken (Rückzug, mangelnder Kontakt, Apathie, Mängel in der Sprache bzw. Selbständigkeit) sollen im Zuge der Therapie geschlossen werden.
- Quote paper
- Herbert Schober (Author), 2001, Autismus. Ursachen, Symptome und Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99336