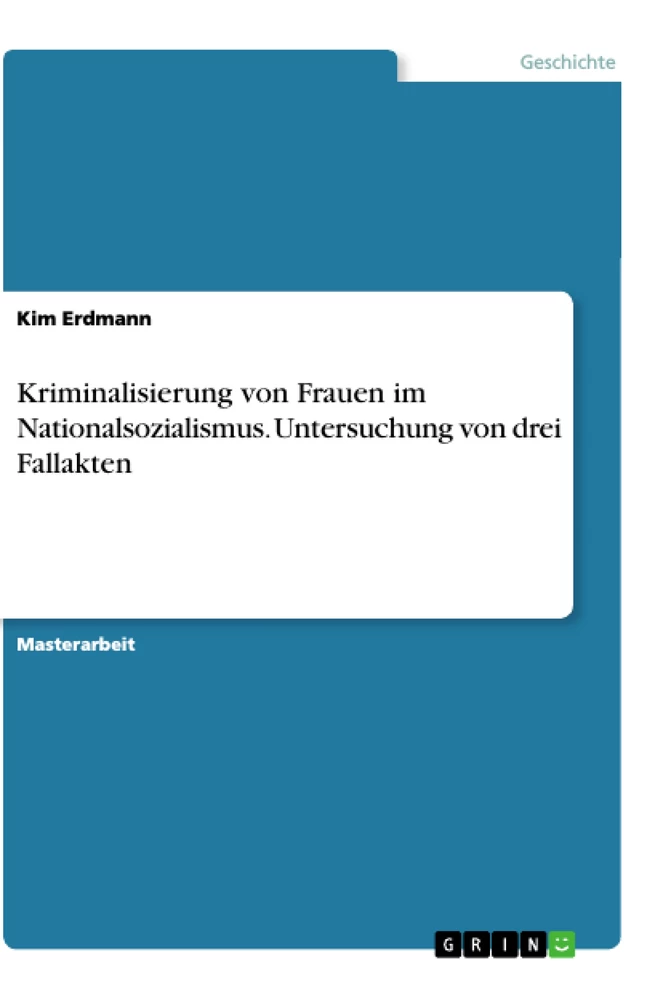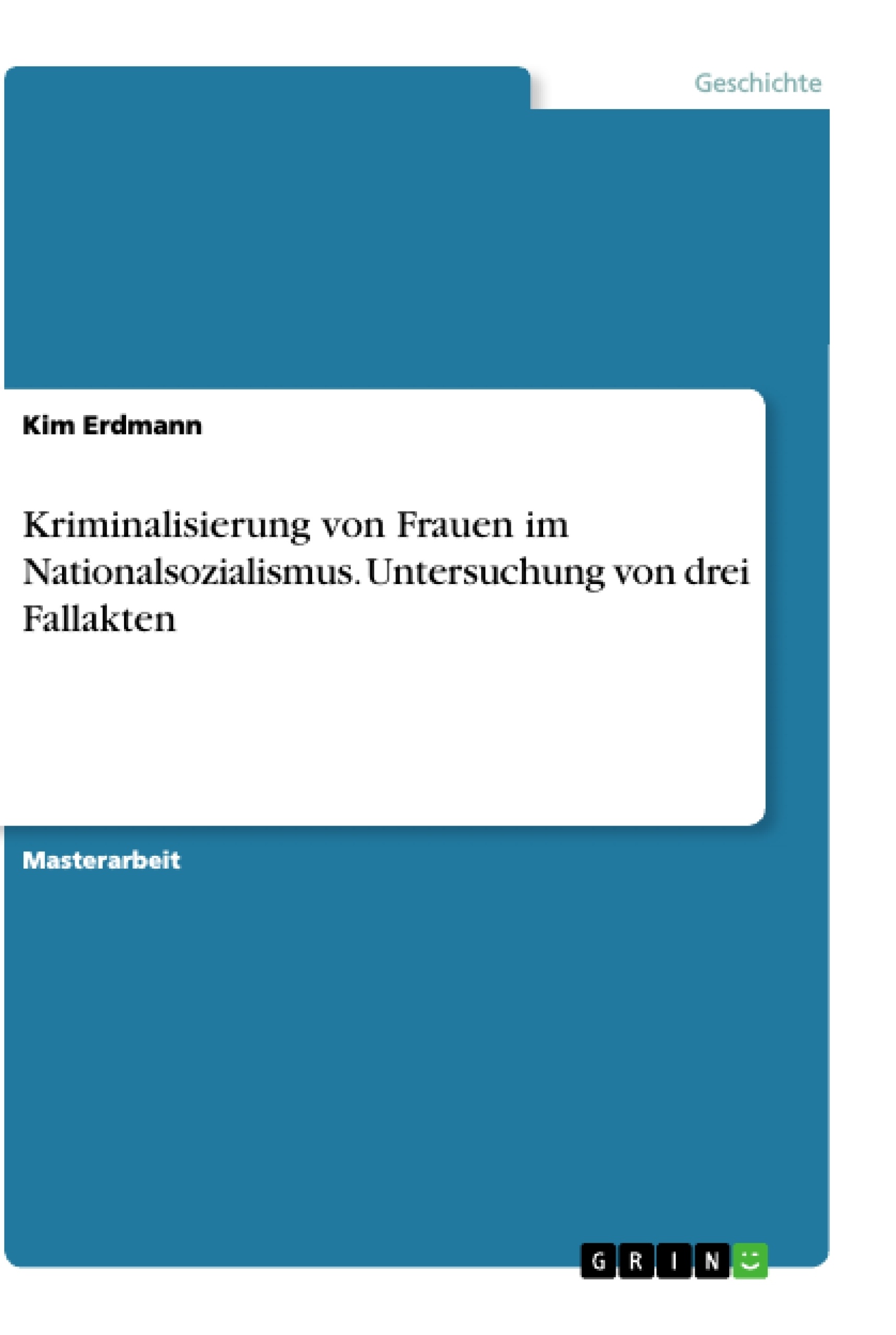Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit drei Duisburger Fallakten von sogenannten “asozialen” Frauen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob diese Frauen willkürlich inhaftiert wurden und ob diese drei ausgewählten Fallakten repräsentativ für das Schicksal weiterer „asoziale“ Frauen betrachtet werden können.
Die Nationalsozialisten prägten eine Gesellschaft, in der „Außenseiter“ keinen Platz hatten. Dabei reichten oft schon kleine Fehltritte aus, um als „asozial“ bezeichnet zu werden. Letztlich war das einzige Ziel der Nationalsozialisten, die Vernichtung von angeblich unangepasst Lebenden.
Bis heute werden die „Asozialen“ als Opfergruppe in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus wenig beachtet. Der Forschungsfokus liegt auch in der heutigen Forschung immer noch auf dem Holocaust und den Konzentrationslagern.
Frauen, die als „asozial“ eingestuft wurden, folgten einem „stereotypen Vorurteilsmuster. Sie hatten selten die Möglichkeit, der Justiz und der polizeilichen Vorbeugungshaft wieder zu entkommen. In den ausgesuchten Fallstudien konnte keine der drei Frauen der Haft entgehen, noch gab es Einspruch durch z. B. Familienangehörige oder die Betroffenen selbst.
Einfache „Fehltritte“ reichten häufig schon aus, um als „asozial“ eingestuft zu werden. So galten Geschlechtskrankheiten schon als Anzeichen für die Gefährdung der Volksgesundheit. Für eine Inhaftierung waren also der „Charakter oder zur Anlage erklärten Normabweichung“ entscheidend. Im Nationalsozialismus wurden bestimmte Charaktereigenschaften auf die Genetik zurückgeführt und erklärt, dass die „Asozialität“ veranlagt war. In den kriminellen Lebensläufen der Frauen wird also zum einen mit Stereotypen und zum anderen mit der „erblichen Anlage“ argumentiert.
Die „unkontrollierte“ Frau passte nicht in die Volksgemeinschaft des Nationalsozialismus. Frauen, die vom „Bild des rassisch, sozial und politisch konformen Bürger abwichen“, wurden in polizeiliche Vorbeugungshaft genommen. Die anschließende Inhaftierung der Frauen endete meistens mit einem Weitertransport in ein Arbeits- oder Konzentrationslager.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
- 1.2 FORSCHUNGSSTAND
- 1.3 BEGRIFFLICHKEITEN UND ERLÄUTERUNGEN
- 2. MABNAHMEN GEGEN „ASOZIALE“
- 2.1 GESETZE, VERORDNUNGEN UND ERLASSE
- 2.2 POLIZEILICHE VORBEUGUNGSHAFT UND PLANMÄẞIGE ÜBERWACHUNG
- 2.3 KRIMINOLOGIE UND NATIONALSOZIALISTISCHE RASSENHYGIENE
- 2.4 DEPORTATION IN ARBEITS- UND KONZENTRATIONSLAGER
- 3. STEREOTYPEN VON FRAUEN UND KRIMINALISIERUNG
- 3.1 PROSTITUTION UND DER VERDACHT AUF „GEWERBLICHE UNZUCHT“
- 3.2 BERUFS- UND GEWOHNHEITSVERBRECHER
- 3.3 FRAUEN AUS FÜRSORGEEINRICHTUNGEN
- 3.4 VORURTEILSMUSTER
- 4. DAS POLIZEIPRÄSIDIUM DUISBURG UND SEINE FÄLLE
- 4.1 DER AKTENBESTAND BR 1111
- 4.1.1 Frau Karla G.
- 4.1.2 Frau Anna F.
- 4.1.3 Frau Lisa M.
- 4.1.4 Fallaktenanalyse und Auswertung
- 4.1 DER AKTENBESTAND BR 1111
- 5. RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung sogenannter „Asozialer“ Frauen im Nationalsozialismus, anhand der Überlieferung des Polizeipräsidiums Duisburg. Ziel ist es, die Verfolgung dieser Frauen im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und Praxis zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Verfolgung, die Rolle der Polizei, die Stereotype, die gegen „Asoziale“ Frauen konstruiert wurden, und die konkreten Lebensgeschichten von Frauen, die aufgrund ihrer vermeintlichen „Asozialität“ verfolgt wurden.
- Die rechtlichen Grundlagen der Verfolgung von „Asozialen“ im Nationalsozialismus
- Die Rolle der Polizei bei der Identifizierung, Verfolgung und Inhaftierung von „Asozialen“ Frauen
- Die Konstruktion von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber „Asozialen“ Frauen
- Die konkreten Lebensgeschichten von Frauen, die aufgrund ihrer vermeintlichen „Asozialität“ verfolgt wurden
- Die Auswirkungen der Verfolgung auf die Lebensverhältnisse der betroffenen Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit sowie den Forschungsstand. Sie geht außerdem auf wichtige Begrifflichkeiten und Erläuterungen ein.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Maßnahmen gegen „Asoziale“ im Nationalsozialismus. Es analysiert die relevanten Gesetze, Verordnungen und Erlasse, die polizeiliche Vorbeugungshaft und die planmäßige Überwachung, die Rolle der Kriminalistik und Rassenhygiene sowie die Deportation in Arbeits- und Konzentrationslager.
Kapitel drei beschäftigt sich mit Stereotypen von Frauen und ihrer Kriminalisierung. Es untersucht die Konstruktion von Vorurteilen gegenüber Prostituierten, Berufs- und Gewohnheitsverbrecherinnen sowie Frauen aus Fürsorgeeinrichtungen. Die Analyse zeigt die Rolle von Vorurteilen und Stereotypen bei der Kriminalisierung von Frauen im Nationalsozialismus.
Kapitel vier analysiert anhand von Fallbeispielen aus den Akten des Polizeipräsidiums Duisburg die Verfolgung von „Asozialen“ Frauen. Die Arbeit beleuchtet die Lebensgeschichten von drei Frauen, die aufgrund ihrer vermeintlichen „Asozialität“ verfolgt wurden, und analysiert die Fallakten anhand der Kriterien der Nationalsozialistischen Rassenhygiene und der Kriminalistik.
Die Arbeit endet mit einem Resümee, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und die Relevanz der Forschung für das Verständnis der nationalsozialistischen Verfolgung von Frauen herausstreicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „Asoziale“ Frauen im Nationalsozialismus, Polizeipräsidium Duisburg, Verfolgung, Stereotype, Kriminalisierung, Rassenhygiene, Vorbeugungshaft, Arbeitslager, Konzentrationslager, Lebensgeschichten, Fallaktenanalyse.
- Quote paper
- Kim Erdmann (Author), 2020, Kriminalisierung von Frauen im Nationalsozialismus. Untersuchung von drei Fallakten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/993242