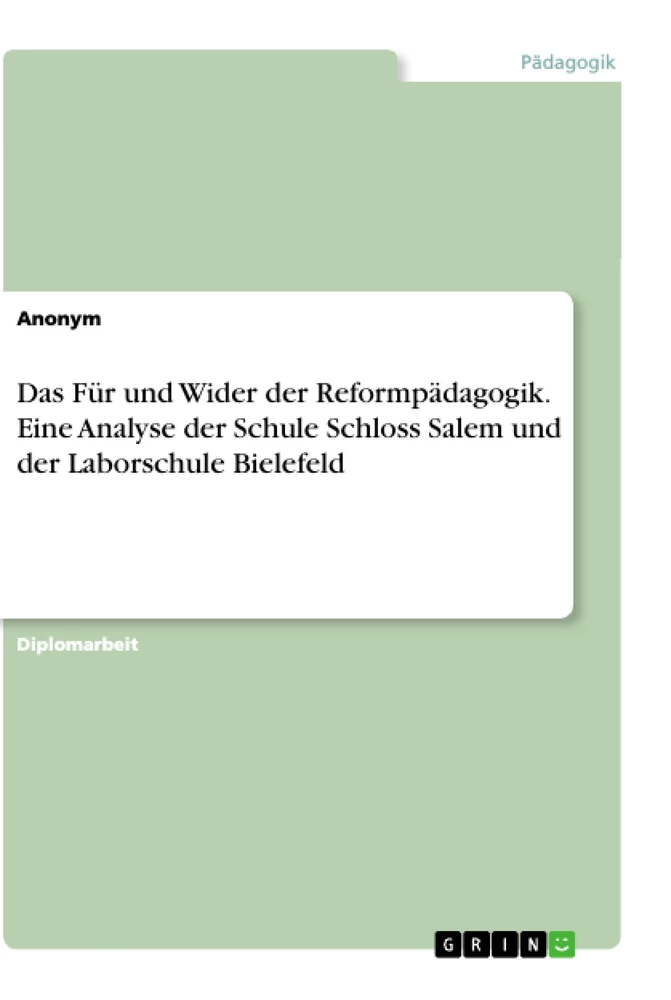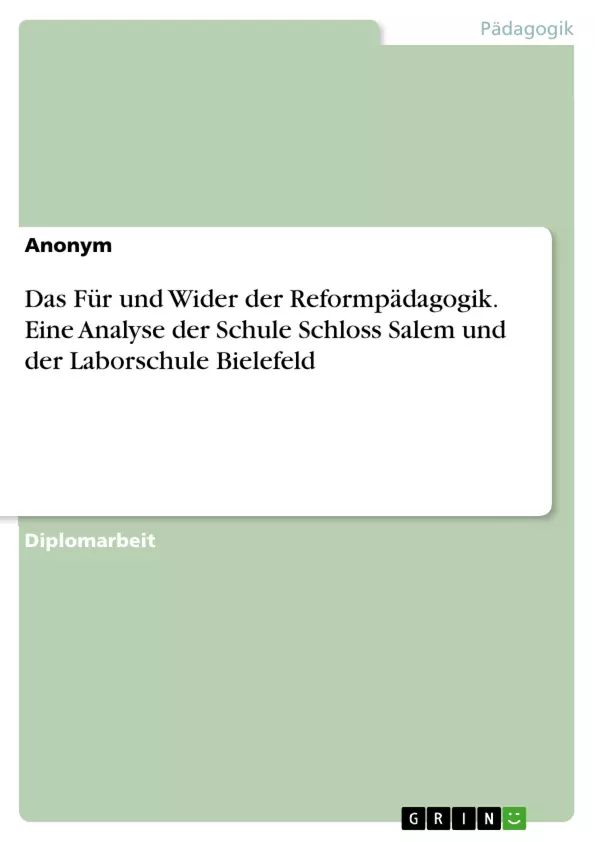Im Rahmen dieser Arbeit setzt sich die Autorin mit reformpädagogischen Schulen genauer auseinander. Sie geht der Frage nach dem Für und dem Wider der Reformpädagogik nach. Da es eine Vielzahl reformpädagogischer Konzepte gibt, werden in dieser Arbeit die Schwerpunkte auf die Schule Schloss Salem, welche eine ältere reformpädagogische Schule ist, und auf die Laborschule Bielefeld, eine neuere reformpädagogische Schule, die aus der 68er-Bewegung hervorging, gelegt.
Ziel soll es sein aufzuzeigen, wie und aus welchen Situationen und Bedingungen heraus sich die reformpädagogische Bewegung entwickelt hat, welche Strömungen und Vertreter es gab, wie sich die beiden ausgewählten Beispielschulen von ihrer Gründung bis heute entwickelt haben, welche Besonderheiten sowie kritische Aspekte zu erkennen sind, welchen Stellenwert sie in der jetzigen Zeit besitzen und wie die mögliche Entwicklung in Zukunft der ausgewählten reformpädagogischen Schulkonzepte aussehen könnte.
"Reformpädagogik" ist ein unscharfer Begriff. Unterschiedliche Zugänge, Auffassungen und Definitionen der Wissenschaftler machen es schwer, eine einheitliche allgemeingültige Definition zu formulieren. Anhand ausgewählter Auffassungen und Phaseneinteilungen verschiedener Pädagogen soll zunächst versucht werden, eine Eingrenzung und eine Definition zu schaffen, wie der Terminus Reformpädagogik in dieser Arbeit zu verstehen ist. In einer historischen Betrachtung werden die Beweggründe zur Entstehung der Reformpädagogik sowie die Entwicklung der verschiedenen Strömungen mit ihren Vertretern herauskristallisiert. Beginnend mit Vorläufern der Reformpädagogik, zum Beispiel Johann Amos Comenius (1592-1670), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) und Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) wird die Entwicklung im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und in der Zeit nach 1945 bis heute dargestellt. Zu beachten ist, dass zwischen 1945 und 1989 Ost- und Westdeutschland getrennt untersucht werden müssen. Abschließen soll dieses Kapitel eine kurze internationale Betrachtung der reformpädagogischen Bewegung mit deren Vertretern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reformpädagogik 1890-1933
- Unterschiedliche Auffassungen
- Versuch einer Definition der Reformpädagogik
- Phasen nach Willy Potthoff
- Historische Einordnung
- Pioniere der Reformpädagogik
- Situation im Kaiserreich 1871-1918
- Weimarer Republik 1918-1933
- Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945
- Entwicklung nach 1945
- Ostdeutschland
- Westdeutschland
- Vereinigtes Deutschland
- Internationale Betrachtung
- Landerziehungsheimbewegung
- Schule Schloss Salem
- Kurt Hahn
- Geschichte der Schule Schloss Salem
- Organisation der Schule
- Aktuelle Zahlen
- Mitarbeiter
- Elternschaft
- Bildungs- und Erziehungskonzept der Schule
- Standorte
- Das Leben an der Schule - Ein Tag auf Schloss Salem
- Bernhard Bueb
- Pädagogische Ansichten und Grundsätze
- Reaktion der Fachwissenschaftler
- Das aktuelle Leitungsgremium
- Schule Schloss Salem
- Bielefelder Laborschule
- Hartmut von Hentig und ausgewählte Bildungsvorstellungen
- Organisation der Laborschule
- Pädagogische Konzeption und seine Besonderheiten
- Grundsätze
- Jahrgangsstufen
- Beurteilungssystem
- Personal
- Schulgebäude und Schulgelände
- Elternschaft und Elternrat
- Schülerschaft
- Entwicklung der Laborschule bis heute – aktuelle Zahlen
- Oberstufen-Kolleg
- Pro und Kontra der Reformpädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Vor- und Nachteile der Reformpädagogik anhand der Fallstudien der Schule Schloss Salem und der Laborschule Bielefeld. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Reformpädagogik zu zeichnen und deren Relevanz für die heutige Zeit zu beleuchten.
- Historische Entwicklung der Reformpädagogik
- Vergleichende Analyse der Schule Schloss Salem und der Laborschule Bielefeld
- Pädagogische Konzepte und Prinzipien der Reformpädagogik
- Bewertung der Vor- und Nachteile der Reformpädagogik
- Relevanz der Reformpädagogik für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung der Reformpädagogik und die Auswahl der beiden Fallstudien, Schule Schloss Salem und Laborschule Bielefeld, zur Analyse der Vor- und Nachteile dieses pädagogischen Ansatzes. Die Einleitung legt den Fokus auf die methodische Herangehensweise und die erwarteten Ergebnisse der Arbeit.
Reformpädagogik 1890-1933: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Reformpädagogik in der Zeit von 1890 bis 1933. Es beleuchtet unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Bewegung, versucht eine umfassende Definition der Reformpädagogik zu formulieren und gliedert die Entwicklung in Phasen nach Willy Potthoff. Der Fokus liegt auf den zentralen Ideen und Konzepten der Reformpädagogik sowie den verschiedenen Strömungen und Persönlichkeiten, die diese Bewegung prägten. Der Abschnitt thematisiert die Herausforderungen und den Einfluss des gesellschaftlichen Umfeldes auf die Entwicklung der Reformpädagogik dieser Epoche.
Historische Einordnung: Dieses Kapitel ordnet die Reformpädagogik in ihren historischen Kontext ein. Es beleuchtet die Rolle der Pioniere der Reformpädagogik, die Situation im Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und die Entwicklung nach 1945 in Ost- und Westdeutschland sowie im vereinigten Deutschland. Der Abschnitt analysiert den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf die Entwicklung und Verbreitung reformpädagogischer Ideen, wobei internationale Entwicklungen mit einbezogen werden. Es wird die Kontinuität und der Wandel reformpädagogischer Prinzipien im Laufe der Geschichte betrachtet.
Landerziehungsheimbewegung: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Landerziehungsheimbewegung, insbesondere mit der Schule Schloss Salem und der Arbeit von Kurt Hahn. Es analysiert die Geschichte der Schule, ihre Organisation, ihr Bildungs- und Erziehungskonzept, sowie das tägliche Leben der Schüler. Der Beitrag von Bernhard Bueb und dessen pädagogische Ansichten werden ebenfalls eingehend untersucht, ebenso die Reaktion der Fachwissenschaftler auf seine Arbeit. Schließlich wird das aktuelle Leitungsgremium vorgestellt.
Bielefelder Laborschule: Das Kapitel widmet sich der Bielefelder Laborschule, den pädagogischen Vorstellungen von Hartmut von Hentig und der Organisation der Schule. Die pädagogische Konzeption mit ihren Grundsätzen, Jahrgangsstufen und dem Beurteilungssystem wird im Detail beschrieben. Der Abschnitt beleuchtet die Aspekte Personal, Schulgebäude, Elternschaft, Schülerschaft, die Entwicklung der Schule bis heute, und das Oberstufen-Kolleg. Es wird ein umfassendes Bild der Struktur und des pädagogischen Ansatzes der Schule vermittelt.
Schlüsselwörter
Reformpädagogik, Schule Schloss Salem, Laborschule Bielefeld, Kurt Hahn, Hartmut von Hentig, Landerziehungsheimbewegung, pädagogische Konzepte, Bildung, Erziehung, historische Entwicklung, Vor- und Nachteile.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Reformpädagogik - Schule Schloss Salem und Laborschule Bielefeld
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Vor- und Nachteile der Reformpädagogik anhand von zwei Fallstudien: der Schule Schloss Salem und der Laborschule Bielefeld. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Reformpädagogik zu zeichnen und ihre Relevanz für die heutige Zeit zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Reformpädagogik, einen Vergleich der Schule Schloss Salem und der Laborschule Bielefeld, die pädagogischen Konzepte und Prinzipien der Reformpädagogik, eine Bewertung der Vor- und Nachteile sowie die Relevanz für die Gegenwart. Die Arbeit umfasst auch eine detaillierte Betrachtung der Landerziehungsheimbewegung.
Welche Schulen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Schule Schloss Salem, inklusive der Person Kurt Hahn, ihrer Geschichte, Organisation, ihres Bildungskonzepts und des täglichen Schullebens. Ebenso wird die Bielefelder Laborschule mit den pädagogischen Vorstellungen Hartmut von Hentigs, ihrer Organisation, ihrem pädagogischen Konzept und ihrer aktuellen Situation analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Reformpädagogik (1890-1933), zur historischen Einordnung, zur Landerziehungsheimbewegung (mit Fokus auf Schule Schloss Salem und Bernhard Bueb), zur Bielefelder Laborschule, und schließlich eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der Reformpädagogik. Die Kapitel enthalten jeweils umfassende Beschreibungen und Analysen der jeweiligen Themen.
Welche methodische Herangehensweise wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der Schule Schloss Salem und der Laborschule Bielefeld, um die Vor- und Nachteile der Reformpädagogik zu beleuchten. Die Einleitung skizziert die methodische Herangehensweise und die erwarteten Ergebnisse der Arbeit detaillierter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Reformpädagogik, Schule Schloss Salem, Laborschule Bielefeld, Kurt Hahn, Hartmut von Hentig, Landerziehungsheimbewegung, pädagogische Konzepte, Bildung, Erziehung, historische Entwicklung, Vor- und Nachteile.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kurzfassung)?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Reformpädagogik zu liefern und deren Relevanz für die Gegenwart zu bewerten, indem sie die Stärken und Schwächen anhand der Fallstudien Schule Schloss Salem und Laborschule Bielefeld aufzeigt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Das Für und Wider der Reformpädagogik. Eine Analyse der Schule Schloss Salem und der Laborschule Bielefeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992977