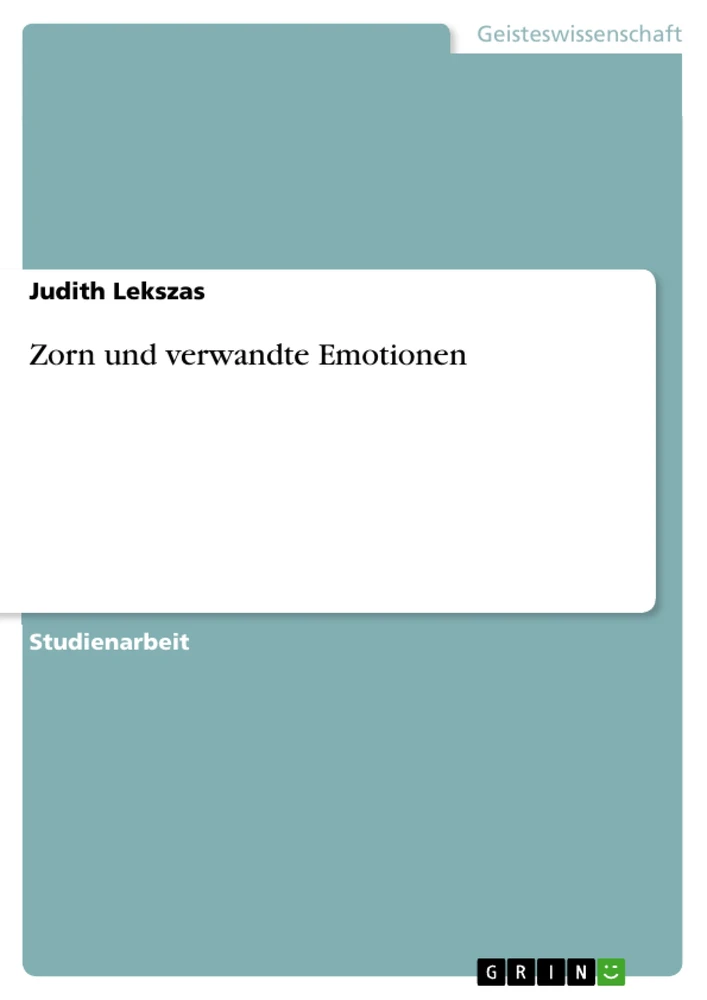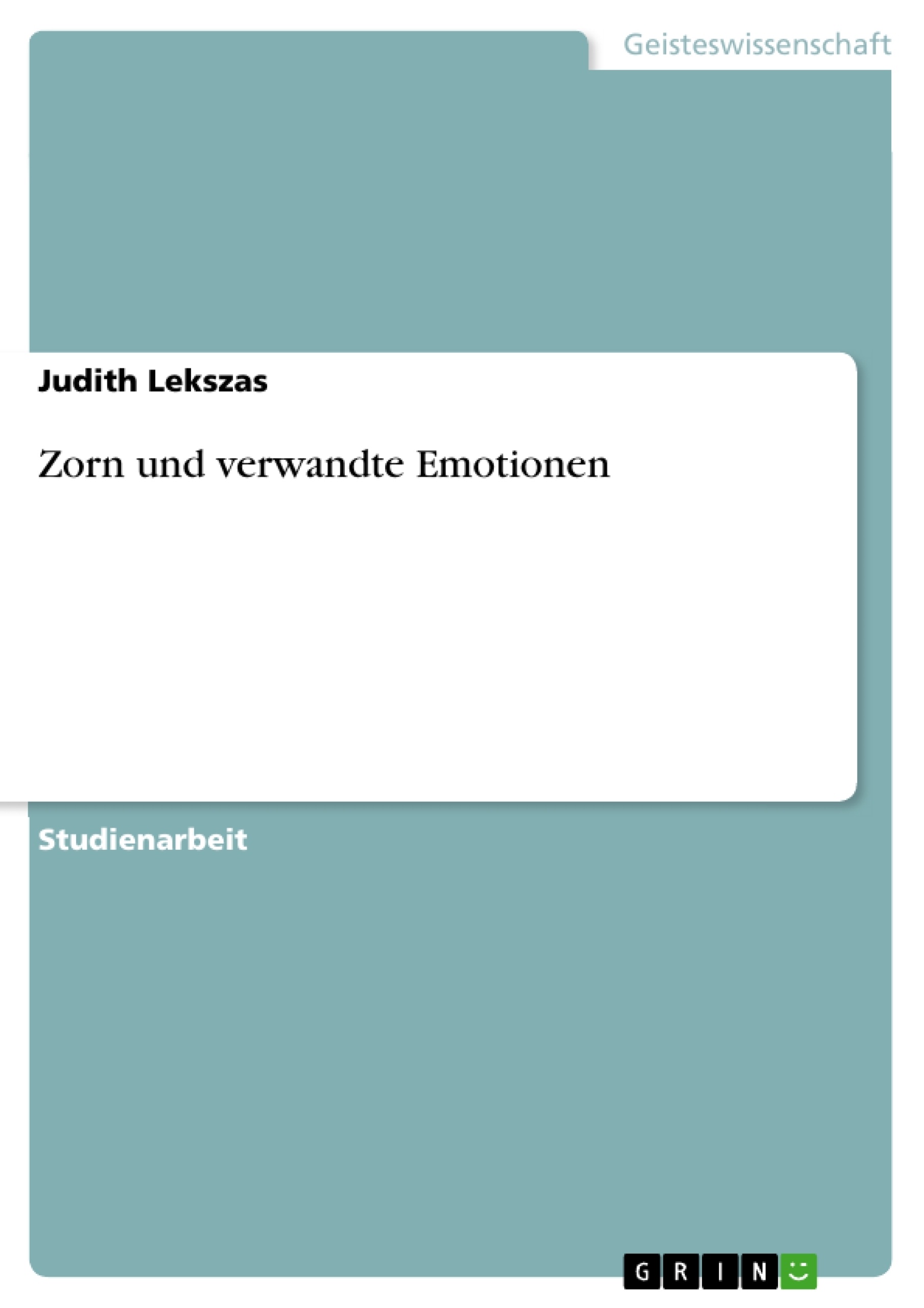Zorn ist eine fundamentale Emotion, die in allen Kulturkreisen bekannt ist; ebenso verändert sich die Mimik fast in allen Kulturen gleich. Im Alltag tritt Zorn häufig mit den Emotionen Ekel und Geringschätzung zusammen auf. Wird eine dieser Emotion empfunden, löst sie gleichzeitig auch entweder die eine, die andere, oder beide Emotionen gleichzeitig aus.
Es handelt sich nicht unbedingt um eine universelle Ursache, doch ist ein häufiger Stimulus für Zorn "das Gefühl, entweder körperlich oder psychisch an etwas gehindert zu werden, das man intensiv zu tun wünscht. Bei der Behinderung kann es sich um psychologische Hindernisse, Regeln und Vorschriften oder eigene Unfähigkeit handeln." Zorn tritt weniger dann auf, wenn die Einschränkungen versteckt sind, aber fast immer mit Sicherheit dann, wenn sie ein höchst wünschens- wertes Ziel behindern. Ist das Zornniveau noch niedrig, kann er leicht für lange Zeit unterdrückt werden, allerdings kann dies zu gesundheitlichen Schäden oder zu einem Wutausbruch führen.
Weitere Ursachen für das Auftreten von Zorn sind zum Beispiel persönliche Beleidigung, Alltagsfrustrationen, Unterbrechung von Interesse und Freude, Übervorteiltwerden, Zwang, etwas gegen seinen Willen zu tun. Es ist durchaus möglich, dass einige dieser Dinge auch andere Emotionen hervorrufen. Somit gibt es also nicht viele Stimuli, die nur Zorn auslösen.
Für die Auslöser gibt es, im Gegensatz zur Emotion an sich, kulturelle Unterschiede. Diese Unterschiede sind meist persönlicher Natur und basieren auf kulturellen Konditionierungen und Lernprozessen.
Tomkins erklärt das Auftreten von Zorn mit Hilfe einer sogenannten Dichteniveauemotion, welche besagt, dass nach einer mäßig hohen und gleichbleibenden neuralen Stimulierung Zorn auftritt. Ein Beispiel wäre hier der Kummer, der ebenfalls durch ein gleichbleibendes - allerdings niedriges - Niveau ausgelöst wird und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht, Zorn auszulösen. Steigt das Niveau der Stimulierung bei Kummer, kann diese Dichte von neuralen Impulsen Zorn bewirken.
Kummer kann unter gewissen Umständen aber auch die Intensität von Zorn dämpfen. Führt der Zorn zu Aggression, so könnte Kummer als Basis der Einfühlung in das Opfer dienen, also eine Art Sicherheitsventil, dem Gegenüber keinen Schaden zuzufügen, sei er nun psychischer oder physischer Art.
Inhaltsverzeichnis
Entstehung von Zorn, Ursachen und Auslösung
Aussehen bei Zorn (angeborene Komponenten)
Empfindungen bei Zorn
Bedeutung von Zorn
Verwandte Emotionen
Ekel
Entstehung von Ekel
Empfindungen bei Ekel
Bedeutung von Ekel
Geringschätzung / Verachtung
Entstehung von Geringschätzung / Verachtung
Empfindungen bei Geringschätzung / Verachtung
Bedeutung von Geringschätzung / Verachtung
Zorn in Beziehung zu Feindseligkeit und Aggression
Interaktion von Zorn mit anderen Affekten und Kognitionen
Emotionsausdruck und Aggression
Wirkung der Wahrnehmung des Zornausbruchs
Wirkungen des Nichtäußerns von Zorn
Literaturverzeichnis
Anhang (Abb. 1 und 2, Testergebnisse)
ZORN
Zorn ist eine fundamentale Emotion, die in allen Kulturkreisen bekannt ist; ebenso verändert sich die Mimik fast in allen Kulturen gleich. Im Alltag tritt Zorn häufig mit den Emotionen Ekel und Geringschätzung zusammen auf. Wird eine dieser Emotion empfunden, löst sie gleichzeitig auch entweder die eine, die andere, oder beide Emo- tionen gleichzeitig aus.
Entstehung von Zorn, Ursachen und Auslösung
Es handelt sich nicht unbedingt um eine universelle Ursache, doch ist ein häufiger Stimulus für Zorn „das Gefühl, entweder körperlich oder psychisch an etwas gehin- dert zu werden, das man intensiv zu tun wünscht. Bei der Behinderung kann es sich um psychologische Hindernisse, Regeln und Vorschriften oder eigene Unfähigkeit handeln.“( Izard 1994,369 ) Zorn tritt weniger dann auf, wenn die Einschränkungen versteckt sind, aber fast immer mit Sicherheit dann, wenn sie ein höchst wünschens- wertes Ziel behindern. Ist das Zornniveau noch niedrig, kann er leicht für lange Zeit unterdrückt werden, allerdings kann dies zu gesundheitlichen Schäden oder zu ei- nem Wutausbruch führen.
Weitere Ursachen für das Auftreten von Zorn sind zum Beispiel persönliche Beleidigung, Alltagsfrustrationen, Unterbrechung von Interesse und Freude, Übervorteiltwerden, Zwang, etwas gegen seinen Willen zu tun. Es ist durchaus möglich, dass einige dieser Dinge auch andere Emotionen hervorrufen. Somit gibt es also nicht viele Stimuli, die nur Zorn auslösen.
Für die Auslöser gibt es, im Gegensatz zur Emotion an sich, kulturelle Unterschiede. Diese Unterschiede sind meist persönlicher Natur und basieren auf kulturellen Konditionierungen und Lernprozessen.
Tomkins erklärt das Auftreten von Zorn mit Hilfe einer sogenannten „Dichteniveauemotion, welche besagt, dass nach einer mäßig hohen und gleichbleibenden neuralen Stimulierung Zorn auftritt. Ein Beispiel wäre hier der Kummer, der ebenfalls durch ein gleichbleibendes - allerdings niedriges - Niveau ausgelöst wird und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht, Zorn auszulösen. Steigt das Niveau der Stimulierung bei Kummer, kann diese Dichte von neuralen Impulsen Zorn bewirken.
Kummer kann unter gewissen Umständen aber auch die Intensität von Zorn dämpfen. Führt der Zorn zu Aggression, so könnte Kummer als Basis der Einfühlung in das Opfer dienen, also eine Art Sicherheitsventil, dem Gegenüber keinen Schaden zuzufügen, sei er nun psychischer oder physischer Art.
Aussehen bei Zorn (angeborene Komponenten) Abb.1
- Die Stirnmuskeln sind nach innen und unten angespannt. Diese Stirnrunzeln be wirken ein drohendes Aussehen um die Augen herum, mit einem harten, starren Blick, der auf den Gegenstand des Zorns gerichtet ist.
- Die Nasenlöcher blähen sich auf, was eine Erweiterung der Nasenflügel zur Folge hat.
- Die Lippenöffnen sich rechteckig und die zusammengebissenen Zähne werden entblößt (Parallele zum Zähnefletschen der Tiere).
- Das Gesicht läuft rot an.
Mit der Zeit lernen Kinder, ihren Zorn zu unterdrücken, ihn zu kontrollieren und zu verbergen. (Abb.2: Junge)
Der individuelle Ausdruck beim zornentstellten Gesicht variiert stark, doch mindestens eine der angeborenen Komponenten ist immer wieder zu finden.
Empfindungen bei Zorn
Das Gesicht wird heiß und errötet, die Muskeln sind angespannt. Die Empfindung von Kraft, der Impuls zuzuschlagen und die Quelle des Zorns anzugreifen, sind starke Empfindungen, die bei Zorn auftreten. Man spürt eine innere Energiegeladenheit und das Bedürfnis nach körperlicher Aktion. Man meint gar zu platzen, wenn sich einem nicht die Möglichkeit bietet, auf irgendeine Art und Weise diese Empfindungen abreagieren zu können (etwas beißen, schlagen, treten...).
Angaben der Befragten in Prozent
1. von anderen irregeführt, hintergangen, missbraucht 40,8
2. Synonyme für Zorn - Wut 17,8
3. Hass, Abneigung 12,0
Die Stärke der empfundenen Spannung kommt gleich hinter der Emotionsempfindung der Furcht und wie Barlett & Izard ( 1972 ) weiter herausgefunden haben, tritt die zornige Person mit einem viel höheren Maß an Selbstbewusstsein auf, als bei irgendeiner anderen negativen Emotion. Das Gefühl von Tapferkeit und Mut stellt sich ein, doch man empfindet dies oft nicht, da der Zorn durch die Furcht vor Konsequenzen oder Schuld abgelöst wird.
Vielleicht hat Furcht auch eine mäßigende Wirkung auf möglicherweise gefährliche Feindseligkeiten.
Dass bei Zorn auch durchaus Kummer empfunden wird, könnte eventuell daran liegen, dass Zorn in unserer Gesellschaft zu selten offen ausgedrückt wird und er oft Folge von Enttäuschung über nicht erreichte Ziele ist.
Zorn wird von viel Impulsivität geleitet und weniger als jede andere Emotion von Kon- trolle. Die Kombination von Muskelspannung, Selbstbewusstsein und Impulsivität macht die Bereitschaft zuzuschlagen, verständlich. Das Gefühl der Rachsucht, sowie die Angriffslust und das Bedürfnis destruktiv zu sein, nannten 24,2% der Versuchs- personen.
Angaben der Befragten in Prozent
1. Synonyme für Zorn 28,8
2. erbost, gespannt 24,2
3. rachsüchtig, angriffslustig, destruktiv 24,2
Furcht dagegen empfindet man somit kaum beim Zorn, da Zorn die Furcht hemmt.
Bedeutung von Zorn
Im Laufe der Evolution wurde der Zorn sehr wichtig für das Überleben. Die Fähigkeit, alle Energie zu mobilisieren und sich energiereich und kraftvoll verteidigen zu können, wurde zu einer lebensnotwendigen Bedingung. Durch die dann aufkommende Zivilisation zählt Zorn heute eher zu den Passiva als zu den Aktiva, da er nur noch selten wirklich benötigt wird. Man kann hier von einer „Überholung der biologischen durch die kulturelle Evolution“ ( Izard 1994,373 ) sprechen.
Heute ist der zornige Angriff fast immer eine Verletzung von legalen oder ethischen Gesetzen. „Eine Form der Anpassung an diese Tatsache ist es, zu lernen, auf Zorn verbal zu reagieren und mit so viel Takt, dass die andere Person nicht noch mal er- zürnt und die Kommunikation nicht abgeschnitten wird.“ ( Izard 1994,373 ) Reagiert man unangemessen und destruktiv auf gerechtfertigten Zorn, wird klares Denken verhindert, Beziehungen werden „vergiftet“ und es kann zu psychosomatischen Stö- rungen kommen.
Verwandte Emotionen
Ekel
Entstehung von Ekel
Diese Emotion birgt nicht so viele mögliche Gefahren wie der Zorn.
„Dinge, die schlecht oder verdorben sind, sei es organisch oder psychisch, erzeugen Ekel.“ Von einigen Theoretikern wird die Meinung vertreten, Ekel sei aus dem Hungertrieb und dem damit verbundenen Verhalten entstanden. Dass etwas schlecht schmeckt sei also der „Prototyp“ des Ekels.
Empfindungen bei Ekel
Man empfindet beim Ekel ein Gefühl ähnlich der Übelkeit im Magen. Dies kann bei intensiver Empfindung tatsächlich auftreten. Ziel dieser Empfindung ist es, das Objekt des Ekels loszuwerden.
Beim Zorn fesselt das Objekt das ganze Interesse, die volle Aufmerksamkeit, beim Ekel wendet man sich eher ab.
Angaben der Befragten in Prozent
1. Brechreiz, Müdigkeit, Übelkeit 25,5
2. Synonyme für Ekel 18,8
3. Synonyme für Zorn 15,0
4. Synonyme für Geringschätzung 14,3
Handlungen bei empfundenem Ekel:
Angabe der Befragten in Prozent
1. Flucht aus der Situation 39,8
2. Problemlösung finden 21,1
3. verbal / körperlich feindselig 12,8
Bedeutung von Ekel
In der Evolution half Ekel wahrscheinlich, die Umgebung und sich selbst ausreichend hygienisch rein zu halten und davon abzuhalten, Verdorbenes zu essen oder dreckiges Wasser zu trinken.
„Mit Zorn kombinierter Ekel kann sehr gefährlich sein, da Zorn „Angriff“ motivieren kann und Ekel „Loswerden“. Ekel kann sich wie Zorn gegen das Selbst richten, und Ekel vor sich selbst kann die Selbstachtung verringern und zu Selbstablehnung führen.“ ( Izard 1994,377 ) Innengerichteter Zorn und Ekel sind gewöhnlich charakteristische Merkmale für Depressionen.
Geringschätzung / Verachtung
Entstehung von Geringschätzung / Verachtung
Im Laufe der Evolution hat das Gefühl der Geringschätzung und Verachtung die Auf- gabe erlangt, eine Art Vorbereitung zu sein, einem gefährlichen Widersacher entge- genzutreten. Denkt man beim Anblick seines Feindes: „Ich bin stärker als er!!!“, fällt es einem leichter, den notwendigen Mut aufzubringen, ihn anzugreifen und ihn zu besiegen.
Empfindungen bei Geringschätzung / Verachtung
Man fühlt sich seinem Gegenüber überlegen, meint, man sei besser als der „Feind“. Diese Geringschätzung und Verachtung kann sich aber auch sehr wohl gegen die eigene Familie, Kultur und Gesellschaft richten.
Wie auch bei Zorn und Ekel tritt hier die Empfindung der Feindseligkeit auf. Man ist gegen eine Person, Sache oder Idee voreingenommen und verliert meist das objektive Urteilsvermögen und hat sich von vornherein eine feste Meinung über das Gegenüber oder die Sache gebildet.
Angaben der Befragten in Prozent
1. Überlegenheit 59,3
2. von anderen irregeführt, hintergangen, verletzt 10,6
3. Missbilligung 8,9
Handlungen
1. überheblich, herablassend 19,5
2. Erfolg haben, bessere Arbeit leisten 15,4
3. sarkastisch handeln, gehässig, verletzend 13,0
Bedeutung von Geringschätzung / Verachtung
Die Evolutionspsychologen sehen die Bedeutung der Verachtung und Geringschätzung in der Entwicklung von Selbst- und Gruppenverteidigung gegen Naturkräfte o- der Raubtiere. Die Verachtung mit ihrer daraus resultierenden Geringschätzung lässt den Feind leichter besiegen.
Richtet sie sich objektiv gegen jene, die es verdient haben (Menschen, die andere Menschen unterdrücken, Umweltverschmutzer, Verschwender von irgendwelchen Rohstoffen oder Nahrungsmitteln etc.) kann sie zu einem sozial konstruktiven Zweck dienen, indem diese Menschen durch die Geringschätzung und Verachtung ihrer Mitbürger auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden.
Im Gegensatz zum Zorn ist Geringschätzung eine „kalte“ Emotion, sie ist distanziert. Die Geringschätzung einem Menschen gegenüber degradiert ihn zu einem Unter- menschen, einem Menschen unterer Klasse, der des Lebens nicht würdig ist. So kann es durch Geringschätzung zu kaltblütigem Mord und Massenvernichtung kom- men.
Zorn in Beziehung zu Feindseligkeit und Aggression
Die hervorstechendste Emotion bei der Feindseligkeit ist der Zorn. Sie umfasst auch Triebzustände und Wunschvorstellungen, dem Objekt der Feindseligkeit Schaden zuzufügen. Feindseligkeit ist erlebnishaft und expressiv, involviert aber keine verba- len oder physischen Aktivitäten. Zorn dagegen beeinflusst Wahrnehmungsprozesse und neigt dazu, kognitive Prozesse zu begünstigen, die in Übereinstimmung mit dem zugrundeliegenden Affekt stehen. Daraus kann die Feindseligkeit entstehen, die ne- gative Emotionen signalisiert (z.B. Zorn) und einem Objekt Schaden zufügen kann (primär psychisch).
Aggression dagegen ist eine feindselige Handlung, ein physischer Akt, der das Ziel hat, dem Objekt Schaden, Schwierigkeiten oder Niederlage zuzufügen. „Im allgemei- nen entsteht Aggression aus Feindseligkeit und aus den Vorstellungen und Gedan ken, die sie hervorbringt.“ ( Izard 1994,383 ) Die Feindseligkeit kann also als Bedin- gung, die Aggression als resultierendes Verhalten gesehen werden. Die Regulierung von Feindseligkeit und Aggression ist sehr wichtig, da der resultie- rende Zorn emotionalen Schmerz und psychischen Schaden verursachen kann.
Interaktion von Zorn mit anderen Affekten und Kognitionen
Schmerz: „Akuter Schmerz kann Zorn auslösen, und chronischer Schmerz kann die Zornschwelle herabsetzen“. ( Izard 1994,386 )
Kummer: Zorn kann Kummer mildern oder an seine Stelle treten. Auch ist Zorn oft eine wichtige Komponente von Depression.
Furcht: Zorn mildert oder hemmt Furcht; kontrollierter Zorn kann sogar therapeutisch eingesetzt werden.
Wahrnehmung. Psychosomatische Symptome - etwas in sich hineinfressen -, schränken geistige Produktivität ein.
Emotionsausdruck und Aggression
Die physische Anwesenheit des Opfers beeinflusst das Verhalten des Aggressors. Was zuerst bei Tieren beobachtet wurde, wurde in Experimenten beim Menschen nachvollzogen:
Ist der Zorn des Aggressors nicht besonders groß, der des Opfers dagegen sehr, wird der Aggressor den Gegenangriff vermeiden. Ist der Zorn des Aggressors dage- gen groß, wird der Zorn des Opfers als provokant angesehen, was eine Steigerung bewirkt.
Milgram (1963, 1964, 1965) untersuchte die aggressiven Reaktionen und ihre Beeinflussung durch die Anwesenheit und Nähe des Opfers.
Er stellte in seinen Versuchen fest, dass Berührungskontakt ein wirksames Abschreckungsmittel gegen Aggression ist.
Eine Versuchsperson wurde angewiesen, einer anderen Person, die sie nicht sehen, wohl aber hören konnte, Fragen zu stellen. Beantwortete die Person die Frage falsch, wurde die Versuchsperson durch den Versuchsleiter aufgefordert, elektrische Schocks sozusagen als Strafe zu verabreichen.
Die Stärke der Schocks konnte von „kaum spürbar“ bis „schwer“ variieren und von der Versuchsperson frei dosiert werden.
66% der Versuchspersonen, die keinen Berührungskontakt mit ihrem Gegenüber hatten, verabreichten der Person den Schock der Höchststärke, der auch als solcher gekennzeichnet war: “Gefahr: Schwerer Schock”. Im Gegensatz dazu nahmen „nur“ 30% der Versuchspersonen, die Berührungskontakt hatten, die Schmerzensschreie und Proteste des Opfers in Kauf und verabreichten ihnen Schocks der Höchststärke. Doch immer noch 30% nahmen das Risiko auf sich, eine Person zu töten, weil eine Autorität - der Versuchsleiter - sie dazu aufforderte...
Ethnologen behaupten, die heutige Waffentechnologie erleichtere das Töten, da es aus einer großen Entfernung möglich sei den Gegner zu beseitigen und dabei meist weder Sichtkontakt, noch gar Berührungskontakt nötig sei.
Wirkung der Wahrnehmung des Zornausbruchs
Folgender Versuch wurde von Savitsky u.a. ( 1974 ) gemacht: Die Versuchsperson sollte einer Person Wortpaare beibringen und ihr einen Schock für eine inkorrekte Antwort verabreichen. Dies sollte angeblich das Lernen erleichtern. „Jede Versuchsperson wurde einem Opfer mit einem furchtsamen, einem zornigen, einem freudigen und einem emotional unspezifischen Ausdruck gegenübergestellt … Zwei der emotionsspezifischen mimischen Äußerungen beeinflussten die Aggressionen der Versuchspersonen tatsächlich signifikant“. ( Izard 1994,391 )
Lächelnde Opfer erhielten höhere Schocks. Der Eindruck entstand hier, das Opfer finde Gefallen sowohl an der Aufgabe als auch an den Schocks. Also hatte die Versuchsperson Gefallen daran, sie zu erteilen.
Zornig aussehende Opfer dagegen bekamen geringere Schocks. Hier kann die Ursache in der eventuellen Antizipation nachfolgender Vergeltung liegen oder in möglicher späterer peinlicher Konfrontation mit dem Opfer. Das Opfer sah bedrohlich aus was einen direkten Hemmungsmechanismus auslöste.
Das Ergebnis war die Instrumentelle Aggression: Der Schock wurde von den Versuchspersonen als Mittel des leichteren Lernens, nicht des aggressiven Verhaltens oder gar des Schaden zufügens angesehen.
Wirkungen des Nichtäußerns von Zorn
Es ist schlecht, jede Form des Zornausdrucks - auch Gesichtsausdruck, Stimme etc.
- zu unterlassen. „Zornausdruck und angemessenes zornbezogenes Verhalten kön- nen konstruktiv sein.“ ( Izard 1994,392 ) Es ist wichtig, den Gefühlen direkten und echten Ausdruck zu geben, aber gleichzeitig genügend Kontrolle zu bewahren, um die Intensität nicht größer als notwendig werden zu lassen. Wichtig ist hier, den Zornausdruck und die verbale Aggression deutlich und klar zu kommunizieren. Im Gegensatz dazu steht der destruktive Zornausbruch und die verbale Aggression ei- ner Person, die um jeden Preis gewinnen möchte, ohne Rücksicht auf die andere Person oder Beziehung zu nehmen.
Auch psychosomatische Symptome können gelegentlich auftreten, wie Gelenkrheumatismus, Schuppenflechte, Magengeschwüre etc.
Literaturliste
Barlett, E.S. & Izard, C.E.: A dimensional and discrete emotions investigation of the subjective experience of emotion. In: C.E. Izard (Hrsg.): Patterns of emotions. A new analysis of anxiety and depression. New York: Academic Press 1972.
Izard, C.E.: Die Emotionen des Menschen. Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie. 3.Auflage. Weinheim: Beltz 1994.
Milgram, S.: Behavioral study of obedience. In: Journal of Abnormal and Social Psychologie. 1963. 67, 371-378
Milgram, S.: Group pressure and action against a person. In: Journal of Abnormal and Social Psychology. 1964. 69, 137-143
Milgram, S.: Some conditions of obedience and disobedience to authority. In: Human Relations. 1965. 18(1), 53-75
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über Zorn, Ekel und Verachtung?
Der Text behandelt die Entstehung, Ursachen, und Auslöser von Zorn, einschließlich der körperlichen und emotionalen Empfindungen, die damit verbunden sind. Er untersucht auch verwandte Emotionen wie Ekel und Geringschätzung/Verachtung, ihre Ursprünge, Empfindungen und Bedeutungen. Darüber hinaus wird die Beziehung von Zorn zu Feindseligkeit und Aggression, die Interaktion von Zorn mit anderen Affekten und Kognitionen sowie die Auswirkungen des Emotionsausdrucks und der Unterdrückung von Zorn diskutiert.
Welche Ursachen und Auslöser werden für Zorn genannt?
Häufige Auslöser für Zorn sind das Gefühl, körperlich oder psychisch behindert zu werden, persönliche Beleidigungen, Alltagsfrustrationen, Unterbrechung von Interesse und Freude, Übervorteilung und Zwang. Die Ursachen können kulturell unterschiedlich sein und basieren oft auf persönlicher Konditionierung und Lernprozessen.
Wie äußert sich Zorn im Aussehen?
Typische Merkmale des Aussehens bei Zorn sind angespannte Stirnmuskeln, die ein drohendes Aussehen um die Augen herum erzeugen, geweitete Nasenlöcher, rechteckig geöffneter Mund mit entblößten Zähnen und ein rotes Gesicht. Kinder lernen jedoch, ihren Zorn zu unterdrücken und zu verbergen.
Welche Empfindungen sind mit Zorn verbunden?
Zorn geht oft mit einem heißen, roten Gesicht, angespannten Muskeln, einem Gefühl von Kraft, dem Impuls zuzuschlagen und die Quelle des Zorns anzugreifen einher. Es entsteht ein inneres Gefühl von Energiegeladenheit und das Bedürfnis nach körperlicher Aktion. Manchmal wird auch Kummer empfunden.
Welche Bedeutung hat Zorn evolutionär gesehen?
Evolutionär gesehen war Zorn wichtig für das Überleben, da er die Mobilisierung von Energie und eine kraftvolle Verteidigung ermöglichte. In der modernen Zivilisation wird Zorn jedoch eher als Belastung angesehen, da er nur noch selten wirklich benötigt wird.
Was sind die Ursachen und Empfindungen von Ekel?
Ekel entsteht durch Dinge, die schlecht oder verdorben sind, sei es organisch oder psychisch. Die Empfindungen ähneln der Übelkeit im Magen, und das Ziel ist es, das Objekt des Ekels loszuwerden.
Was ist Geringschätzung/Verachtung und wie entsteht sie?
Geringschätzung und Verachtung entstanden evolutionär, um eine Vorbereitung zu sein, einem gefährlichen Widersacher entgegenzutreten. Man fühlt sich dem Gegenüber überlegen und besser als der "Feind".
Wie hängen Zorn, Feindseligkeit und Aggression zusammen?
Zorn ist die hervorstechendste Emotion bei Feindseligkeit. Aggression ist eine feindselige Handlung, die das Ziel hat, Schaden zuzufügen. Feindseligkeit kann als Bedingung und Aggression als resultierendes Verhalten angesehen werden.
Wie interagiert Zorn mit anderen Affekten und Kognitionen?
Akuter Schmerz kann Zorn auslösen, und chronischer Schmerz kann die Zornschwelle herabsetzen. Zorn kann Kummer mildern oder an seine Stelle treten und Furcht mildern oder hemmen. Psychosomatische Symptome können die geistige Produktivität einschränken.
Welche Auswirkungen hat der Ausdruck oder die Unterdrückung von Zorn?
Es ist schlecht, jede Form des Zornausdrucks zu unterlassen. Zornausdruck und angemessenes zornbezogenes Verhalten können konstruktiv sein. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, den Zorn zu kontrollieren. Das Nichtäußern von Zorn kann auch zu psychosomatischen Symptomen führen.
Welche Studien werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt Studien von Milgram (1963, 1964, 1965) über aggressive Reaktionen und deren Beeinflussung durch die Anwesenheit des Opfers, sowie eine Studie von Savitsky u.a. (1974) über die Wirkung der Wahrnehmung des Zornausbruchs auf das Verhalten des Aggressors.
- Citar trabajo
- Judith Lekszas (Autor), 2000, Zorn und verwandte Emotionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99296