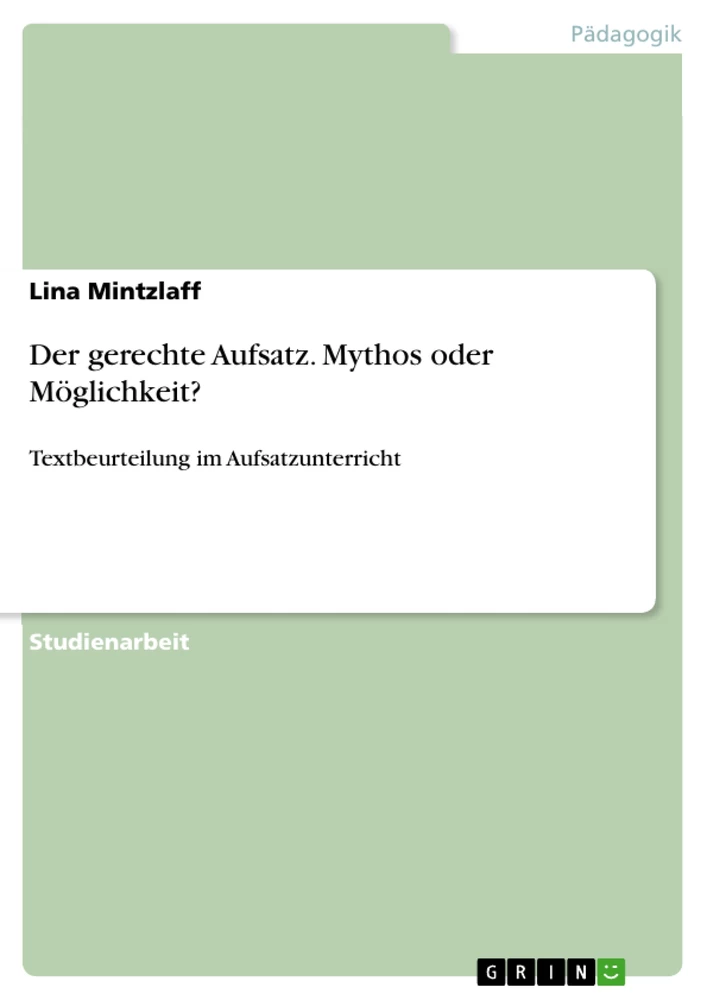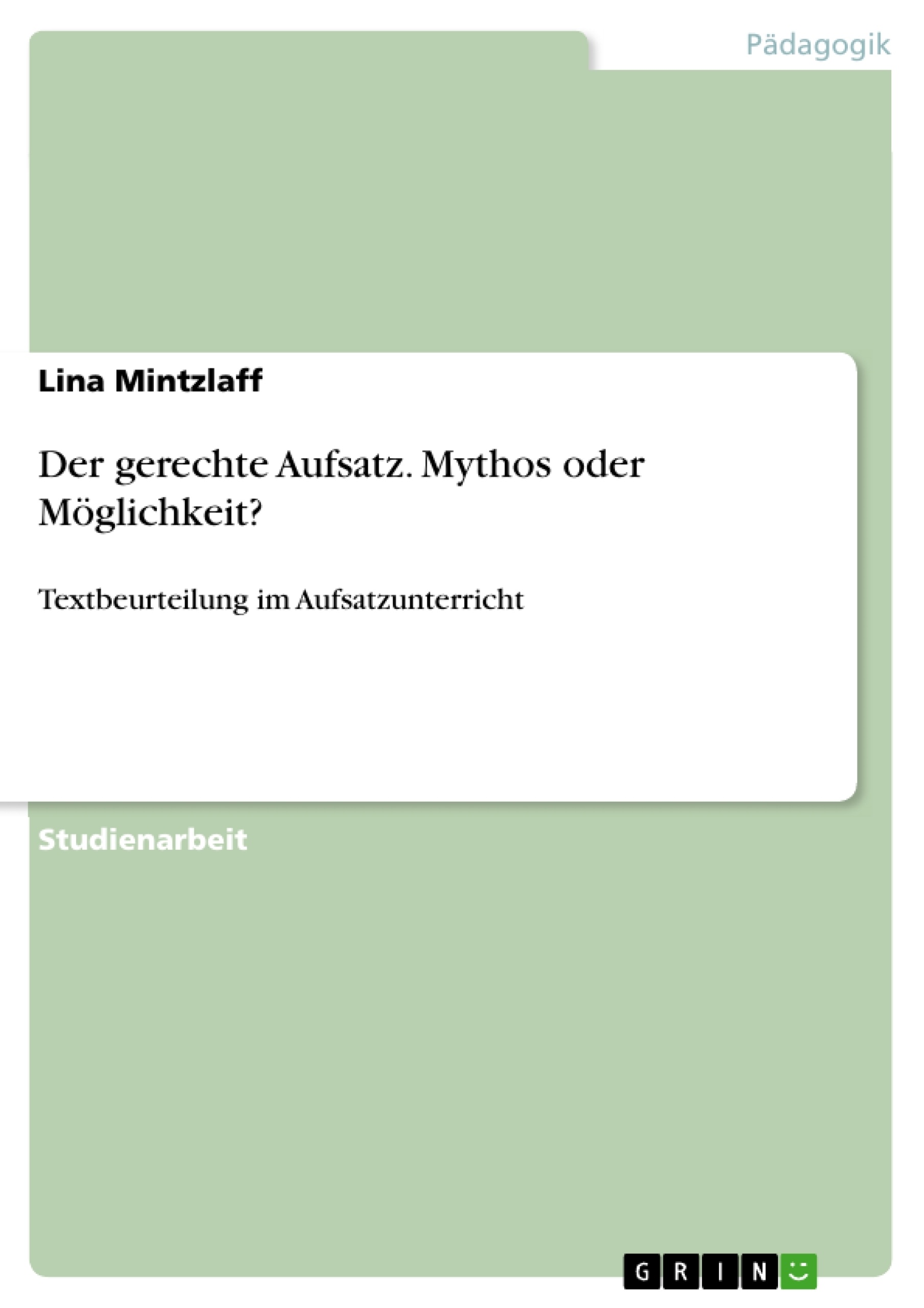In dieser Arbeit soll zunächst untersucht werden, was Leistungsbeurteilung beinhaltet und wie sie mit der Schreibkompetenz verbunden ist. Anschließend sollen verschiedene Formen der Leistungsbewertung vorgestellt und auf ihre Vor- und Nachteile für den Schreibunterricht und die Korrekturarbeit analysiert werden. Im abschließenden Fazit soll dann ein Blick auf mögliche Perspektiven des Schreibunterrichts geworfen werden.
Aufsätze sind eine, der von Schüler und Schülerinnen am häufigsten gefürchtete Form der Klassenarbeit/ Klausur. Nicht selten gibt es nach der Korrektur Diskussionen und Enttäuschungen. Ein Grund hierfür kann die Undurchsichtigkeit der Endnote und das Unverständnis für diese sein. Wie kommt es zu einer Note und weshalb wurde ein anderer Text ähnlich oder ganz anders bewertet? Ist es möglich, Aufsätze und andere Schülertexte „gerecht“, also valide, objektiv und reliabel zu benoten? Welche Formen gibt es für so eine Bewertung und wie muss die Vorbereitung sowie die Korrektur erfolgen?
Für die Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern, sind Klassenarbeitsnoten häufig nicht nachvollziehbar, die Korrektur erscheint zum Teil willkürlich. Dies betrifft vor allem Klassenarbeiten, in denen die Bewertungskriterien nicht transparent gemacht wurden. „Klassische“ Schulaufsätze werden bis heute nach dem Schema: Sprache, Inhalt, Form benotet. Diese Kategorien sind jedoch so umfassend, dass ein anschließendes Nachvollziehen der Einzelbenotung häufig nicht möglich ist. Zudem wirken viele Benotungen von Texten oft losgelöst vom Unterrichtsinhalt und der Klassenarbeitsvorbereitung. Es existieren jedoch viele verschiedene Ansätze zur Erneuerung der Leistungsbeurteilung und -bewertung, die das prozessorientierte Schreiben nach transparenten Kriterien in den Fokus rückt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Schreckgespenst Aufsatz?
- Der Schreibprozess
- Texte bewerten und beurteilen
- Was ist Leistungsbewertung?
- Problematik der Ziffernote
- Grundformen der Bewertung
- Bewertend-prüfendes Beurteilen
- Wie lässt sich Textqualität messen?
- Züricher Textanalyseraster
- Basiskataloge
- Von der Schreibberatung zur Schülerselbstbeurteilung – verschiedene Beurteilungsmöglichkeiten
- Schreibberatung und Bewerten als Dialog
- Prozessorientiertes Benoten - Portfolio
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der gerechten Bewertung von Schüleraufsätzen im Deutschunterricht. Sie untersucht die Komplexität des Schreibprozesses und die Bedeutung der Leistungsbeurteilung im Kontext von Schreibkompetenz.
- Kritik an der traditionellen Aufsatzbewertung und den Ziffernoten
- Analyse des Schreibprozesses und seine Bedeutung für die Leistungsbeurteilung
- Vorstellung verschiedener Ansätze zur Leistungsbewertung im Schreibunterricht
- Diskussion der Vor- und Nachteile verschiedener Beurteilungsmethoden
- Perspektiven für einen effektiven und gerechten Schreibunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das Schreckgespenst Aufsatz?
Das Kapitel kritisiert die herkömmliche Aufsatzbewertung mit Ziffernoten als undurchsichtig und ungerecht. Es zeigt auf, dass die Bewertungskriterien oft unklar sind und die Schüler den Bewertungsprozess nicht nachvollziehen können. Zudem wird die Diskrepanz zwischen den formalen Kriterien der Bewertung und dem realen Lernprozess im Unterricht thematisiert.
Der Schreibprozess
Dieses Kapitel erklärt den Schreibprozess als ein komplexes System, das Planen, Formulieren und Überarbeiten beinhaltet. Es betont, dass die Leistungsbewertung alle Aspekte des Schreibprozesses berücksichtigen sollte, um einen nachhaltigen didaktischen Mehrwert zu erzielen. Die Schwierigkeiten beim Bewertungsprozess, die sowohl für Lehrer als auch Schüler bestehen, werden beleuchtet.
Texte bewerten und beurteilen
Das Kapitel definiert die Begriffe Bewerten, Beurteilen und Benoten. Es erläutert die Bedeutung der Leistungsbewertung im Deutschunterricht und die Herausforderungen, die mit der Bewertung von schriftlichen Arbeiten verbunden sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ziffernote nur einen kleinen Teil des Bewertungsprozesses darstellt und dass die Entwicklung von Reflexionsfähigkeit bei den Schülern eine wichtige Rolle spielt.
Problematik der Ziffernote
Dieses Kapitel widmet sich der Kritik an der Ziffernote als summative Bewertung von Schülerarbeiten. Es zeigt die problematische Selektionsfunktion von Noten auf und thematisiert die Uneinheitlichkeit in der Bewertungspraxis, die zu einer großen Beurteilungsvarianz bei Schülertexten führt.
Schlüsselwörter
Schreibunterricht, Leistungsbewertung, Textbeurteilung, Ziffernote, Schreibprozess, Lernentwicklungsbeschreibung, Schreibberatung, Schülerselbstbeurteilung, Beurteilungskriterien, Validität, Objektivität, Reliabilität, Portfolio.
- Quote paper
- Lina Mintzlaff (Author), 2018, Der gerechte Aufsatz. Mythos oder Möglichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992912