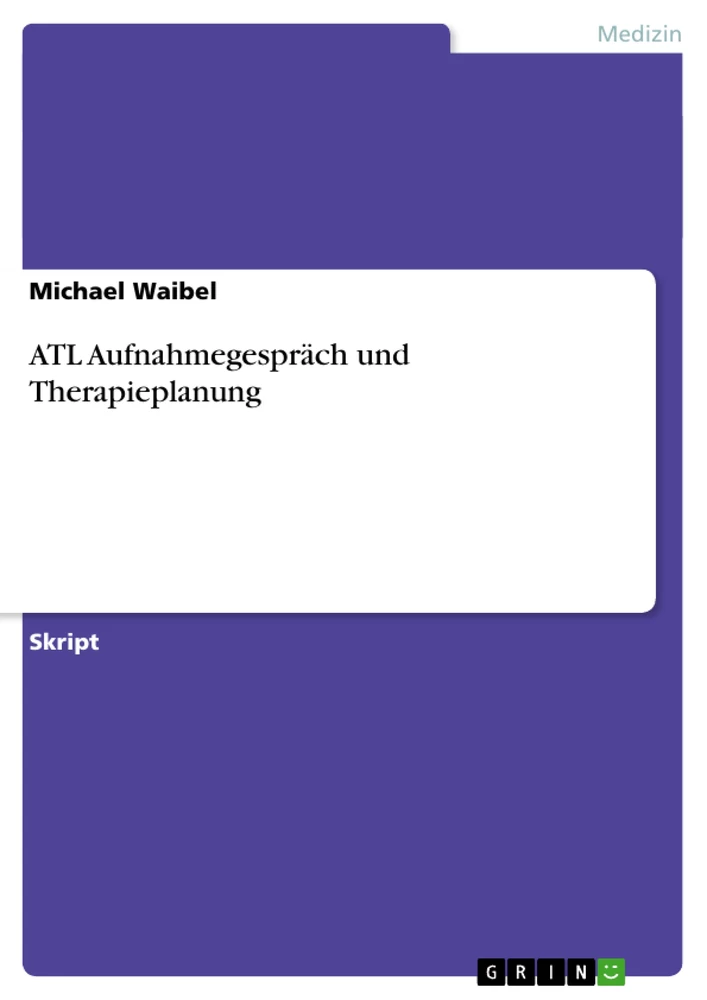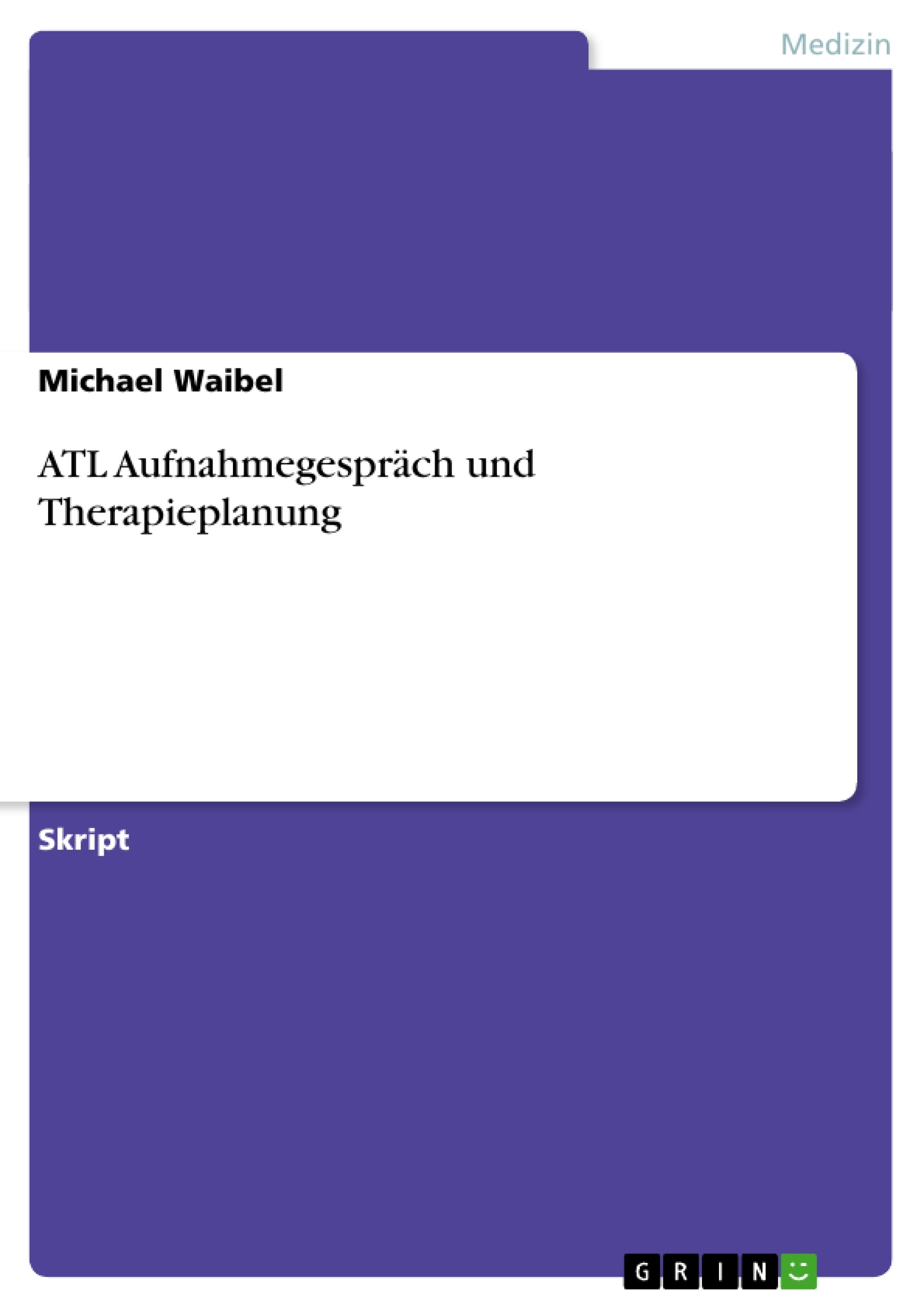Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Abgrund, die Sucht als ständiger Begleiter, die Scham nagt unaufhörlich – dies ist der Ausgangspunkt einer bewegenden Reise. Begleiten Sie eine 46-jährige Frau, die den mutigen Schritt in die Psychiatrie wagt, um sich ihrer Alkoholkrankheit zu stellen und ihr Leben zurückzugewinnen. Dieser Bericht beleuchtet den einfühlsamen Aufnahmeprozess, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur sorgfältigen Therapieplanung, und gewährt tiefe Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der psychiatrischen Pflege. Erleben Sie, wie eine Bezugspflegekraft eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut, um der Patientin zu helfen, ihre Ängste zu überwinden, soziale Kontakte wiederzuentdecken und verloren gegangene Fähigkeiten neu zu erlernen. Im Zentrum steht die individuelle Pflegeplanung, die darauf abzielt, der Patientin nicht nur einen guten Einstieg ins Stationsleben zu ermöglichen, sondern auch langfristig ihre Verantwortungsfähigkeit zu stärken und ihr Leben wieder mit Sinn zu füllen. Die detaillierte Pflegeerhebung, basierend auf den Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL), offenbart die vielfältigen Auswirkungen der Sucht auf alle Lebensbereiche – von Ernährung und Schlaf bis hin zu sozialer Interaktion und persönlicher Sicherheit. Die Pflegediagnose verdeutlicht die soziale Isolation und den Verlust von Struktur, die durch die Alkoholkrankheit entstanden sind. Entdecken Sie die sorgfältig geplanten soziotherapeutischen Maßnahmen, die darauf abzielen, der Patientin Wertschätzung entgegenzubringen, positive Gefühle zu entwickeln und ihre Bedürfnisse zu äußern. Der Bericht bietet auch einen ehrlichen Blick auf mögliche Probleme im Therapieprozess und zeigt alternative Lösungsansätze auf, die auf Akzeptanz und Ermutigung basieren. Die abschließende Auswertung und Reflexion verdeutlichen die Bedeutung einer störungsfreien Umgebung und einer wertschätzenden Grundhaltung für den Therapieerfolg. Dieses Werk ist ein Muss für alle, die sich für die psychiatrische Pflege, Suchtbehandlung und die menschliche Seite der Genesung interessieren. Es bietet wertvolle Einblicke in die Praxis der Bezugspflege und zeigt, wie durch Empathie, Fachwissen und eine individuelle Therapieplanung Hoffnung und Heilung möglich werden. Tauchen Sie ein in eine Geschichte von Mut, Verzweiflung und dem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der menschlichen Verbindung. Erfahren Sie, wie eine Patientin den Weg aus der Dunkelheit findet und lernt, ihr Leben neu zu gestalten.
1.Einführung:
Anlass für den Bericht ist das lebenspraktische Training ,,Aufnahmegespräch und Therapieplanung".
Die sehr unsicher wirkende Patientin kommt alleine, freiwillig mit Einweisungsschein vom Hausarzt zur ersten stat. Aufnahme in die Psychiatrie.
Nach der Übergabe der Frühschicht wurde im Team besprochen, dass ich den geplanten Zugang übernehmen werde und in der Bezugspflege betreuen werde.
Die Patientin wird von mir begrüßt, sie wirkt unsicher, hat schwitzige Hände und wirkt vom EZ und AZ deutlich reduziert.
Sie ist wach, allseits orientiert, offen im Kontakt und freundlich zugewandt.
Die Patientin hat keinen Alkoholfoetor, gibt an, heute noch nichts getrunken zu haben.
Die Pat. wird von mir informiert, dass ich sie in der Bezugspflege betreuen werde.
Es wird mit ihr ausgemacht, dass das Aufnahmegespräch mit dem Stationsarzt und mir als Bezugspflegekraft um 10.45 Uhr stattfinden wird.
Der Pat. wird ihr Zimmer gezeigt, anschl. die wichtigsten Räume auf Station. Sie erhält zu trinken, die Vitalzeichen werden erhoben. Mit der Pat. wird ausgemacht, dass wir im anschließenden Aufnahmegespräch alles weitere besprechen werden und die gemeinsame Therapieplanung besprechen werden.
2.Pflegeerhebung anhand der psychiatrischen ATL´s
Atmung:
R1: Pat. hat keine Probleme
Regulation der Körpertemperatur
R1: Pat. hat keine Probleme
Ernährung:
R1: Umfassende Kenntnisse im Kochen und Backen
P1: Während den Trinkphasen tagelang keine Nahrungsaufnahme, koche im betrunkenen Zustand , keiner würde das essen
Ausscheidung:
R1: Kann Ausscheidung kontrollieren P1. Durchfall
P2: Nykturie
Ruhen und Schlafen:
R1: Pat. weiß, dass der Schlaf ohne Alkohol erholsamer ist P1. Pat. ist es gewohnt, alkoholisiert einzuschlafen
Sicherheit:
R1: Pat. sieht sich selber ständig Gefahren ausgesetzt, weil sie nur alkoholisiert aus dem Haus geht
P1: viele ,,Filmrisse" wegen Alkohol, dadurch sozialer Rückzug P2. verlässt nur alkoholisiert ihr Haus
P3: benötigt Alkohol, um sich Mut anzutrinken
Körperpflege:
R1: Pat. achtet auf ihr Aussehen
P1. Pat. deutlich gezeichnet vom Alkohol, sehr belastend für die Pat.
Mobilität:
R1: keine Einschränkung
R2: Pat. hat Führerschein Klasse 3
P1: Im betrunkenen Zustand vielen Gefahren ausgesetzt durch unsicheren Gang
Informieren und Orientierung:
R1: Pat. allseits orientiert
P1. Pat. kennt an ihrem Wohnort alle Möglichkeiten sich Alkohol zu beschaffen, lässt überall anschreiben.
Kommunikation:
R1: Pat. hat keine Einschränkungen in der Kommunikation P1: Sozialer Rückzug
R2: Pat. verheiratet, 14-jährige Tochter P2:Keine Freunde
P3: Probleme mit Ehemann und Tochter wegen Alkoholkonsum
Stimmungen wahrnehmen und leben:
R1: Pat. möchte ihre jetzige Situation ändern
P1: Pat. streite unter Alkoholeinfluss heftig mit ihrer Tochter
Verantwortungsfähigkeit:
R1: möchte wieder mehr Verantwortungsfähigkeit erlangen P1: Verantwortung wird vom Ehemann abgenommen
Sinn finden:
R1: Pat. möchte ihr Leben wieder gestalten
P1: Pat sehr unsicher, zieht sich aus Scham wegen ihrer Alkoholkrankheit zurück
Sinnvolle Zeitgestaltung:
R1: Pat. weiß, dass ,sie keine Struktur hat P1: Pat. ist viel alleine
P2: Pat. trinkt, wenn sie alleine ist
P3: Keine Hobbys, keine Interessen
P4: Verbringt ihre Zeit vor dem Fernseher
Arbeit:
R1: Pat. hat an der PH Lehramt für Grund- und Hauptschule studiert, war für 5 Jahre als Lehrerin tätig
P1: Lehrertätigkeit wegen Alkoholproblem am Arbeitsplatz aufgegeben
Persönlichen Besitz verwalten und finanzielle Sicherheit:
R1: Pat. kennt sich mit Geld aus
P1: Pat. hat kein eigenes Geld zur Verfügung
P2: Haushaltsgeld wird für Alkohol ausgegeben
P3. Überall im Dorf Schulden wegen Alkohol
Wohnen:
R1: Pat. wohnt im eigenen Haus
Sich als Mann/Frau/Kind/Jugendlicher fühlen und verhalten:
R1: Pat. ist verheiratet
P1: Eheprobleme
Rechte wahrnehmen und Pflichten erfüllen:
R1: Pat. hält sich an Termin zur stationären Aufnahme
P1: Pat. hat schon lange keinen Kontakt zu Behörden gehabt
Sterben:
R1: Pat. macht sich Sorgen wegen ihrem körperlichen Zustand, will wieder auf die Beine kommen
P1: Pat. deutlich gezeichnet vom Alkoholkonsum
3. Pflegediagnose
Die Pat. schämt sich sehr wegen ihrer Alkoholkrankheit. Sie vernachlässigt seit Jahren sämtliche soziale Kontakte, hat keine Hobbys, lebt strukturlos, hat keine Freizeitinteressen, kann Kontakte nur unter Alkoholkonsum aufnehmen.
Der Bezug zur Hausarbeit ist ihr verlorengegangen, die Hausarbeit wird von der Familie übernommen.
Vorbereitung und Planung einer soziotherapeutischen Einzel-oder Gruppenaktivität: ,, Aufnahmegespräch und Therapieplanung"
1. Ziel
1.1. Begründung für die Maßnahme lt. Stationsziel/Handbuch
1.2. Was soll den PatientInnen vermittelt werden
Der Pat. soll im Aufnahmegespräch Verständnis für ihre Situation vermittelt werden. Sie soll spüren, dass sie auf Station nicht nur als Patientin mit einer Alkoholkrankheit gesehen wird, sondern als Mensch mit Fähigkeiten und Bedürfnissen.
Sie soll spüren, dass kongruent mit ihr umgegangen wird, und dass wir auf Station eine tragfähige Beziehung zu ihr aufbauen wollen. Mit dem Ziel, dass sie wieder Fähigkeiten zur Entwicklung von sozialen Kontakten erlangt. Außerdem sollen lebenspraktische Fähigkeiten wie z.B. hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Umgang mit Behörden geübt werden. Wichtig ist zuerst der Pat. einen guten Einstieg ins Stationsleben zu vermitteln, sie zu integrieren. Die Bezugspflegekraft soll der ständige Ansprechpartner der Patientin sein, gegenüber der sie ihre Bedürfnisse und Ängste äußern darf.
1.3 . Die PatientInnen sollen:
1.3.1. kognitiv
Beim Aufnahmegespräch und der Therapieplanung nicht überfordert werden. Sie soll dem Gespräch folgen können.
1.3.2. affektiv
Sich beim Aufnahmegespräch nicht ,,entblößt" vorkommen, sondern durch die Wertschätzung im Ungang mit ihr positive Gefühle entwickeln
1.3.3. sozial-kommunikativ
Jederzeit im Gespräch ihre Bedürfnisse äußern können
1.3.4. psychomotorisch
Die Pat. soll die Möglichkeit erhalten, bei zu starker Unruhe das Gespräch beenden zu können
2.Zielgruppe
2.1. Wer soll angesprochen werden
Pat. N.
2.2. Teilnahmekriterien
Aufnahmegespräch und Therapieplanung
2.3. Teilnahmeausschluss
Das Gespräch soll in einem angenehmen Rahmen und ohne Störungen stattfinden
2.4. Gruppengröße
1 Patient, 1 Arzt, 1 Bezugspflegekraft
3. Planung
3.1. Zeitpunkt
Das Aufnahmegespräch findet um 10.45 statt
3.2. Dauer
ca. 1 Stunde
3.3. Ort
Dienstzimmer des Stationsarztes
3.4. Personalbedarf
1 Arzt, 1 Bezugspflegekraft
3.5. Material
3.6. Finanzierung
3.7. Vorgehen/Methode
Es handelt sich um ein Aufnahmegespräch mit ärztlicher und pflegerischer Therapieplanung. Es werden die medikamentöse Therapie, das psychotherapeutische Vorgehen und das soziotherapeutische Vorgehen besprochen.
4.Programmablauf / Maßnahmen fiktiver Ablauf
- Absprache im Team über Termin, Ort und Dauer des Aufnahmegespräches - Absprache mit dem Arzt
- Vermeidung von Störungen: möglichst keine Telefonanrufe, die Teammitglieder wissen, dass wir im Gespräch sind
- Stuhlkreis, Blickkontakt zu Patientin (face to face) - Pat. die Möglichkeit zur Unterbrechung geben - Vorstellen des Arztes, der Pflegekraft
- Körperkontakt herstellen durch Hände geben
- Pat. erzählen lassen, zuhören
5. Mögliche Probleme & Alternativen
5.1. mögliche Probleme
Pat. fühlt sich durch die Gesprächssituation eingeengt, schämt sich, ihre Probleme offen darzulegen.
Störungen von außen: Telefonanrufe, Arzt muss zum Notfall
5.2. Alternativen
Durch wertschätzende, akzeptierende Grundhaltung der Patientin das Gefühl des Verstehens vermitteln.
Pat. nicht ausfragen, sondern erzählen lassen.
Keine Vorwürfe oder Belehrungen wegen des Alkoholkonsums machen. Pat. für bereits erreichte Dinge im Leben loben.
Teammitglieder nochmals bitten, keine Telefonanrufe durchzustellen. Bei Notfall: Pat. um Verständnis bitten
6. Auswertung
6.1. in der Gruppe
- Blitzlicht
- Feed-back
Das Aufnahmegespräch mit der Patientin verlief in einem ruhigen und störungsfreiem Raum. Die Pat. hatte viel Gelegenheit über ihr Leben zu erzählen, bekam Lob für bisher geleistetes.
Die Pat. selber war am Anfang des Gespräches sehr aufgeregt und nervös, konnte kaum richtig sitzen. Sie betonte aber am Schluss, wie gut ihr das Gespräch getan hätte, und dass sie sehr froh sei, so freundlich auf Station aufgenommen worden zu sein
6.2. Reflexion mit Kolleginnen (Co-)
Im Team herrscht absolute Übereinstimmung, dass Aufnahmegespräche und Therapieplanung nicht gestört werden dürfen, und einen wesentlichen Beitrag zur Integration der Pat. auf Station sind.
6.3. Bericht im Team
Da es sich um ein Aufnahmegespräch mit Therapieplanung handelt, nahm der Bericht im Team größeren Raum ein.
Frau , eine 46-jährige Patientin aus , kam um 8.45 Uhr ohne Begleitung in nüchternem Zustand freiwillig mit Einweisungsschein auf Station. Die Pat. wurde von mir per Handschlag begrüßt, ich stellte mich mit Namen vor und sagte ihr, dass ich ihre zuständige Bezugspflegekraft für ihren stationären Aufenthalt sei.
Die Pat. wirkte sehr ängstlich und nervös, äußerte als erstes, dass sie sich sehr schäme.
Der Pat. wurde ihr Zimmer gezeigt, die Station im Groben erklärt und gezeigt. Mit der Pat.
wurde vereinbart, dass um 10.45 Uhr das Aufnahmegespräch mit dem Stationsarzt, Herr Dr.P. und mir als Bezugspflegekraft im Arztzimmer stattfinden werde. Da die Pat. sehr ängstlich wirkte, blieb ich bis zum Aufnahmegespräch in ihrer Nähe, bot ihr zu Trinken an, ging mit ihr ins Raucherzimmer, zeigte ihr die Station, füllte die Essenskarte aus und kam mit ihr über belanglose, alltägliche Situationen ins Gespräch. Insbesondere unterhielten wir uns über ihren Heimatort, indem ich selber gewohnt habe.
Im Aufnahmegespräch berichtete die Patientin, dass sie verheiratet sei, eine 14-jährige Tochter habe, 2 Stiefsöhne, 2 Enkelkinder und dass sie im eigenen Haus in wohne.
Sie komme nun zum Entzug auf Druck der Familie. Durchschnittliche Trinkmenge ca. 2 Liter Wein am Tag und Schnaps.
Pat. hat an der PH Lehramt für Grund- und Hauptschule studiert , war für 5 Jahre als Lehrerin tätig, hatte aber damals schon Alkoholprobleme und hat deswegen ihre Lehrertätigkeit beendet. Zwischendurch hat sie immer mal wieder als Verkäuferin in der elterlichen Metzgerei gearbeitet.
1982 Entwöhnungsbehandlung, danach maximale Abstinenzphase von ca. ½ Jahr.
Pat. berichtet, dass sie zuhause viel alleine wäre und dann würde sie nur trinken. Unter Alkoholeinfluss streite sie häufig mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Sie habe viele ,,Blackouts", würde nach dem Trinken die Flaschen in der Wohnung verstecken und sie am anderen Tag nicht mehr finden. Während ihrer Trinkphasen würde sie nichts mehr essen, habe immer Durchfall und Heißhungerattacken. Unter Alkoholeinfluss habe sie Durchschlafstörungen.
Pat. war vor langer Zeit bei 3 Sitzungen der Anonymen Alkoholiker, das habe ihr aber nicht gefallen.
Zuhause würde sie sich sehr schämen, da sie oft betrunken aus dem Haus geht. Sie benötige auch Alkohol um sich ,,Mut anzutrinken", z.B., wenn sie mit ihrem Mann wo hingehen muss. Pat. gibt an, ihren Haushalt nicht mehr versorgen zu können, sie gehe nicht mehr einkaufen, und koche nur noch unregelmäßig. Wenn sie kochen würde, sei es ungenießbar. Pat. gibt an, keine Hobbys und Interessen zu haben, sie setze sich am Morgen vor den Fernseher und trinkt.
Von seiten des Arztes wird der Pat. der Therapieplan der nächsten Tage erklärt.
Es werden die Ausgangsregelung besprochen, Pat. hat vorerst Personalausgang, ist damit einverstanden.
An den Therapien, insbesondere am Suchtprogramm der Station soll Pat. erst dann teilnehmen, wenn es ihr körperlich besser geht. Sie soll dies dann mit der Bezugspflegekraft absprechen. Vorerst stündlich RR-und Puls Kontrolle, sowie halbstündliches kontaktieren. Medikamente werden als Bedarf angesetzt.
Ich bespreche mit der Patientin, dass sie sich erst mal auf Station einfinden soll, den Ablauf kennenlernen soll und die Räumlichkeiten auf Station.
Beim Mittagessen werde ich sie den anderen Patienten vorstellen. Ihre Zimmernachbarin werde ich fragen, ob sie als eine Art ,,Pate" für die ersten Tage zur Verfügung stehen möchte, damit ist Pat. einverstanden.
Wir erstellen eine Pflegeplanung, mit dem Nahziel : Integration auf Station und Vertrauensaufbau. Als Fernziel benennen wir die Wiederaufnahme von sozialen Kontakten, mit der Familie und Freunden.
Als Problem wird die starke Rückzugstendenz durch Scham und fehlende soziale Kontakte aufgrund der Alkoholproblematik benannt.
Als Maßnahmen formulieren wir
- Gegenseitiges Kennenlernen
- Aushändigen und Erklären des Wochenplans
- Zeigen und Erklären der räumlichen Gegebenheiten
- Kennenlernen der zeitlichen Abläufe auf Station
- Rückzugsmöglichkeiten gewähren, Integration auf Station fördern mit Hilfe der
Bezugspflege
- Kennenlernen der Therapieprogramme - Einbinden in Therapien
- Spiele anbieten
- Gegenseitige Gesprächsbereitschaft
6.4. Dokumentation (analog1.3.)
Kognitiv: Die Pat. konnte dem Aufnahmegespräch und der Therapieplanung folgen, schweifte während dem Gespräch immer wieder ab, wirkte vergesslich
Affektiv: Pat. ängstlich, nervös, wenig selbstbewusst, schämt sich. Kann Lob für bisher geleistetes nicht annehmen.
Sozial-kommunikativ: Pat. kann in Gesprächsatmosphäre ihre Bedürfnisse äußern. Psychomotorisch: sehr unruhig
7. Evaluation
Das Gespräch fand in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt. Die anfangs sehr angespannte und nervöse, unruhige, ängstliche Patientin konnte sich im Laufe des Gespräches etwas entspannen und von ihrer Problematik erzählen.
Auffällig war, dass die Patientin große Schwierigkeiten hatte, beim Thema zu bleiben, weitschweifig erzählte, und bestimmte Grunddaten nicht richtig wusste: Studienjahr, Länge der Beschäftigung als Lehrerin, Geburtsjahr der Tochter, Termin der ersten Entwöhnungsbehandlung.
8.Zusammenfassung/Resümee
Die kognitiven Ressourcen der Patientin werden in der soziotherapeutischen Arbeit überprüft werden müssen. Welche Fähigkeiten hat sie in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten? Kann die Patientin einfache Tätigkeiten ausüben? Hat sie Schwierigkeiten bei komplexeren Tätigkeiten?
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist ein Bericht über ein Aufnahmegespräch und eine Therapieplanung mit einer Patientin in einer psychiatrischen Klinik. Es enthält eine Einführung, eine Pflegeerhebung anhand der psychiatrischen ATL´s (Aktivitäten des täglichen Lebens), eine Pflegediagnose, Ziele und Planung einer soziotherapeutischen Aktivität, einen Programmablauf, mögliche Probleme und Alternativen, eine Auswertung, eine Zusammenfassung und eine Evaluation.
Was war der Anlass für das Aufnahmegespräch?
Die Patientin kam freiwillig mit einer Einweisung vom Hausarzt zur stationären Aufnahme in die Psychiatrie. Sie wirkte unsicher und reduziert.
Wie wurde die Patientin bei der Aufnahme betreut?
Die Patientin wurde von einer Bezugspflegekraft begrüßt und betreut. Ihr wurde ihr Zimmer gezeigt, die Station erklärt und ein Aufnahmegespräch mit dem Stationsarzt und der Bezugspflegekraft vereinbart.
Was sind ATL´s?
ATL´s stehen für Aktivitäten des täglichen Lebens. Im Rahmen der Pflegeerhebung wurden verschiedene ATL´s der Patientin erfasst, wie Atmung, Regulation der Körpertemperatur, Ernährung, Ausscheidung, Ruhen und Schlafen, Sicherheit, Körperpflege, Mobilität, Informieren und Orientierung, Kommunikation, Stimmungen wahrnehmen und leben, Verantwortungsfähigkeit, Sinn finden, Sinnvolle Zeitgestaltung, Arbeit, Persönlichen Besitz verwalten und finanzielle Sicherheit, Wohnen, Sich als Mann/Frau/Kind/Jugendlicher fühlen und verhalten, Rechte wahrnehmen und Pflichten erfüllen, und Sterben. Die Patientin wird danach inwieweit sie selbständig darin ist, eingestuft.
Was ist die Pflegediagnose?
Die Pflegediagnose besagt, dass die Patientin sich wegen ihrer Alkoholkrankheit schämt, soziale Kontakte vernachlässigt, keine Hobbys hat, strukturlos lebt und Kontakte nur unter Alkoholeinfluss aufnehmen kann.
Welche Ziele wurden für die Therapieplanung formuliert?
Das Hauptziel war, der Patientin Verständnis für ihre Situation zu vermitteln und eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Weitere Ziele waren die Entwicklung von sozialen Kontakten und die Übung von lebenspraktischen Fähigkeiten.
Wie sollte die Patientin beim Aufnahmegespräch behandelt werden?
Die Patientin sollte wertgeschätzt werden, und ihre Bedürfnisse sollten jederzeit geäußert werden dürfen.
Wer nahm an dem Aufnahmegespräch teil?
Ein Patient (Frau N.), ein Arzt und eine Bezugspflegekraft.
Wie war der Ablauf des Aufnahmegespräches geplant?
Das Aufnahmegespräch sollte in einem ruhigen Rahmen stattfinden, ohne Störungen. Dem Patienten sollte die Möglichkeit gegeben werden, zu erzählen und zuzuhören.
Welche Probleme könnten auftreten und welche Alternativen gab es?
Ein mögliches Problem war, dass sich die Patientin eingeengt fühlt und sich schämt, ihre Probleme offen darzulegen. Alternativ sollte ihr durch eine wertschätzende Grundhaltung das Gefühl des Verstehens vermittelt werden.
Wie verlief das Aufnahmegespräch?
Das Aufnahmegespräch verlief in einem ruhigen und störungsfreien Raum. Die Patientin war am Anfang des Gespräches sehr aufgeregt und nervös, konnte aber am Schluss betonen, wie gut ihr das Gespräch getan hätte.
Welche Maßnahmen wurden geplant?
Es wurden Maßnahmen zur Integration auf Station und zum Vertrauensaufbau geplant, wie z.B. gegenseitiges Kennenlernen, Aushändigen und Erklären des Wochenplans, Zeigen und Erklären der räumlichen Gegebenheiten und Gewährung von Rückzugsmöglichkeiten.
Wie wurde das Aufnahmegespräch evaluiert?
Das Gespräch fand in einer angenehmen Atmosphäre statt. Die Patientin konnte sich im Laufe des Gespräches etwas entspannen und von ihrer Problematik erzählen.
Was ist das Resümee des Aufnahmegespräches?
Die kognitiven Ressourcen der Patientin müssen überprüft werden, ebenso wie ihr soziales Umfeld und ihre Beziehungsfähigkeit. Vorrangig ist jedoch die Integration auf Station und der Vertrauensaufbau zur Bezugspflegekraft.
- Quote paper
- Michael Waibel (Author), 2000, ATL Aufnahmegespräch und Therapieplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99257