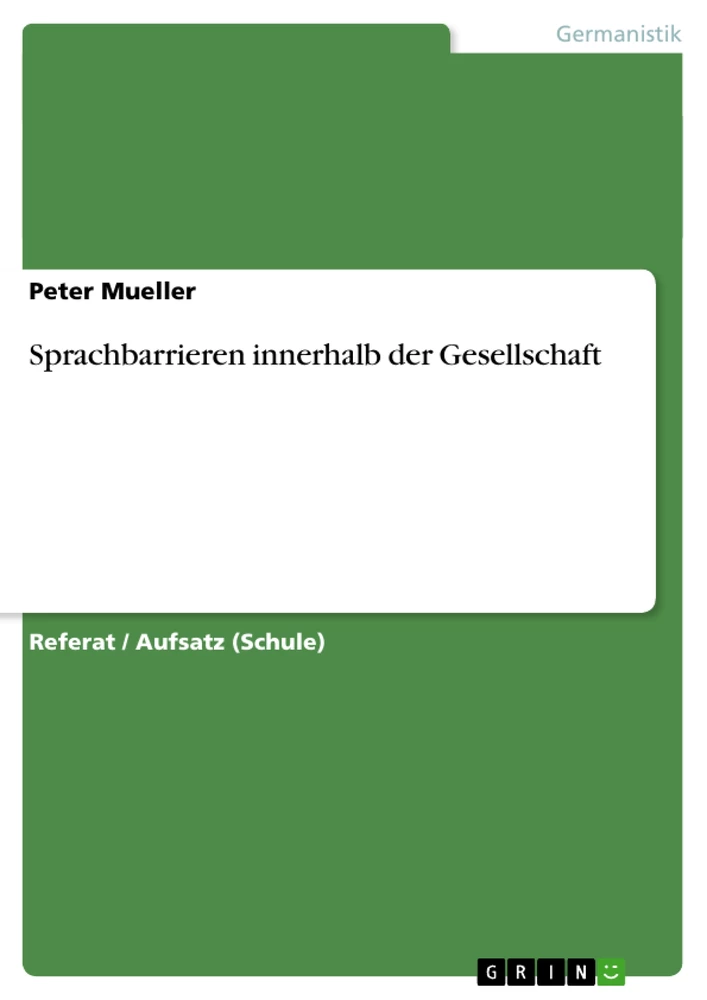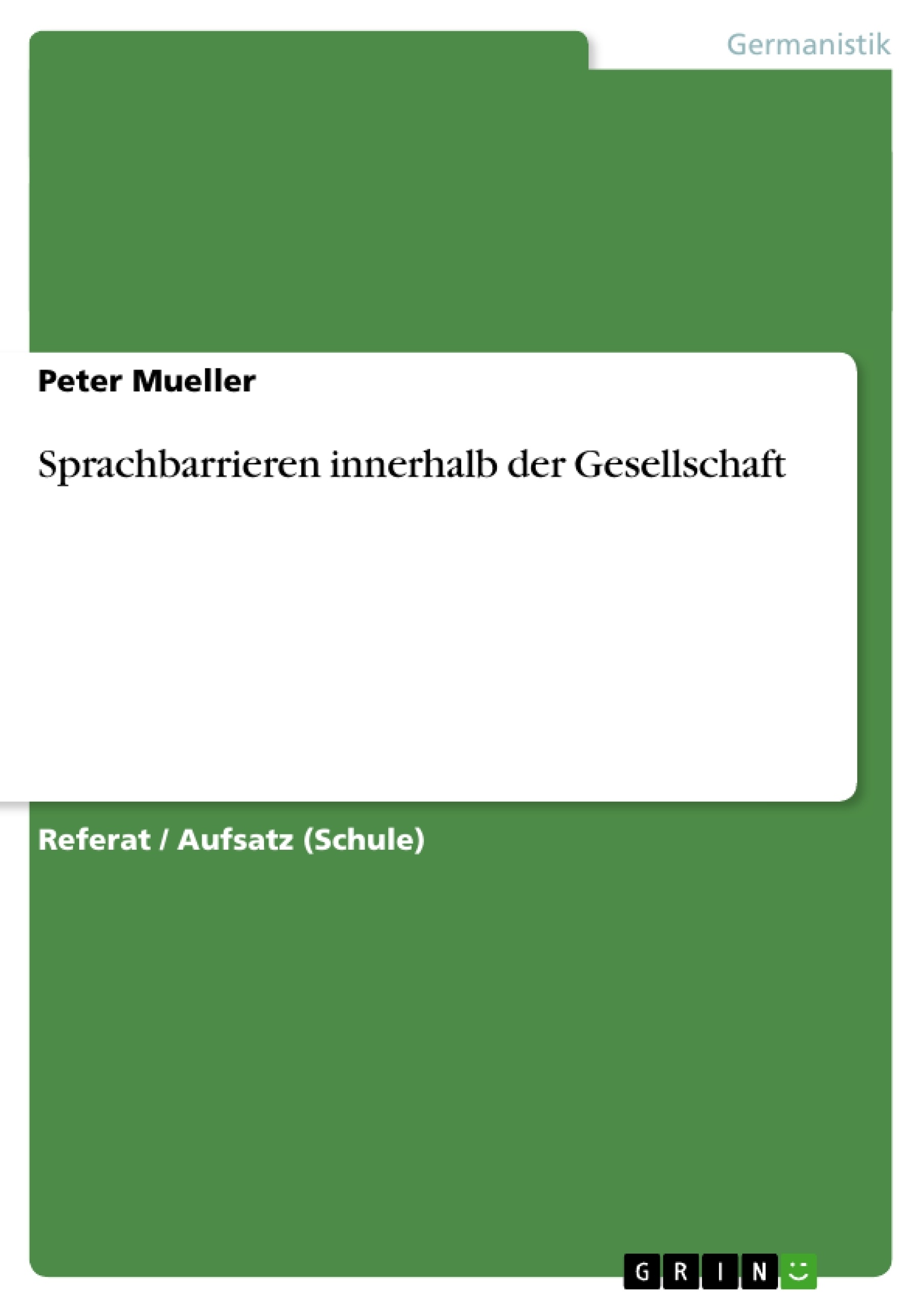Verbirgt sich hinter unserer alltäglichen Kommunikation eine unsichtbare Mauer, die den sozialen Aufstieg behindert und Chancen ungleich verteilt? Diese Frage steht im Zentrum einer erschütternden Analyse der Sprachbarrieren innerhalb unserer Gesellschaft. Entdecken Sie, wie subtile Unterschiede in Vokabular, Syntax und Ausdrucksweise nicht nur Missverständnisse verursachen, sondern ganze Lebenswege prägen können. Angefangen bei Bernsteins Theorie der linguistischen Codes, die die Existenz schichtspezifischer Sprachformen aufzeigt – dem elaborierten Code der Mittelschicht und dem restringierten Code der Unterschicht – bis hin zu Lawtons Nachfolgeuntersuchungen, die diese Thesen empirisch untermauern, enthüllt dieses Buch die Mechanismen, die soziale Ungleichheit durch Sprache manifestieren. Erfahren Sie, wie die Schule, anstatt ein Ort der Chancengleichheit zu sein, ungewollt zur Verfestigung dieser Unterschiede beitragen kann. Die Studien von Roeder und Oevermann zeigen auf, wie der soziale Status mit dem Wortschatz und der Fähigkeit, komplexe Satzstrukturen zu bilden, korreliert, und wie Kinder aus der Unterschicht oft ein höheres Intelligenzniveau aufweisen müssen, um die sprachbedingten Auslesebarrieren zu überwinden. Doch dieses Buch belässt es nicht bei der Diagnose: Es werden auch Lösungsansätze diskutiert, von kompensatorischen Spracherziehungsprogrammen bis hin zu emanzipatorischen Konzeptionen, die auf eine gezielte Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse abzielen. Es wird argumentiert, dass nur eine ideologiekritische Auseinandersetzung mit Formen des Sprachverhaltens letztlich die kommunikativen Leistungen fördern und Sprachbarrieren abbauen kann. Eine fesselnde Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie Sprache Macht ausübt und wie wir eine gerechtere Gesellschaft schaffen können, in der jeder Mensch seine Stimme findet und Gehör findet, unabhängig von seiner sozialen Herkunft. Tauchen Sie ein in die Welt der Soziolinguistik, der Kommunikationsforschung und der Sozialisationsbedingungen. Erkunden Sie die Variablen Beruf, Erziehung, Einkommen, Gewohnheiten und Lebensgestaltung, die schichtprägend wirken und die Ursachen für die Entstehung unterschiedlicher linguistischer Codes beleuchten. Lassen Sie sich von den Forschungsergebnissen von Lawton, Roeder und Oevermann inspirieren und entdecken Sie die Möglichkeiten zum Abbau von Sprachbarrieren durch eine vernünftige Sprachpolitik und einen sprachemanzipatorischen Unterricht. Dieses Buch ist ein Weckruf, um die subtilen Mechanismen der sozialen Ausgrenzung zu erkennen und aktiv an einer inklusiveren Zukunft mitzuwirken. Es fordert uns heraus, unsere eigenen Sprachmuster zu hinterfragen und uns für eine gerechtere Kommunikation einzusetzen, um die Kluft zwischen den sozialen Schichten zu überbrücken und ein echtes Miteinander zu ermöglichen.
Sprachbarrieren innerhalb der Gesellschaft
Sprachbarrieren
Ein Teilgebiet der Soziolinguistik ist die Erforschung der existierenden Kommunikations- hemmungen zwischen den verschiedenen Schichten einer Gesellschaft. Sprachbarrieren bilden sich aufgrund von Sprachdefiziten; diese werden jedoch erst deutlich und relevant, wenn verschiedene soziale Gruppen aufeinandertreffen. Erste Untersuchungen, die überwiegend empirischen Charakters sind, versuchen, die Ursachen für die Entstehung unterschiedlicher linguistischer Codes zu erklären.
Die notwendig entstehenden Kommunikationsbarrieren sind überwiegend bestimmt durch die kulturellen und sozialen Zusammenhänge bzw. Milieus, in denen der Sprecher aufwächst. In den einzelnen Gesellschaftsschichten herrschen verschiedene Code-Grammatik-Systeme vor, die beim Aufeinandertreffen dieser Gruppen eine differenzierte Kommunikation nicht ohne weiteres ermöglichen. Die möglichen entstehenden Kommunikationsstörungen können sogar bis zum Abbruch des Gespräches führen.
Ausschlaggebende Gründe:
- Existenz verschiedener Sozialisationsformen und Sozialisationsbedingungen Hinzu kommen nach Oevermann die unabwendbaren Variablen:
Beruf, Erziehung, Einkommen, Berufswechsel, Geschwisterzahl, Gewohnheiten, Freizeit und Lebensgestaltung, die schichtprägend wirken.
Die sprachlichen Defizite sind auch aufgrund unterschiedlicher Leistungs-, Funktions- und Schönheitsansprüche signifikant.
Jedoch ist die Kommunikationsleistung in einer großen, vielgliedrigen, arbeitsteiligen Gesellschaft zum Teil begrenzt.
Bei gesellschaftspolitisch anders orientierten Gruppen, deren Jargon Bestandteil des allgemeinen, umgangssprachlichen Kommunikationsverhaltens ist, kann es, aufgrund der unterschiedlichen Äußerungsweisen zu Statuszuweisungen kommen.
Dies ist die Erklärung für die in der Gesellschaft existierenden Unterschiede zwischen der Mittelschicht und Unterschicht.
Sprachbarrieren zeigen sich z.B. als Differenzen in Vokabular, Syntax, Semantik d.h.: Inhalt und Wendung des Wortes und Wortwahl.
Soziologische Untersuchungen, die die Entstehung von Sprachbarrieren erklären:
Bernsteins Theorie der linguistischen Codes:
Behauptung:
1: Existenz von Unterschieden zwischen der Sprache der Mittelschicht und der Unterschicht.
2: Bestehen zweier schichtspezifischer Sprachformen:
Sprachform der Mittelschicht: formale Sprache = elaborierter Code:
Kennzeichen:
1: genaue grammatische Ordnung und Syntax regulieren das Gesagte
2: logische Modifikationen und Betonungen werden durch grammatisch komplexe Satzkonstruktionen, durch die Verwendung von Konjunktionen und Nebensätzen vermittelt.
3: häufige Verwendung von Präpositionen
4: Verwendung der unpersönlichen Fürwörter ,,es" und ,,man"
5: Qualitative Auswahl aus einer Reihe von Adjektiven und Adverbien
Sprachform der Unterschicht: öffentliche Sprache = restringierter Code:
Kennzeichen:
1: kurze, grammatisch einfache und oft unvollständige Sätze von dürftiger syntaktischer Form (elliptische Satzform)
2: einfacherer und sich wiederholender Gebrauch bestimmter Konjunktionen (so, dann, und)
3: geringere Verwendung untergeordneter Sätze, durch die die Kategorien des übergeordneten Subjekts modifiziert werden
4: starrer und begrenzter Gebrauch bestimmter Adjektive und Adverbien
6: seltener Gebrauch von unpersönlichen Fürwörtern
7: große Anzahl von Aussagen und Wendungen, welche das Bedürfnis zeigen, die vorausgehende Sprechsequenz zu verstärken (,,nicht wahr", ,,da sehen Sie")
Auffallen der schichtspezifischen Sprachdefizite:
Der elaborierte Code ist die Sprache der Schule. Für ein Kind aus der Mittelschicht, das bereits in seiner Erziehung auf eine formale Sprache hin ausgerichtet worden ist, bereitet dies keine Schwierigkeiten.
Einem Kind aus der Unterschicht wird es schwerer fallen, dem Unterricht zu folgen. Das Kind wird in die Situation des mechanischen Lernens und Verstehens hineingezwungen. Folge: Zwischen der Erziehung im Elternhaus und Schule entsteht ein Bruch; das Kind kann die Motivation am Lernen verlieren.
Nachfolgeuntersuchungen durch Denis Lawton:
Lawtons Nachforschungen waren darauf angelegt, die theoretischen Ansätze entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.
Seine Untersuchungen waren bezogen auf:
4 Gruppen zu je 5 Jungen im Alter von 12 und 15 Jahren
- 2 Gruppen stammten aus einer Schule aus einem Arbeiterviertel in London
- 2 Gruppen aus einer Privatschule eines mittelständischen Vorortes
Das Sprachverhalten wurde überprüft durch Aufsätze und Satzergänzungstests: Auswertung:
1: Länge des Aufsatzes:
Die Schüler der Mittelschicht schrieben in 30 min bedeutend längere Aufsätze (bei den 15jährigen: 348 : 228 Wörter)
Erklärung für unterschiedlichen Umfang:
Für die Jungen aus der Unterschicht kommt das schriftliche Formulieren einem Übersetzen aus dem restringierten Code in den elaborierten Code gleich (Zeitaufwand).
2: Nebensätze:
Die Jungen aus der Unterschicht verfügen nur über eine geringe Variationsbreite bei der Konstruktion der Nebensätze
3: Passive Verben:
Die Jungen aus der Unterschicht beherrschen die Konstruktion von Verben im Passiv, einem Merkmal des unpersönlichen Stils, nicht so sicher, wie die Jungen der Mittelschicht. Verhältnis: Unterschicht: 35, Mittelschicht: 86
4: Personalpronomen:
Auch hier ist die Mittelschicht der Unterschicht eindeutig überlegen. 5: Adjektive und Adverbien:
Bei der quantitativen Aufzählung der verwendeten Adjektive und Adverbien zeigten sich nur geringe Unterschiede zwischen der Mittelschicht und Unterschicht. Bei den Jungen der Mittelschicht zeigte sich jedoch die Tendenz, verschiedenartige Adjektive und Adverbien abwechslungsreicher zu verwenden.
Analyse des Inhalts:
Thema des Aufsatzes: ,,Mein Leben in zehn Jahren"
Lawton kommt bei der Interpretation zur der Ansicht, daß das Leben der Jungen aus der Unterschicht durch materielle und konkrete Dinge bestimmt ist. =>Diese materiellen Güter sind für die Jungen unmittelbar wichtig (Haus, Kleidung, Geld).
Das Leben und die Gedanken der Jungen aus der Mittelschicht, deren materielle Lebens- situation gesichert ist, sind im Gegensatz dazu überwiegend von Ideen und von der geistigen Verarbeitung der Ereignisse bestimmt.
Auswertung der Gruppendiskussion:
1: Lawton erfährt die Bestätigung seiner Ergebnisse aus der Analyse der Aufsätze in Hinblick auf die Verwendung von Nebensätzen, Verben im Passiv, Personalpronomen, Adjektiven und Adverbien.
2: Unterschiede inbezug auf die Fundierung der Argumentation:
Bei der Unterschicht: Vorherrschen der soziozentrischen Redefolgen (,,Wissen Sie?", ,,Nicht wahr?")
Mittelschicht: Geprägt durch egozentrische Redefolgen (,,Ich denke")
Inhaltsanalyse:
Die Jungen aus der Unterschicht neigten dazu, ihre Argumentation auf Klischees, Anekdoten und konkreten Beispielen auszubauen.
Die Jungen der Mittelschicht gebrauchten überwiegend abstrakte und hypothetische Beispiele, um ihre Argumentation zu stützen.
Gesamtergebnis von Lawtons Untersuchungen:
1: Schichtspezifische Unterschiede im Sprachverhalten sind in der schriftlichen Äußerung größer als in der mündlichen.
2: Nach der Meinung Lawtons herrscht ein Zwiespalt zwischen der normalen sprachlichen Leistung und der möglichen Leistungsfähigkeit der Schüler der Unterschicht.
Er behauptet, daß in der Unterschicht ein großes Potential intellektueller Leistung ruht, das nach bildungsökonomischen Erfordernissen zu nutzen wäre.
Peter Martin Roeder:
Roeder führte die ersten Studien für die Untersuchung eines schichtspezifischen Sprachverhaltens in Deutschland durch. Er beschränkte sich in seinen Forschungen auf schichtspezifische Unterschiede in der Schriftsprache von Kindern am Ende der Grundschulzeit.
Unabhängig von sozialer Herkunft, Intelligenz, Beruf der Eltern, etc. wurden von ihm 523 Kinder des 4. Schuljahres für eine Untersuchung ausgewählt.
Testinhalt:
Den Kindern wurde ein kurzer Stummfilm vorgeführt, dessen Handlung die Kinder danach notieren sollten.
Ergebnis:
Roeder erkannte eine positive Korrelation zwischen Sozialstatus und Wortschatz. Zudem zeigte sich, daß die Kinder um so häufiger hypotaktische Satzgefüge (Kausalsätze, Lokalsätze, Attributivsätze) verwendeten, je höher der soziale Status der Eltern war. Roeder deutete diese Ergebnisse dahingehend, daß diese Kinder die größere Fähigkeit haben, in ihren Wahrnehmungsstrategien Beziehungen besser zu erfassen und darzustellen. Roeder stellte fest, daß die Differenzierung nach Schultyp wahrscheinlich zur Stabilisierung der spezifischen Sprachmerkmale der jeweiligen Sozialschichten beiträgt. Deshalb fordert er eine Veränderung der Institution Schule, um jedem Kind sein Recht auf eine optimale Entfaltung seiner Fähigkeiten zu gewähren und um der hohen Korrelation zwischen Status und Bildungschancen entgegenzuwirken.
Ulrich Oevermann:
Ziel der Untersuchung: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sprache und sozialer Herkunft?
Bei seinen Untersuchungen stützte sich Oevermann auf verschiedene Variablen:
1: Unabhängige Variablen:
Soziale Hintergrunddaten wie Beruf und Erziehung der Eltern, Einkommen, Berufswechsel, Geschwisterzahl, Lebensgewohnheiten, usw..
2: Kontrollvariablen:
Gemessene Intelligenz in Form einer ,,Maßzahl" anhand von verbaler Intelligenz, nicht-verbaler Intelligenz sowie Sozialisationseffekt der Schule
3: Abhängige Variablen
Die Indikatoren des Sprachverhaltens, die anhand von schriftlichen Aufsätzen ermittelt wurden Untersuchung von 109 Kindern zwischen 11 und 13 Jahren, die aus einem breiten Spektrum sozialer Schichten (Unterschicht bis obere Mittelschicht) stammten.
Analyse der Intelligenztestwerte:
Im Gegensatz zu repräsentativen Untersuchungen, die einen positiven Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischem Status und Intelligenz bestätigten, ergab sich in dieser Untersuchung:
,,Je höher der sozio-ökonomische Status, desto geringer die Intelligenz".
Dies bedeutet, daß Schüler der Unterschicht ein erheblich höheres Intelligenzniveau aufweisen müssen als die der Mittelschicht, um die intelligenzunabhängigen Auslesebarrieren zu überwinden. Diese Schüler müssen intellektuell ihren Altersgenossen aus der Mittelschicht überlegen sein, wenn sie an denselben Ausbildungsprozessen teilnehmen wollen wie diese.
Linguistische Analyse der schriftlichen Arbeiten:
Oevermann ging von 5 theoretischen Kriterien aus, um das schichtspezifische Sprachverhalten zu untersuchen.
1: Komplexität der syntaktischen und grammatischen Konstruktionen gegliedert in:
a) Komplexität der Satzbeziehungen
b) Komplexität innerhalb der Satzgerüste
2: Differenzierte Erfassung struktureller Zusammenhänge in der Objektwelt gegenüber isolierter, konkretisierter Bezeichnung und Aneinanderreihung von Sachverhalten
3: Individuierter, hervorgehobener Sprachgebrauch durch explizite Bedeutungsspezifizierung und Interpretation innerer Zustände
4: Individuierter Sprachgebrauch durch Signalisierung subjektiver Intentionen 5: Abstraktionsniveau
Ergebnis:
Es ergaben sich schichtspezifische Unterschiede inbezug auf die Anzahl der Wörter pro Satzeinheit.
Die Kinder der Unterschicht hatten bedeutend weniger Satzgerüste zu komplexen Satzeinheiten verknüpft.
Oevermann hat folgende prägnante Aussage über die Schüler der Unterschicht vorgelegt:
Die syntaktische Organisation der Aufsätze der Kinder der Unterschicht ist weniger komplex, weil sie vornehmlich einfache Hauptsätze enthalten und in ihrem Satzgefüge wenig durch Subordination erster oder höherer Ordnung gegliedert sind. Im Vergleich zur Mittelschicht haben die Kinder der Unterschicht deutlich weniger Relativsätze verwendet; falls Nebensätze konstruiert wurden, so handelte es sich überwiegend konjunktional eingeleitete notwendige Ergänzungen des Hauptsatzes.
Die bei den Kindern der Unterschicht vorherrschende Tendenz zu einer mehr statischen, bloß abbildenden, konkreten Beschreibung führt zu einer häufigen Verwendung von Substantiven, Adjektiven und Adverbien, die jedoch nur im begrenzten Maße zur Verfügung stehen. Allerdings kommt in den Aufsätzen ein relativ reichhaltiger und nicht zu oft wiederholter Wortschatz zum Vorschein.
Bei der Unterschicht stehen soziozentrische Redefolgen bei der inhaltlichen Analyse im Vordergrund; d.h. es erfolgt eine Identifikation mit einer Bezugsgruppe, eigene Intentionen finden sich nur selten in ihrem sprachlichen Ausdruck in prägnanten Verben und Adjektiven.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Oevermannschen Untersuchungen im großen und ganzen die Theorien des linguistischen Codes von Bernstein bestätigen.
Möglichkeiten zum Abbau von Sprachbarrieren und eine vernünftige Sprachpolitik:
Anmerkungen zum sprachpolitischen Thema, zu Fragen sprachkompensatorischen und sprachemanzipatorischen Unterrichts.
Es geht dabei um den Komplex ,,Überwindung oder Abbau von Sprachbarrieren", um ,,soziale Chancenungleichheit", die über spracherzieherische Maßnahmen ausgeglichen werden sollen.
Der unglückliche Terminus ,,Sprachbarrieren" trug allerdings nicht unerheblich dazu bei, darüber hinwegzutäuschen, daß Differenzen des Sprachverhaltens einen sekundären Aspekt sozialer Schranken oder Barrieren darstellen. Primär sind in jedem Fall die sozio- ökonomischen Verhältnisse, das Sozialisationsmilieu, in denen ein Kind aufwächst.
Kompensatorische Spracherziehungsprogramme in der Schule versuchen, das Sprachverhalten von Unterschicht- oder Arbeiterkindern den in unseren Schulen erwarteten und geforderten Kodierungsmöglichkeiten anzugleichen.
Von diesem Ansatz aus werden auch schon die Gefahren, die Mängel und die Fragwürdigkeiten kompensatorischer Versuche offenbar: Sie sind immanent von dem Vorurteil bestimmt, das Sprachverhalten der Unterschichtskinder sei defekt, defizitär oder depraviert und diese Mängel (und damit auch die sozialen Benachteiligungen) könnten durch formales Sprachtraining bereinigt werden.
Aber der fehlgeleitete theoretische Ansatz verurteilt kompensatorische Spracherziehungs- programme nicht nur zur Erfolglosigkeit, was den Abbau bestehender Chancenungleichheiten betrifft; sprachkompensatorische Programme sind darüber hinaus eher geeignet, bestehende soziale Differenzierungen zu verfestigen und entsprechende Vorurteilsstrukturen zu erhärten: zum Beispiel werden durch die, beim formalen Sprachunterricht unausbleiblich mit- vermittelten Inhalte den Kindern bestehende Wertordnungen und damit auch eine Minderbewertung der eigenen sozialen Verhältnisse mitgeliefert. Für das Kind kann sich hieraus eine unlösbare Konfliktsituation ergeben: Die ihm auf diese Weise kraft Autorität der Schule nahegelegten Wertmaßstäbe müssen es notwendig seiner eigenen natürlichen Umgebung, seinem Sozialisationsmilieu, also seiner Familie entfremden, in der es ja doch weiterhin existieren muß.
Die kritische Einsicht in diese Mechanismen kompensatorischer Spracherziehung liegt emanzipatorischen Konzeptionen zugrunde; ihr auf der Basis engagierter Gesellschaftskritik konstatiertes Ziel ist die Überwindung bestehender sozialer Ungerechtigkeiten nicht etwa durch Anpassung an bestehende Verhältnisse, sondern durch deren gezielte Veränderung. Das formulierte Ziel emanzipierter Sprachschulung lautet folglich:
,,Sprachschulung muß die Fähigkeit zu genauer und verbal angemessener Darstellung gesellschaftlicher Situationen fördern, Sprachschulung muß als solidarisierendes Moment die Möglichkeit und Notwendigkeit der Änderung gesellschaftlicher Praxis aufzeigen."
Natürlich ist - vorausgesetzt, die emanzipatorischen Versuche haben den gewünschten Erfolg - allein die Fähigkeit des Schülers, die Gründe sozialer Differenzierung und Schranken oder etwa die Ursachen von Kommunikationsstörungen zu verbalisieren und damit durchschaubar zu machen, als wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Überwindung eben dieser Schranken zur Veränderung bestehender Verhältnisse zu werten.
Allein die Fähigkeit einer ideologiekritischen Auseinandersetzung mit Formen des Sprachverhaltens kann letztlich die kommunikativen Leistungen fördern und Sprachbarrieren abbauen.
Handout zum Referat zum Thema: ,,Sprachbarrieren"
Sprachbarrieren bilden sich aufgrund von Sprachdefiziten, welche dann relevant werden, wenn verschiedene soziale Gruppen aufeinandertreffen. Sprachbarrieren zeigen sich so z.B. als Differenzen im Vokabular, in Syntax und Semantik. Ausschlaggebende Gründe für das Vorhandensein von Sprachbarrieren sind zum ersten die Existenz verschiedener Sozialisationsformen und Sozialisationsbedingungen. Hinzu kommen nach Oevermann die unabwendbaren Variablen Beruf, Erziehung, Einkommen, Berufswechsel, Geschwisterzahl, Gewohnheiten, Freizeit und Lebensgestaltung, die sich schichtprägend auswirken. Soziologische Untersuchungen, die die Entstehung von Sprachbarrieren zu erklären versuchen.
I ) Bernsteins Theorie der linguistischen Codes:
Es bestehen zwei schichtspezifische Sprachformen:
a)die Sprachform der Mittelschicht: formale Sprache = elaborierter Code: (Kennzeichen
b)die Sprachform der Unterschicht: öffentliche Sprache = restringierter Code: =>Referat)
II) Nachfolgeuntersuchungen durch Denis Lawton:
Das Ziel von Lawtons Nachforschungen war es, Bernsteins theoretische Ansätze zu überprüfen. Die Untersuchung der Aufsätze ergab formale Unterschiede inbezug auf: Länge des Aufsatzes, Nebensätze, Passive Verben, Adjektive und Adverbien: Inhaltsanalyse: Unterschicht: konkrete, materielle Dinge (Haus, Kleidung, Geld).
Mittelschicht: bestimmt durch abstrakte Gedanken und geistige Verarbeitung
Gruppendiskussion: Unterschiede bezüglich der Fundierung der Argumentation: Unterschicht: soziozentrische Redefolgen (,,Wissen Sie?", ,,,Nicht wahr?") Mittelschicht: egozentrische Redefolgen (,,Ich denke").
Gesamtergebnis von Lawtons Untersuchungen: Schichtspezifische Unterschiede im Sprachverhalten sind in der schriftlichen Äußerung größer als in der mündlichen.
III) Peter Martin Roeder: (erste Studien in Deutschland)
Ergebnis: Roeder erkannte eine positive Korrelation zwischen sozialem Status und Wortschatz. Roeder stellte fest, daß die Differenzierung nach Schultyp wahrscheinlich zur Stabilisierung der spezifischen Sprachmerkmale der jeweiligen Sozialschicht beitrug. Deshalb forderte er eine Veränderung der Institution Schule, um jedem Kind das Recht auf eine optimale Entfaltung seiner Fähigkeiten zu gewähren.
IV) Ulrich Oevermann: (stützt seine Untersuchungen auf verschiedene Variablen, s.o.:)
Im Gegensatz zu repräsentativen Untersuchungen, die einen positiven Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischem Status und Intelligenz bestätigten, ergab diese Untersuchung folgendes Resultat: ,,Je höher der sozio-ökonomische Status, desto geringer ist die Intelligenz". Dies bedeutet, daß Schüler der Unterschicht ein erheblich höheres Intelligenzniveau aufweisen müssen als die der Mittelschicht, um die intelligenzunabhängigen Auslesebarrieren zu über-winden. Diese Schüler müssen intellektuell ihren Altersgenossen aus der Mittelschicht überlegen sein, wenn sie an denselben Ausbildungsprozessen teilnehmen wollen wie diese.
Linguistische Analyse der schriftlichen Arbeiten:
Ergebnis: Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Oevermannschen Untersuchungen im großen und ganzen die Theorien des linguistischen Codes von Bernstein bestätigen. Möglichkeiten zum Abbau von Sprachbarrieren:
Primär von Bedeutung ist das Sozialisationsmilieu, in dem ein Kind aufwächst.
Kompensatorische Spracherziehungsprogramme versuchen, die Sprache den in der Schule geforderten Kodierungsmöglichkeiten anzupassen. Es besteht die Gefahr der Entfremdung des Kindes von dem eigenen Sozialisationsmilieu, da die eigene Sprache als defizitär dargestellt wird. K.S. sind fundiert auf emanzipatorischen Konzeptionen, deren Ziel die Überwindung bestehender sozialer Ungerechtigkeiten nicht etwa durch Anpassung an bestehende Verhältnisse, sondern durch deren gezielte Veränderung ist.
Resultat:
Häufig gestellte Fragen zu Sprachbarrieren innerhalb der Gesellschaft
Was sind Sprachbarrieren?
Sprachbarrieren sind Kommunikationshemmungen, die zwischen verschiedenen Schichten einer Gesellschaft aufgrund von Sprachdefiziten entstehen. Diese Defizite werden erst dann relevant, wenn unterschiedliche soziale Gruppen miteinander interagieren.
Welche Gründe sind ausschlaggebend für die Entstehung von Sprachbarrieren?
Verschiedene Sozialisationsformen und -bedingungen sind ausschlaggebend. Hinzu kommen Faktoren wie Beruf, Erziehung, Einkommen, Berufswechsel, Geschwisterzahl, Gewohnheiten, Freizeit und Lebensgestaltung, die schichtprägend wirken. Unterschiedliche Leistungs-, Funktions- und Schönheitsansprüche spielen ebenfalls eine Rolle.
Wie äußern sich Sprachbarrieren?
Sprachbarrieren manifestieren sich als Differenzen in Vokabular, Syntax, Semantik (Inhalt und Wendung des Wortes) und Wortwahl.
Was ist Bernsteins Theorie der linguistischen Codes?
Bernsteins Theorie besagt, dass es Unterschiede zwischen der Sprache der Mittelschicht und der Unterschicht gibt. Er postuliert zwei schichtspezifische Sprachformen: den elaborierten Code (Sprache der Mittelschicht) und den restringierten Code (Sprache der Unterschicht).
Was sind die Kennzeichen des elaborierten Codes (Sprache der Mittelschicht)?
Der elaborierte Code zeichnet sich durch genaue grammatische Ordnung und Syntax, logische Modifikationen und Betonungen durch komplexe Satzkonstruktionen, häufige Verwendung von Präpositionen, unpersönliche Fürwörter ("es", "man") und eine qualitative Auswahl aus Adjektiven und Adverbien aus.
Was sind die Kennzeichen des restringierten Codes (Sprache der Unterschicht)?
Der restringierte Code ist gekennzeichnet durch kurze, grammatisch einfache und oft unvollständige Sätze von dürftiger syntaktischer Form (elliptische Satzform), einfacher und sich wiederholender Gebrauch bestimmter Konjunktionen (so, dann, und), geringere Verwendung untergeordneter Sätze, starrer und begrenzter Gebrauch bestimmter Adjektive und Adverbien, seltener Gebrauch von unpersönlichen Fürwörtern und eine große Anzahl von Aussagen und Wendungen, die das Bedürfnis zeigen, die vorausgehende Sprechsequenz zu verstärken ("nicht wahr", "da sehen Sie").
Wie fallen schichtspezifische Sprachdefizite auf?
Der elaborierte Code ist die Sprache der Schule. Kinder aus der Mittelschicht haben hier einen Vorteil, während Kinder aus der Unterschicht Schwierigkeiten haben können, dem Unterricht zu folgen. Dies kann zu mechanischem Lernen, einem Bruch zwischen Erziehung im Elternhaus und Schule und einem Verlust der Lernmotivation führen.
Was hat Denis Lawton in seinen Nachfolgeuntersuchungen herausgefunden?
Lawton bestätigte Bernsteins Theorie. Er fand heraus, dass Schüler der Mittelschicht längere Aufsätze schreiben, eine größere Variationsbreite bei Nebensätzen haben und Verben im Passiv besser beherrschen. Auch die Verwendung von Personalpronomen ist bei der Mittelschicht ausgeprägter. Inhaltlich sind die Gedanken der Mittelschicht stärker von Ideen und geistiger Verarbeitung geprägt, während die der Unterschicht sich auf konkrete, materielle Dinge beziehen. Bei Gruppendiskussionen überwiegen in der Unterschicht soziozentrische Redefolgen, in der Mittelschicht egozentrische Redefolgen.
Was hat Peter Martin Roeder in seinen Studien herausgefunden?
Roeder erkannte eine positive Korrelation zwischen sozialem Status und Wortschatz. Er stellte fest, dass die Differenzierung nach Schultyp zur Stabilisierung der spezifischen Sprachmerkmale der jeweiligen Sozialschichten beiträgt. Er forderte eine Veränderung der Institution Schule, um jedem Kind sein Recht auf eine optimale Entfaltung seiner Fähigkeiten zu gewähren.
Was war das Ziel von Ulrich Oevermanns Untersuchung?
Oevermann untersuchte, ob es einen Zusammenhang zwischen Sprache und sozialer Herkunft gibt. Er stützte sich auf Variablen wie soziale Hintergrunddaten, Intelligenz und Indikatoren des Sprachverhaltens. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen fand er heraus, dass je höher der sozioökonomische Status, desto geringer die Intelligenz.
Welches Ergebnis erzielte Oevermann bei der linguistischen Analyse der schriftlichen Arbeiten?
Oevermann stellte fest, dass Kinder der Unterschicht weniger komplexe Satzeinheiten verknüpfen. Ihre Aufsätze enthalten vornehmlich einfache Hauptsätze und wenig Subordination. Die Kinder der Unterschicht verwenden weniger Relativsätze und tendieren zu einer statischen, abbildenden Beschreibung, was zu einer häufigen Verwendung von Substantiven, Adjektiven und Adverbien führt. Seine Ergebnisse bestätigen im Großen und Ganzen die Theorien von Bernstein.
Welche Möglichkeiten gibt es, Sprachbarrieren abzubauen?
Kompensatorische Spracherziehungsprogramme versuchen, das Sprachverhalten von Unterschichtkindern anzupassen, bergen aber die Gefahr, bestehende soziale Differenzierungen zu verfestigen und Vorurteilsstrukturen zu erhärten. Emanzipatorische Konzeptionen zielen auf die Überwindung bestehender sozialer Ungerechtigkeiten durch Veränderung der Verhältnisse ab. Die Fähigkeit einer ideologiekritischen Auseinandersetzung mit Formen des Sprachverhaltens kann kommunikative Leistungen fördern und Sprachbarrieren abbauen.
- Quote paper
- Peter Mueller (Author), 2000, Sprachbarrieren innerhalb der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99243