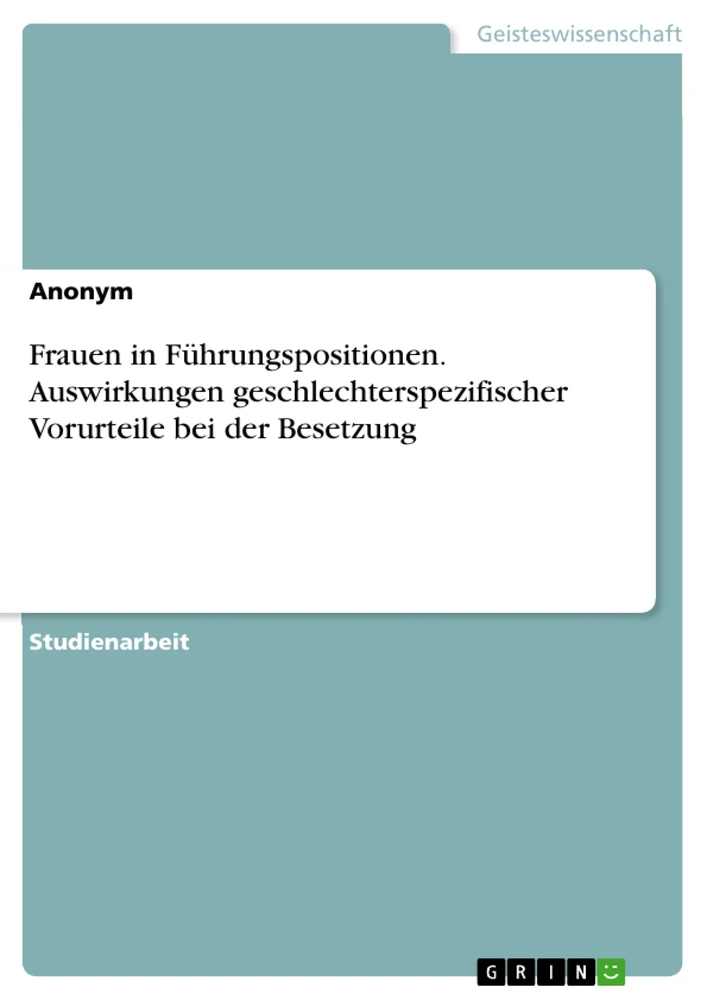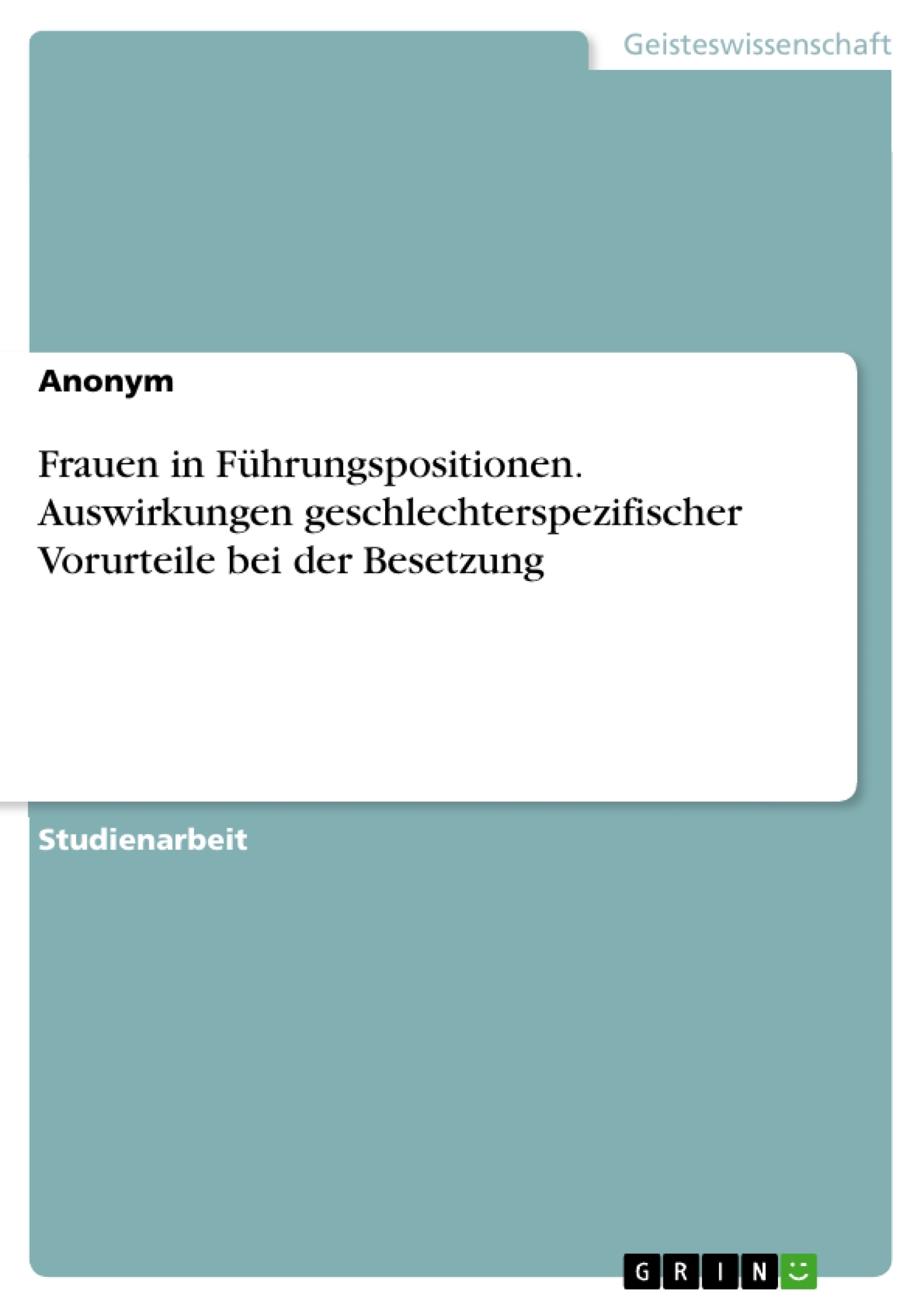In dieser Hausarbeit wird untersucht, ob diese Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen etwa auf mangelnde Kompetenzen oder eher gesellschaftliche Ressentiments bzw. Vorurteile zurückzuführen ist, wobei der Schwerpunkt auf Letzterem liegt. Daher ist die Hausarbeit so konzipiert, dass zunächst erklärt wird, was unter Vorurteilen zu verstehen ist und wie sie entstanden sind. In diesem Zusammenhang wird auch untersucht, was die Nachteile solcher Vorurteile sind, aber auch, ob sie mögliche Vorteile mit sich bringen.
Anschließend wird konkret auf geschlechterspezifische Vorurteile, deren Nachweisbarkeit sowie deren Folgen im Bezug zur Auswahl und Besetzung von Führungskräften eingegangen. Zur Veranschaulichung der Folgen werden drei Fallbeispiele dargestellt. Im Anschluss daran werden dann mögliche Maßnahmen zum Abbau geschlechterspezifischer Vorurteile dargestellt. Vor dem abschließenden Fazit und Ausblick erfolgt eine Diskussion über das Verfasste.
Im Jahre 2016 wurde eine gesetzliche Frauenquote für die Wirtschaft von Seiten der Politik eingeführt. Allerdings beschränkte sich diese auf nur 30% der Aufsichtsräte von 108 börsenorientierten Firmen. Dennoch stieß der Gesetzesentwurf damals auf viel Kritik und wurde entsprechend kontrovers diskutiert. Nach Inkrafttreten des Gesetzes stieg der Frauenanteil in Führungspositionen erwartungsgemäß an. Trotzdem sind Frauen in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert obwohl es rund eine Millionen mehr Frauen als Männer hierzulande gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen Vorurteile
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.2 Entstehung und Entwicklung
- 2.3 Vorteile
- 2.4 Nachteile
- 3. Darlegung und Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile
- 3.1 Darlegung geschlechterspezifische Vorurteile
- 3.2 Nachweisbarkeit geschlechterspezifische Vorurteile
- 4. Folgen geschlechterspezifischer Vorurteile bei der Besetzung von Führungskräften
- 4.1 Fallbeispiele
- 5. Maßnahmen zum Abbau geschlechterspezifischer Vorurteile
- 5.1 Persönlichkeitstheoretische Konzepte
- 5.2 Kognitionstheoretische Konzepte
- 5.3 Einstellungstheoretische Konzepte
- 5.4 Lerntheoretische Konzepte
- 5.5 Sozial-kognitiv Intergruppen- Konzepte
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen. Die Zielsetzung besteht darin zu analysieren, inwieweit geschlechterspezifische Vorurteile zu dieser Ungleichheit beitragen. Es werden theoretische Grundlagen zu Vorurteilen erläutert und die Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Folgen dieser Vorurteile und skizziert mögliche Maßnahmen zu deren Abbau.
- Definition und Entstehung von Vorurteilen
- Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile
- Folgen von Vorurteilen für die Besetzung von Führungspositionen
- Mögliche Maßnahmen zum Abbau geschlechterspezifischer Vorurteile
- Diskussion der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Einführung der Frauenquote im Jahr 2016 und die weiterhin bestehende Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen trotz dieser Maßnahme. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen dieser Ungleichheit – mangelnde Kompetenzen oder gesellschaftliche Vorurteile – und skizziert den Aufbau der Hausarbeit, der sich auf die Analyse von Vorurteilen konzentriert.
2. Theoretische Grundlagen Vorurteile: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Vorurteil“ und differenziert zwischen kognitiver, affektiver und verhaltensbezogener Komponente. Es werden verschiedene Theorien zur Entstehung und Entwicklung von Vorurteilen diskutiert, wobei der Fokus auf der Verbindung von gesellschaftlichen Strukturen, kognitiven Prozessen und Persönlichkeitsmerkmalen liegt. Die Diskussion möglicher Vorteile und Nachteile von Vorurteilen rundet den Abschnitt ab.
3. Darlegung und Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile: Dieser Abschnitt befasst sich gezielt mit geschlechterspezifischen Vorurteilen. Er legt diese detailliert dar und untersucht verschiedene Methoden zu deren Nachweisbarkeit. Die Kapitelteile beleuchten die komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Normen, individuellen Einstellungen und beobachtbarem Verhalten.
4. Folgen geschlechterspezifischer Vorurteile bei der Besetzung von Führungskräften: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Folgen geschlechterspezifischer Vorurteile bei der Auswahl und Besetzung von Führungspositionen. Anhand von Fallbeispielen wird veranschaulicht, wie diese Vorurteile sich auf die Karriere von Frauen auswirken. Der Abschnitt zeigt auf, wie Stereotype und implizite Vorurteile zu Benachteiligung führen können.
5. Maßnahmen zum Abbau geschlechterspezifischer Vorurteile: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Ansätzen zur Reduzierung geschlechterspezifischer Vorurteile. Es werden Konzepte aus der Persönlichkeitstheorie, Kognitionstheorie, Einstellungstheorie, Lerntheorie und sozial-kognitiven Intergruppen-Theorien vorgestellt und deren jeweilige Relevanz für den Abbau von Vorurteilen erörtert. Die Kapitelteile analysieren die Potenziale und Grenzen dieser Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Geschlechterspezifische Vorurteile, Frauen in Führungspositionen, Frauenquote, Stereotype, Diskriminierung, soziale Rollen, kognitive Prozesse, Maßnahmen zur Gleichstellung, Persönlichkeitstheorie, Kognitionstheorie, Einstellungstheorie, Lerntheorie, Sozial-kognitive Intergruppen-Theorien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Geschlechtervorurteile und Frauen in Führungspositionen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen und analysiert, inwieweit geschlechterspezifische Vorurteile zu dieser Ungleichheit beitragen. Sie beleuchtet theoretische Grundlagen zu Vorurteilen, deren Nachweisbarkeit und die Folgen für die Besetzung von Führungspositionen. Schließlich skizziert sie mögliche Maßnahmen zum Abbau dieser Vorurteile.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entstehung von Vorurteilen, Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile, Folgen von Vorurteilen für die Besetzung von Führungspositionen, mögliche Maßnahmen zum Abbau geschlechterspezifischer Vorurteile und eine Diskussion der Ergebnisse. Sie umfasst theoretische Grundlagen, Fallbeispiele und verschiedene Ansätze zur Reduzierung von Vorurteilen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) beleuchtet die Frauenquote und die weiterhin bestehende Ungleichheit. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen Vorurteile) liefert eine umfassende Definition von Vorurteilen und diskutiert Theorien zu ihrer Entstehung und Entwicklung. Kapitel 3 (Darlegung und Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile) legt geschlechterspezifische Vorurteile dar und untersucht Methoden zu deren Nachweis. Kapitel 4 (Folgen geschlechterspezifischer Vorurteile bei der Besetzung von Führungskräften) analysiert die Folgen dieser Vorurteile anhand von Fallbeispielen. Kapitel 5 (Maßnahmen zum Abbau geschlechterspezifischer Vorurteile) stellt verschiedene Ansätze zur Reduzierung von Vorurteilen vor (Persönlichkeitstheorie, Kognitionstheorie, Einstellungstheorie, Lerntheorie, sozial-kognitive Intergruppen-Theorien). Kapitel 6 (Diskussion) fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Implikationen.
Welche Theorien werden in der Hausarbeit herangezogen?
Die Hausarbeit bezieht verschiedene Theorien ein, darunter Konzepte aus der Persönlichkeitstheorie, Kognitionstheorie, Einstellungstheorie, Lerntheorie und sozial-kognitiven Intergruppen-Theorien, um die Entstehung, Aufrechterhaltung und den Abbau von geschlechterspezifischen Vorurteilen zu erklären.
Welche Methoden zur Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile werden diskutiert?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Methoden, um die Nachweisbarkeit geschlechterspezifischer Vorurteile zu beleuchten. Diese Methoden werden im Kapitel 3 detailliert beschrieben und analysieren die komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Normen, individuellen Einstellungen und beobachtbarem Verhalten.
Welche Maßnahmen zur Reduzierung geschlechterspezifischer Vorurteile werden vorgeschlagen?
Die Hausarbeit präsentiert verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung geschlechterspezifischer Vorurteile, die auf Konzepte aus der Persönlichkeitstheorie, Kognitionstheorie, Einstellungstheorie, Lerntheorie und sozial-kognitiven Intergruppen-Theorien basieren. Die Arbeit analysiert das Potential und die Grenzen dieser Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechterspezifische Vorurteile, Frauen in Führungspositionen, Frauenquote, Stereotype, Diskriminierung, soziale Rollen, kognitive Prozesse, Maßnahmen zur Gleichstellung, Persönlichkeitstheorie, Kognitionstheorie, Einstellungstheorie, Lerntheorie, Sozial-kognitive Intergruppen-Theorien.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Frauen in Führungspositionen. Auswirkungen geschlechterspezifischer Vorurteile bei der Besetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992327