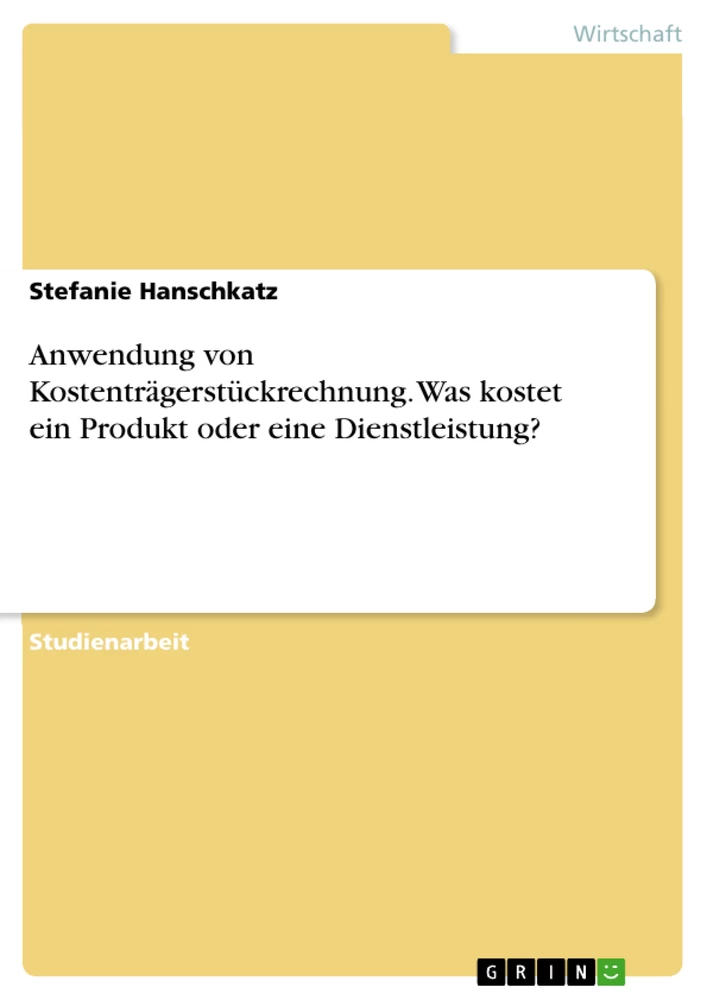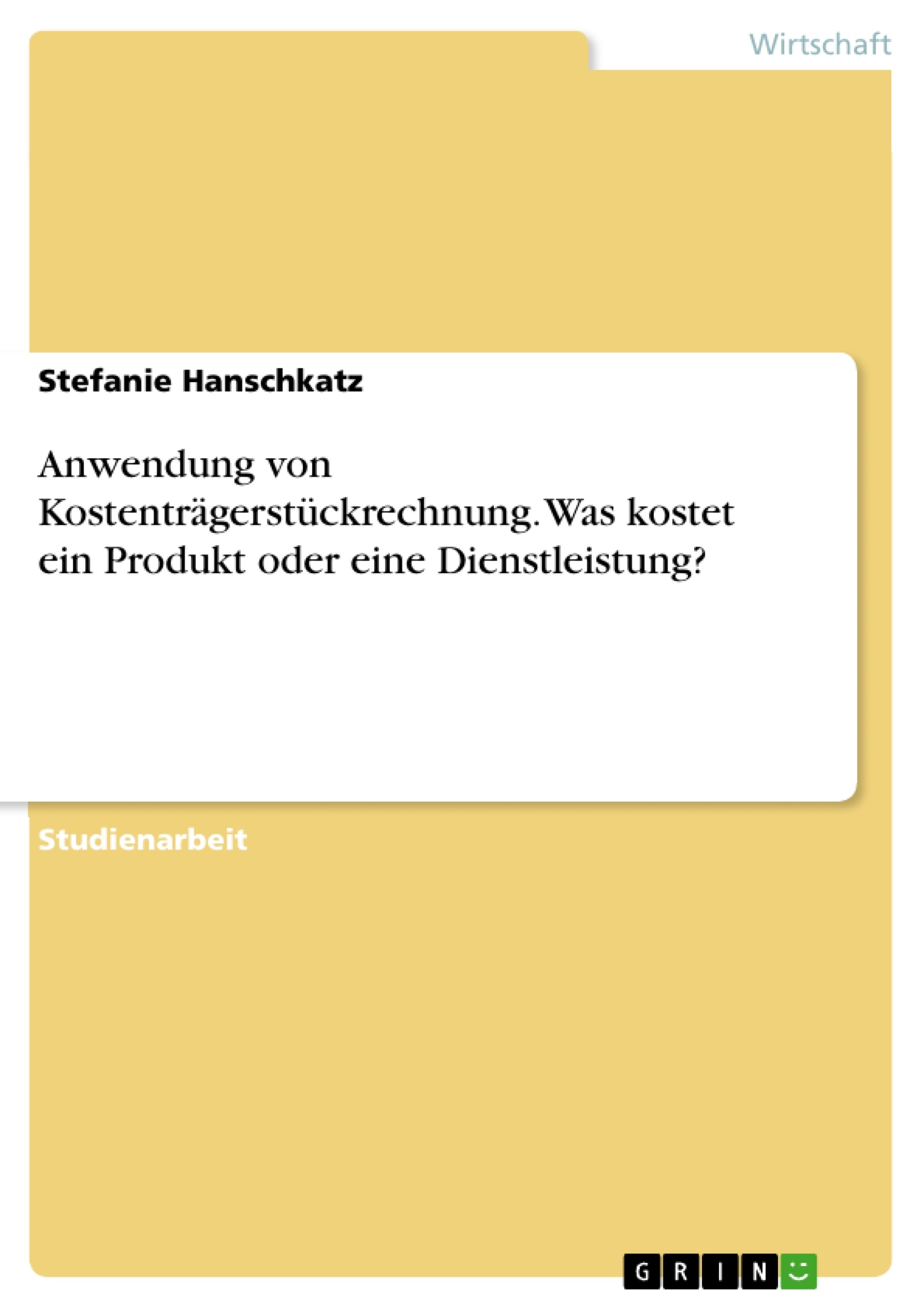Welche Kosten werden in der Kalkulation der Kostenträgerrechnung untersucht, die für Produkte oder Dienstleistungen im Unternehmen anfallen? Diese Fragestellung soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Dazu sollen die grundlegenden Verfahren der Kostenträgerrechnung geschildert werden, insbesondere die Kostenträgerstückrechnung. Anhand eines praktischen Kalkulationsbeispiels wird das Verfahren der Zuschlagskalkulation eingehender beschrieben. Hier sollen praktische Anwendungsmöglichkeiten beleuchtet werden, die sich insbesondere den unterschiedlichen Verfahrensweisen von Theorie und Praxis widmen.
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein unverzichtbares Teilgebiet der betrieblichen Unternehmensführung. Hierin findet sich die Quelle wertvoller kostenmäßiger Informationen, welche die Prozesse in Unternehmen darstellen und es ermöglichen diese zu steuern. Die Kostenträgerrechnung ist die dritte Stufe der Kostenrechnung, nachdem in einem ersten Schritt die Kosten erfasst (Kostenartenrechnung) und in einem zweiten Kosten-stellen zugeordnet wurden (Kostenstellenrechnung). Die Kostenträgerrechnung lässt sich in Kostenträgerzeit und Kostenträgerstückrechnung abgrenzen. Die Kostenträgerzeitrechnung (auch Betriebsergebniskalkulation ) ermittelt angefallene Kosten, beziehungsweise Leistungen in einem bestimmten Zeitraum, wie Quartale oder Monate. Ziel ist dabei die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses in diesem gewählten Zeitrahmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kostenträgerstückrechnung
- Divisionskalkulation
- Zuschlagskalkulation
- Fazit
- Anwendungsbeispiel Messeproduktion
- Auswahl geeigneter Kalkulationsverfahren
- Praktische Anwendung
- Fazit
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kostenrechnung, insbesondere die Kostenträgerstückrechnung, als unverzichtbares Werkzeug der Unternehmensführung. Ziel ist es, grundlegende Verfahren der Kostenträgerrechnung zu erläutern und anhand eines Praxisbeispiels die Anwendung der Zuschlagskalkulation zu veranschaulichen. Die Arbeit beleuchtet dabei die Unterschiede zwischen theoretischen Verfahren und praktischer Anwendung.
- Die Bedeutung der Kosten- und Leistungsrechnung für die Unternehmensführung
- Die verschiedenen Verfahren der Kostenträgerrechnung (Kostenträgerzeit- und Kostenträgerstückrechnung)
- Die Anwendung der Zuschlagskalkulation in der Praxis
- Vergleich von Theorie und Praxis bei der Kalkulation
- Wirtschaftlichkeitsüberprüfung durch Kostenrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kosten- und Leistungsrechnung als essentiellem Bestandteil der betrieblichen Unternehmensführung ein. Sie betont die Bedeutung kostenmäßiger Informationen für die Steuerung von Unternehmensprozessen und benennt die Kalkulation als Methode zur Ermittlung der Produkt- und Dienstleistungskosten. Die Arbeit kündigt die Erläuterung grundlegender Kostenträgerrechnungsverfahren an, insbesondere der Kostenträgerstückrechnung, und die detaillierte Darstellung der Zuschlagskalkulation anhand eines praktischen Beispiels, wobei der Fokus auf der praktischen Anwendbarkeit und dem Vergleich zwischen Theorie und Praxis liegt.
Kostenträgerstückrechnung: Dieses Kapitel beschreibt die Kostenträgerrechnung als dritte Stufe der Kostenrechnung nach Kostenarten- und Kostenstellenrechnung. Es differenziert zwischen Kostenträgerzeit- und Kostenträgerstückrechnung, wobei letztere die Kosten pro Stück ermittelt und für Preisfindung und Wirtschaftlichkeitsüberprüfung genutzt wird. Das Kapitel erklärt die verschiedenen Kalkulationsarten (Vorkalkulation, Zwischenkalkulation, Nachkalkulation) und deren jeweilige Bedeutung für die Kostenkontrolle und -planung. Die Verortung dieser Instrumente innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung wird anhand einer Abbildung verdeutlicht. Die Erläuterung der verschiedenen Kalkulationszeitpunkte unterstreicht die dynamische Natur der Kostenrechnung und deren Anpassungsfähigkeit an verschiedene Produktionsprozesse.
Anwendungsbeispiel Messeproduktion: Dieses Kapitel wendet die im vorherigen Kapitel erläuterten Verfahren auf ein konkretes Praxisbeispiel – die Messeproduktion – an. Es beschreibt die Auswahl geeigneter Kalkulationsmethoden für diesen Kontext und zeigt die praktische Anwendung der ausgewählten Verfahren. Der Abschnitt erläutert die jeweiligen Schritte der Kalkulation detailliert und analysiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Messeproduktion. Der Vergleich der theoretischen Grundlagen mit der konkreten Umsetzung in der Praxis liefert wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Besonderheiten der Kostenrechnung im realen Kontext. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für das Kapitel "Schlussbetrachtung und Ausblick".
Schlüsselwörter
Kostenträgerstückrechnung, Zuschlagskalkulation, Kostenrechnung, Kalkulation, Unternehmensführung, Wirtschaftlichkeit, Preisfindung, Vorkalkulation, Zwischenkalkulation, Nachkalkulation, Kostenkontrolle, Praxisbeispiel, Messeproduktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Kostenträgerstückrechnung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Kostenträgerstückrechnung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erklärung grundlegender Verfahren der Kostenträgerrechnung und deren Anwendung anhand eines Praxisbeispiels (Messeproduktion).
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Kostenrechnung, insbesondere die Kostenträgerstückrechnung, als wichtiges Instrument der Unternehmensführung. Es erklärt verschiedene Verfahren der Kostenträgerrechnung (Divisionskalkulation, Zuschlagskalkulation), deren Anwendung in der Praxis, insbesondere im Kontext der Messeproduktion, und den Vergleich zwischen Theorie und Praxis. Die Bedeutung der Kostenrechnung für die Preisfindung und Wirtschaftlichkeitsüberprüfung wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Arten der Kalkulation werden erklärt?
Das Dokument erklärt die Kostenträgerstückrechnung im Detail und unterscheidet zwischen verschiedenen Kalkulationsarten: Vorkalkulation, Zwischenkalkulation und Nachkalkulation. Es beschreibt auch die Zuschlagskalkulation als ein spezifisches Verfahren der Kostenträgerstückrechnung und veranschaulicht deren Anwendung anhand eines Praxisbeispiels.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Als Praxisbeispiel wird die Messeproduktion verwendet. Das Dokument zeigt, wie geeignete Kalkulationsmethoden für diesen Kontext ausgewählt und angewendet werden, und analysiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, grundlegende Verfahren der Kostenträgerrechnung zu erläutern und die Anwendung der Zuschlagskalkulation anhand eines Praxisbeispiels zu veranschaulichen. Es möchte die Unterschiede zwischen theoretischen Verfahren und praktischer Anwendung aufzeigen und die Bedeutung der Kostenrechnung für die Unternehmensführung hervorheben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kostenträgerstückrechnung, Zuschlagskalkulation, Kostenrechnung, Kalkulation, Unternehmensführung, Wirtschaftlichkeit, Preisfindung, Vorkalkulation, Zwischenkalkulation, Nachkalkulation, Kostenkontrolle, Praxisbeispiel, Messeproduktion.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist strukturiert in eine Einleitung, ein Kapitel zur Kostenträgerstückrechnung, ein Kapitel mit einem Anwendungsbeispiel (Messeproduktion) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und die Zielsetzung des gesamten Dokuments wird klar formuliert.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Leser, die sich einen Überblick über die Kostenträgerstückrechnung und deren praktische Anwendung verschaffen möchten. Es ist insbesondere für Studierende und Fachkräfte im Bereich der Betriebswirtschaft relevant.
- Quote paper
- Stefanie Hanschkatz (Author), 2021, Anwendung von Kostenträgerstückrechnung. Was kostet ein Produkt oder eine Dienstleistung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992316