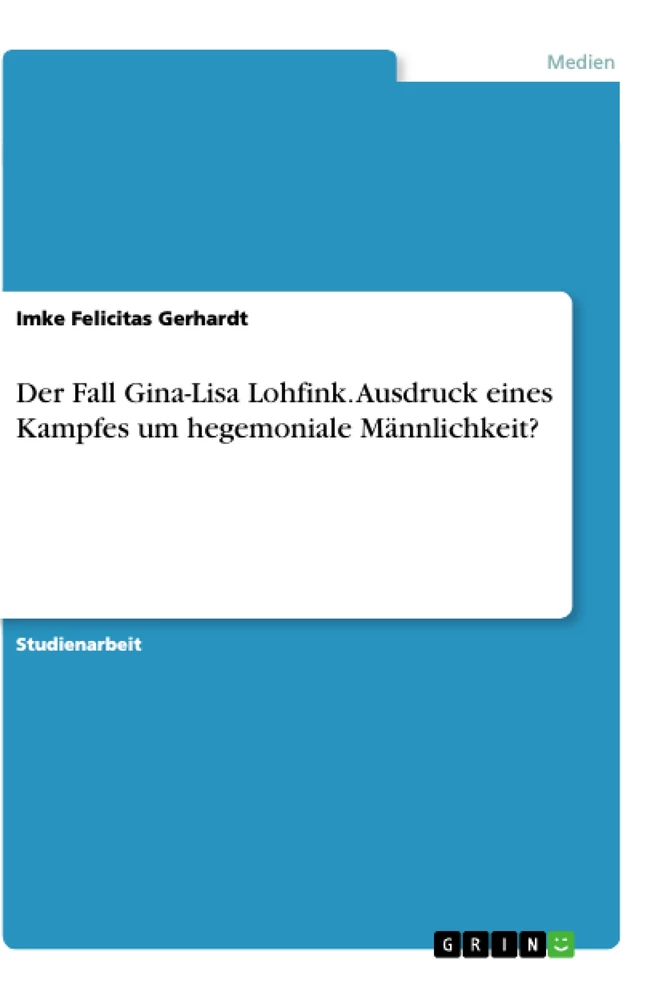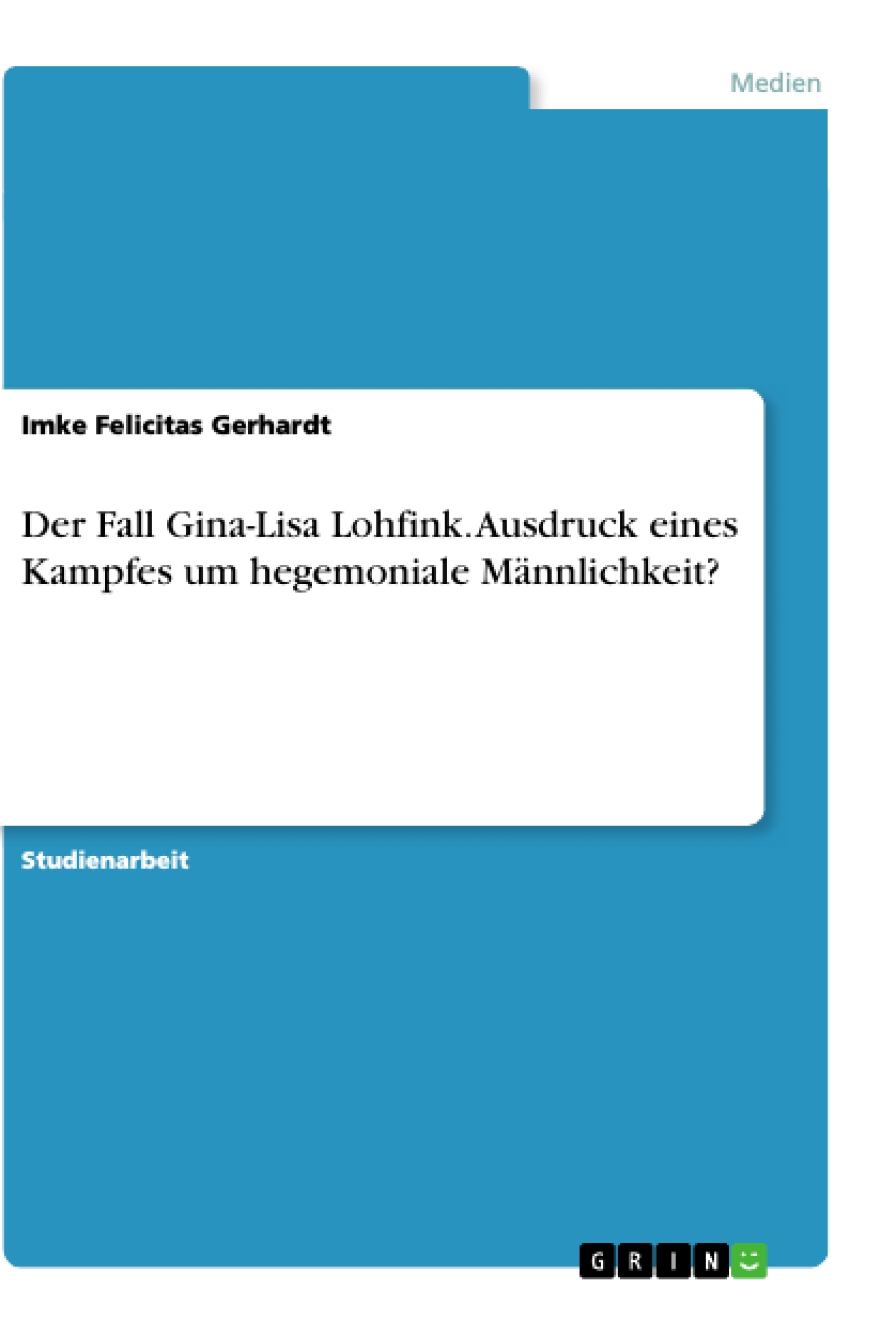Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den medialen Auswirkungen des Gerichtsprozesses um Gina-Lisa Lohfink aus dem Jahr 2016.
2016 wird Model Gina-Lisa Lohfink vor Gericht wegen falscher Verdächtigung schuldig gesprochen. Zuvor hatte sie im Jahr 2012 zwei Männer der Vergewaltigung, sowie der illegalen Aufnahme- und Verbreitung von Bild- und Tonaufnahmen bezichtigt.
Die mediale Präsenz des Falls, ebenso wie die Eindrücke der Kölner Silvesternacht 2015/16 befeuerten einen gesellschaftlichen Diskurs, der sich auf der Straße unter dem Slogan „Nein-heißt-Nein” zu einer Bewegung formierte. Der Reformdruck führte im Juli 2016 zu einer Verschärfung des deutschen Sexualstrafrechts.
Eine kritische, feministische Analyse der Konstitution des Prozesses vermag es den heteronormativen Diskursrahmen zu entlarven, diesen nach seinem historischen Ursprung zu befragen und dessen Kontinuität zu kritisieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Fall Gina-Lisa Lohfink
3. Über Feministische Kämpfe und die Inanspruchnahme eines Falls
4. Präteritum oderPräsens
5. Die verlorene Ehre der Katharina Blum und ein Fazit
6.Literaturverzeichnis
Der Fall Gina-Lisa Lohfink - Ausdruck eines Kampfes um hegemoniale Männlichkeit?
Einleitung
„Auf Gewalt zu zeigen heißt immer, Machtverhältnisse zur Diskussion zu stellen.“1 -Hannah Arendt Die Summe, respektive das Produkt, denn die Komplexität des Falles Lohfink ist nicht bloß Resultat der Addition zweier Summanden, sondern viel eher Ausdruck einer Multiplikation differierender gesellschaftlicher Faktoren spaltet in seinem Ergebnis oder viel eher in seinem gesamten Prozess die Gesellschaft.
Es ist ein Ringen um, zumindest die eigene Wahrheit, um die Gewichtung derselben auf der justitianischen Waagschale und um deren Macht in der Öffentlichkeit. Offen bleibt und das wohl zwecks des Vermeidens unqualifizierter Beurteilungen juridischer Sachverhalte, auch in dieser Ausarbeitung eine Evaluierung des finalen Schuldspruchs, offen bleibt, auf semiotischer Ebene gesprochen, ob die Augenbinde der Justitia als Verhöhnung der Blindheit des Rechts oder als Zeichen ihrer Unparteilichkeit interpretiert werden soll.
Ertragreicher als eine subjektive Beurteilung des Schuldspruchs, lediglich korrelierend mit einem ganzen Pluralismus subjektiver Wahrheiten, erscheint ein analytischer, feministischer Blick auf die Konstitution des Prozesses, der dabei zugleich mit einem gramscianischen Hegemonieverständnis betrachtet werden soll.
Der Anfang der Ausarbeitung stellt eine kurze Zusammenfassung des Prozessablaufs des Falls um die 'mutmaßliche' Vergewaltigung Gina-Lisa Lohfmks dar. Im Anschluss wird verknappt die Entwicklung und die Forderungen der Frauenbewegungen der letzten Jahrzehnte resümiert. Die letzten beiden Abschnitte versuchen, den Fall als Indikator einer hegemonialen Männlichkeit zu verwenden, beziehungsweise dessen Existenz anhand des Falls zu hinterfragen. Die Analyse wird durch ein gramscianisches Hegemonie-, ebenso wie durch ein queer-theoretisches Verständnis im Sinne Judith Butlers getragen. Die Zusammenführung beider Theoriestränge durch Gundula Ludwig macht ihre Arbeiten für die meinige besonders ertragreich.
Der Fall Gina-Lisa Lohfink
Auch wenn vermutlich auf Grund breiter medialer Resonanz der Fall Lohfink mehrheitlich vertraut ist, soll er an dieser Stelle summarisch rekapituliert werden:
Ausgang nimmt der Fall am Abend des 2. Junis 2012. Gina-Lisa Lohfink, einem größerem Publikum durch ihre Teilnahme an der Castingshow 'Germany's next Topmodel' im Jahr 2008 bekannt, feiert am besagten Abend mit Paradis F., den sie tags zuvor kennenlernte, und einem Freund desselben, Sebastian C., im Berliner Club Maxxim. Der spätere Geschlechtsverkehr der drei in Sebastian C.'s Wohnung wird von den beiden Männern zum Teil mit deren Handykameras gefilmt, 11 Sequenzen. Der Versuch, das Material am darauffolgenden Tag unter dem Titel „Vergewaltigungsvideo von Gina-Lisa!! Nagelneu!!“2 für 100.000 Euro an diverse Boulevardzeitungen zu verkaufen, scheitert. Die Ablehnung der Adressaten und die Verständigung der Polizei durch dieselben verhindert nicht, dass das Video von Sebastian C. und Paradis F. über 'Whats App' und 'Facebook' verbreitet, oder besser gesagt in Anbetracht der über eine Million Zuschauer, viral ging. In einer 28-sekündigen Sequenz ist in mehreren Momenten zu vernehmen wie Gina-Lisa „Hör auf“ und „nein, nein, nein“ sagt, einmal während ihr einer der Männer während des Sexualverkehrs an den Hals fasst und erneut, als einer der Männer versucht, sein Genital in ihren Mund zu führen. Dieses Video ist auch nach vier Jahren im Internet zugänglich, lediglich eine längere Version wurde gesperrt.
Einige Tage später erstattet Gina-Lisa Lohfink über ihren Anwalt Strafanzeige gegen die beiden Männer wegen unerlaubter Verbreitung von Bild- und Tonaufnahmen, die sie jedoch vier Tage später korrigiert und die Männer der Vergewaltigung bezichtigt. Lohfink spricht von einer von ihr vermuteten Verabreichung von K.O-Tropfen, mehreren Fluchtversuchen und von einer Untersuchung durch eine Gynäkologin am darauffolgenden Tag, deren Name und Diagnose dem Gericht jedoch bis zum Tag der Urteilsverkündung nicht Vorlagen. Weitere Ungereimtheiten ergeben sich für das Gericht aus einer 'zärtlichen' SMS Lohfmks an Sebastian C. am Morgen nach der mutmaßlichen Vergewaltigung und einem erneuten Geschlechtsverkehr mit dem Beschuldigten. Der toxikologische Gutachter schließt zudem nach der Beurteilung sämtlicher Mitschnitte die Verabreichung von K.O-Tropfen aus, weil das 'Opfer' ihm für diese Annahme auf dem Videomaterial zu vital erscheint. Ende 2015 ergeht deshalb ein Strafbefehl gegen Gina-Lisa Lohfink wegen falscher Verdächtigung. Der Prozess gegen die vom Amtsgericht Berlin angeklagte Lohfink endet am 22.08.2016 mit einem Schuldspruch, einem Strafgeld von 20.000 Euro, zu zahlen in 80 Tagessätzen ä 250 Euro und mit der Begründung, das „Hör auf‘ und „Nein nein nein“ habe sich nach Beurteilung der anderen Mitschnitte auf das Filmen, nicht aber auf den Geschlechtsverkehr im Allgemeinen bezogen. Die beiden Männer wurden im Mai 2014 zu geringen Geldstrafen wegen unerlaubter Verbreitung von Bild- und Tonmaterial verurteilt.3
Ausgehend von der Annahme, dass jeder Rechtsentscheidung eine politische Färbung innewohnt4, ist die politische Indienstnahme des Falls dessen ungeachtet auffällig. Die strukturelle Verwobenheit, ausgedrückt in der diskursübergreifenden Verhandlung um die Deutungshoheit der jeweiligen Wahrheit in der Öffentlichkeit, bedingt die Komplexität eines Falls, dessen Thematik historisch unabgeschlossene feministische Aushandlungsprozesse konzentriert.
Über feministische Kämpfe und die Inanspruchnahme eines Falls
„Dies ist der Fall, der zu einem neuen Gesetz geführt hat, das die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen in Deutschland verbessert.“5 Die positive Essenz, die Lohfmks Verteidiger Burkhard Benecken aus dem Prozess zieht, muss an dieser Stelle erläutert werden.
Ein historischer Rückgriff:
Die feministische Dekonstruktion des Patriarchats und in dessen Rahmen die Offenlegung der historisch konstruierten Spaltung von privat-öffentlich entlang der Binarität der Geschlechter als einer männlich produzierten, war eine Demonstration der strukturell erzwungenen Inferiorität der Frau.
Die Segregation in politische Öffentlichkeit und in die Intimität des Privaten manifestiert sich, so Carole Pateman in den Gesellschaftsverträgen des 18. Jahrhunderts, deren misogyne Substanz sich primär in der Definition der Frau als im Naturzustand schütz- und eigentumslos, somit männlich bevormundet, plastiziert.6
Beispielhaft die Definition des deutschen Staats-Wörterbuchs 1858: „Das Weib ist auf die eheliche Gemeinschaft und die Familie als den natürlichen Mittelpunkt seines Daseins angewiesen. Von hier aus nimmt es als Ehefrau, Hausfrau und Mutter, ohne in die Öffentlichkeit vorzutreten, gleichwohl (...) den eingreifendsten Antheil am wirtschaftlichen, sittlichen und politischen Volksleben.“7 Die Absprache des Subjektstatus und der Entzug der Möglichkeit politischer Partizipation entblößt den widersprüchlichen Charakter des Gleichheitspostulats. Der dualistische Entwurf von Gleichheit, also „einerseits die Vorstellung von einer >ursprünglichen< naturgegebenen Gleichheit der Menschen, die unter zivilen, staatlichen Bedingungen nicht notwendig ihre Gleichberechtigung beinhaltet (...), und andererseits das Rechtsgebot sozialer Gleichheit, das sich mit der Bezugnahme auf eine natürliche, ursprüngliche Gleichheit der Menschen gerade gegen die sozialen Unterschiede wendet.“8, führte zu einer institutionalisierten Ungleichheit zur Lasten der Frau. Die Erkenntnis der Unzugänglichkeit der öffentlich politischen Sphäre für das weibliche Geschlecht implizierte die Identifizierung des Wesen des Staates als ein männliches, welches unter der Fiktion einer geschlechtslosen Neutralität tatsächlich die strukturelle zweigeschlechtliche gesellschaftliche Separierung reproduzierte und naturalisierte9. Die biologische Reduktion der Frau auf ihren Körper, ihre Reproduktionsfähigkeit, ihren emotionalen, irrationalen Charakter, kontrastiert mit der vernunftgeleiteten rationalen Disposition des Mannes bedingte die 'natürliche' Dependenz des weiblichen Geschlechts an den Mann als den mündigen Bürger in der Öffentlichkeit und im Privaten als das Oberhaupt der Familie.10
Dieser strukturelle Androzentrismus, gewaltförmig allein in seiner determinierenden Spaltung, führte zu einer Auslieferung der Frau an den männlichen Staat, dessen alleiniger Besitz des Gewaltmonopols in der Hinsicht von Feminist/Innen als Mythos deklariert wurde, als das die Frau zugleich dem Mann ohne staatlichen Schutz in der häuslichen Sphäre ausgeliefert war und somit ebenso einer potentiellen häuslichen Gewalt. Diese gesellschaftlich sedimentierte geschlechtsspezifische Zuteilung von Verletzungsoffenheit und Verletzungsmächtigkeit zeigte sich explizit ausgedrückt in einer männlichen Rechtssprechung, die bis ins Jahr 1997 in Paragraph 177 und 178 des Strafgesetzbuchs die sexuelleVergewaltigung als Straftat auf den außerehelichen Bereich reduzierte.11 So urteilte beispielsweise der Bundesgerichtshof im Jahre 1967, dass der Geschlechtsverkehr die eheliche Pflicht der Frau, ,,[...], die in Zuneigung und nicht in Gleichgültigkeit oder mit offenem Widerwillen zu vollziehen sei.“12
Die Dechiffrierung der männlichen Hegemonie als Voraussetzung einer Transformation derselben war Ziel und Aufgabe der sich in den 60er Jahren mit Parolen wie „Das Private ist politisch“13 (Simone de Beauvoir) Gehör verschaffenden Frauenbewegungen, die explizit in den 70ern auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machten, welche sie mit praktischen Projekten wie der Frauenhaus- oder der Notrufbewegung aktiv bekämpfen und mit der alternativlosen Forderung einer konsequenten Reformierung des Sexualstrafrechts rechtlich delegitimieren wollten.14 Der zähe, 20 Jahre wähnende Reformdiskurs barg unzählige Reformanträge primär oppositioneller Parteien, vorbildhaft hier die GRÜNEN, die beispielsweise im Zuge ihres 'Antidiskriminierungsgesetzes' einen Reformantrag stellten. Dieser war ,,[...] geschlechtsneutral formuliert („eine Person“); verwandte einen inklusiven Gewaltbegriff („gegen ihren Willen“); differenzierte die Tathandlungen („anal, oral, vaginal [...]) und strich die Exlusion „außerehelich“ sowie den „minder schweren Fall“.“15 Aber auch Vertreter der Regierungsparteien, so etwa der Reformantrag der Bundesfrauenministerin Süssmuth forderten eine Beseitigung der Gewalt an Frauen, der besonders innerparteilich auf großen Unwillen stieß. Die Reformwilligen sahen sich mit differentem Widerstand konfrontiert. Einerseits war dieser im Kontext der Brandt-Ära und der Losung 'Mehr Demokratie wagen' zu verorten, die eine Forderung nach Entkriminalisierung, also eine Ausweitung von Freiheit durch den Rückzug des Strafrechts aus Privat- und Intimsphäre implizierte. Und andererseits aus einem Widerstand, der sich aus Pönalisierungsgegnem der konservativpatriarchalen Regierungsparteien CDU/CSU in der Kohl-Ära konstituierte, die die Institution Ehe durch staatliche Intervention gefährdet sahen und ferner mit Heranziehung des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs, der bis zu seiner Neuregelung in den 90ern den Schwangerschaftsabbruch ohne nachweisliche Vergewaltigung unter Strafe stellte, der Frau eine berechnende Indienstnahme eines reformierten Paragraphen 177/178 unterstellten und die Glaubwürdigkeit der Frau damit diffamierten16. Die Mächtigkeit der Reformgegner innerhalb des 20-jährigen Diskurses, die vehemente Verteidigung einer hegemonialen männlichen Weltanschauung, deren frauenverachtende Substanz Gewalt verkörperte, war nicht nur Ausdruck einer asymmetrischen Verteilung der Zugangsmöglichkeit zum hegemonialen Aushandlungsprozess, sondern verdeutlichte in seiner Persistenz die Wirkmacht der Naturalisierung einer Ideologie im Alltagsverstand. Es bedurfte einer beharrend insistierenden Frauenbewegung und eines sukzessiv intensivierten Drucks auf internationaler Ebene für die Erzeugung einer neuen Gewohnheit durch eine rechtliche Fürsprache auf sexuelle Selbstbestimmung.
So wird die Diskriminierung der Frau auf internationalem Terrain 1979 in Artikel 1 der UN 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women' bereits wie folgt defmiert:„Jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau- ungeachtet ihres Familienstands- im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird.“17 1986 forderte die EU ,,[...] die Ungleichbehandlung von Ehefrauen im Falle sexualisierter Gewalt durch den Ehemann zu beseitigen.“ und die Generalversammlung der Vereinten Nationen spezifizierte in ihrer 1993 erlassenen „Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen“ die Definition geschlechtsspezifischer Gewalt und ermöglichte damit eine Neugewichtung der divergenten Argumentationspositionen. Als Resultat der internationalen Normsetzung und als Ertrag eines jahrelangen Ringens der Frauenbewegungen beschloss die Bundesregierung unter anderem 1997 die Reformierung des Sexualstrafrechts, den 1999 erlassenen 'Aktionsplan I zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen', das „Gewaltschutzgesetz“ im Jahre 2002 und 2007 den 'Aktionsplan II' der verstärkt den Fokus auf Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit Behinderung legt.18
„Wenn das Vorgehen der Staatsanwaltschaft im Fall Lohfink Schule macht, traut sich bald keine sexuell genötigte Frau mehr in Deutschland zur Polizei.“19
Die zweite Bilanz, die Lohfmks Anwalt Benecken aus dem Fall zieht, wirkt paradox in Analogie zu dem diesen Absatz einleitenden Fazit des Anwalts. Gina-Lisa Lohfink wäre demnach sowohl ein Opfer sexueller Gewalt als auch Betroffene struktureller Gewalt durch ein hegemonial männliches Strafverfahren, welches ihre Glaubwürdigkeit öffentlich verneint. Die politische Indienstnahme des Falls zu Beginn des Prozesses, so ließ beispielsweise Familienministerin Manuela Schwesig gegenüber SPIEGEL ONLINE verlauten:“Wir brauchen die Verschärfung des Sexualstrafrechts, damit endlich in Deutschland die sexuelle Selbstbestimmung voraussetzungslos geschützt wird. 'Nein heißt nein' muss gelten. Ein 'Hör auf ist deutlich.“20, führte in Zusammenhang mit dem durch die Vorfälle der Kölner Silvesternacht erzeugten Reformdruck zu einer Verschärfung des Sexualstrafrechts. So soll in Zukunftjegliche sexuelle Handlung, die gegen den Willen der anderen Person vollzogen wird, rechtlich geahndet werden.
Präteritum oder Präsens
Recht ist ,,[...]in Wirklichkeit Kampf für die Schaffung einer neuen Gewohnheit.“21
Die Errungenschaften der Frauenbewegung, beziehungsweise die im Präteritum benannten Antagonismenjener im vorgängigen Abschnitt, behaupten sprachlich eine vollzogene Überwindung misogyner Kontinuitäten. Damit wird das Recht zum Maßstab, zum Gradmesser von Emanzipation. Der normsetzende Gesetzescharakter ist folglich nicht bloß einseitig repressiv zu beurteilen, sondern zugleich produktiv, als Organisator von Lebensweisen zu verstehen.22 Basierend auf der Tatsache, dass an dieser Stelle nicht ein liberales Staatsverständnis verwandt wird, welches den Staat als der Gesellschaft äußerlich, also als gegenübergestellte Institution betrachtet, sondern auf Antonio Gramsci's integraler Staatsauffassung rekurriert wird, wird ebenso eine Auffassung von Recht bedingt, welche jenes als Reflexion gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse interpretiert. Der prozessuale zivilgesellschaftliche Kampf um Hegemonie, produziert, beziehungsweise artikuliert in seiner Summe eine Ideologie, die sich jedoch weniger als eine dem Subjekt äußerliche Illusion, als vielmehr eine im Alltagsverstand des Menschen materialisierte Weltauffassung identifizieren lässt. Recht also als Ausdruck einer errungenen Denkweise, als, mit Nicos Poulantzas gesprochen, ,,[...] einheitsstiftende ideologische Instanz in kapitalistischen Gesellschaften, welche die Religion als dominante Ideologie des Feudalismus abgelöst hat.“23 Der Ablösung resistent blieb jedoch lange Zeit (bis heute?) die der christlichen Religion inhärente Inszenierung der Frau. Die Reduktion auf den weiblichen Körper, also die Gleichsetzung von Frau und Körper und die gleichzeitige Abwertung des letzteren durch dessen Ineinssetzung mit fleischlicher Lust konstruiert den weiblichen Körper als negative Verführung. Als dessen Gegenpart darf sicherlich die Konzeption der Mutter Gottes verstanden werden. Maria, als neue Eva, wird stilisiert als liebevoll fürsorgliche Jungfrau. Ebenso findet die propagierte Unvollständigkeit und Abhängigkeit der Frau, bis heute in den gesellschaftlichen Verhältnissen verdeutlicht, seine Entsprechung im Buch Genesis, in der Erschaffung Evas aus der Rippe Adams, in der Strafe Gottes für den Sündenfall, die Eva zwingt Nachkommen unter Schmerzen zu gebären und Adam zu schwerem Ackerbau nötigt. Die Infragestellung dieser übernommenen männlich hegemonialen Ideologie ist der Beginn der Frauenbewegung und der Reformierung des Rechts. In diesem Kontext sollte jedoch die Frage gestellt werden, ob es sich um tatsächliche Brüche mit hegemonialen Deutungsmustem, oder, ob es sich, und das konstatiert Stefanie Wohl beispielsweise für den Ansatz des 'Gender Mainstreaming' um passive Revolutionen im gramscianischen Sinn, also um Formen des Zugeständnisses hegemonialer Kräfte gegenüber Subalternen handelt.24 Tatsächlich, und das wird explizit am Fall präziser in der Debatte um den Fall Gina-Lisa Lohfink deutlich, der die Unabgeschlossenheit des Kampfes um die Infragestellung zugewiesener hegemonialer Rollenbilder illustriert, diffamieren nicht nur die öffentlichen 'Gegner' der Angeklagten dieselbige mittels überholt gehofften weiblichen Diskriminierungsformen, sondern auch feministische Beurteilungen des Falls erweisen sich an einigen Stellen als kontraproduktiv, indem sie offensichtlich Frau und Opfer synonym setzen und damit die zu bekämpfenden Rollenvorstellungen reproduzieren. So kritisiert Judith Butler allgemein am Feminismus, dass die Behauptung einer gemeinsamen Identität geschlechtsunterdrückende Machtstrukturen möglich macht und reproduziert.25
Die verlorene Ehre der Katharina Blum und ein Fazit
Die Böllsche Erzählung von der Diffamierung der unbescholtenen Katharina Blum durch die denunzierende Berichterstattung einer Boulevardzeitung beschreibt trotz differierender Thematik ein Phänomen, also das der medialen Gewalt, welches nicht nur der Debatte um den Fall Lohfink im Ganzen inhärent ist, sondern sogar aktiv bei der Urteilsverkündigung mit dem Vorwurf der Inszenierung des Falls mit der Absicht der Eigen-PR gegen die Angeklagte verwandt wurde.26 Über letzteren, in Anbetracht der sensiblen Thematik des Falles harten Vorwurf, mag sich jede/r ein eigenes Urteil bilden, die definitive mediale Gewaltförmigkeit soll im Folgenden jedoch unter einem gramscianischen und einem queer-theoretischen Aspekt kurz beleuchtet werden. Die ertragreiche Verknüpfung dieser beiden Theoriestränge zeigt sich namentlich in den Arbeiten Gundula Ludwigs, auf die deshalb an dieser Stelle primär rekurriert wird.
Der Fall Lohfink und dessen mediale Resonanz birgt eine Gewaltförmigkeit, zu dessen Bildung nicht nur die normsetzende Kraft des hegemonialen Diskurses um sexuelle Selbstbestimmung beiträgt, dem durch das Festlegen eines heteronormativen Diskursrahmens zwangsläufig gewaltsame Ausschlüsse Subalterner immanent sind, sondern auch direkte verbale Gewalt gegen die Angeklagte, die entweder einseitig als weibliches Opfer stilisiert, oder als Täterin mit diskriminierenden Stigmata ('Hure'-'Luder'-'Silikonbrüste') öffentlich denunziert wird. Die auffallende Reduktion auf die Weiblichkeit ihres Körpers, auf ihr Geschlecht („Die einen sehen in der zu einer Männertraum-Karikatur zurechtoperierten Blondine, die ihr Brot auf Erotikmessen und in Sendungen wie Promischweiß und Edelweiß verdient, eine unglaubwürdige Amateurpomo- Darstellerin, deren Verstand nicht ausreichend entwickelt ist, um eindeutige Sprechakte zu tätigen [,..]“)27, reproduziert eine von der Frauenbewegung seit jeher missbilligte Konstruktion des weiblichen Geschlechts als unsouverän, irrational und ungeistig, mittels des Vorwurfs der Unfähigkeit zur Überwindung der eigenen Körperlichkeit. Die breite öffentliche Toleranz gegenüber dieser geschlechtsdiskriminierenden Diffamierung zeigt die akzeptierte, respektive in zivilgesellschaftlichen Praxen getragene und wiederholte Gewaltsamkeit des „Regulativs“ Geschlecht im Allgemeinen und gleichsam die Permanenz der geschlechtlichen Asymmetrie, reproduziert innerhalb einer „hegemonialen Heteronormativität“.28 Die Übernahme jener hegemonialen Deutungsmuster (z.B.: Frau = verletzungsoffen/Mann = verletzungsmächtig etc.) in den Alltagsverstand, also die Formung der subjektiven Wirklichkeit über diese, was eine permanente Bestätigung normsetzender Weltanschauungen innerhalb zivilgesellschaftlicher Praxen voraussetzt, lässt diese Deutungsmuster zu einer inneren Wahrheit des Subjekts werden, lässt diese sich naturalisieren. Das heißt: „Der Alltagsverstand ist [folglich] gesellschaftlich [.. ,].“29 Dass heißt aber auch, dass sich das Subjekt, indem es diese gesellschaftlichen Wahrheiten übernimmt, überhaupt erst subjektiviert, sich also innerhalb gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse/Machtverhältnisse erst konstituiert.30 In Hinblick auf die heteronormative Konstruktion von Geschlecht spricht Judith Butler von 'Performativität' als dem Modus Operandi von Macht.
Heterosexualität als hegemonialer Deutungsrahmen führt demnach zur Konstitution des Subjekts über einen binär vergeschlechtlichten Körper. Durch performative Akte, als eine Wiederholung der Norm, wendet das Subjekt Macht auf sich, subjektiviert sich über ein Selbstverhältnis zu einer gesellschaftlich anerkannten und naturalisierten Wahrheit, die das sedimentierte Resultat eines zivigesellschaftlichen Aushandlungsprozesses ist.31 Das macht uns, wie Wendy Brown es passend konkretisiert: ,,[...] nicht einfach [zu] Zielscheiben, sondern [zu] Vehikel[n] von Macht.“32 Die reziproke Dependenz von Macht und Subjekt, also einerseits die Materialisierung von Macht im Subjekt und innerhalb des Konstitutionsprozesses des Subjekts, und andererseits die Abhängigkeit hegemonialer Macht von der Bestätigung durch das Subjekt als Bedingung für ihre Beständigkeit, führt damit zwangsläufig zu einer historisch-spezifischen Macht und zu einem historischspezifischen Subjekt, oderwie Gramsci es nennt 'Menschentypus'.33
Einen konkreten 'Menschentypus' zeitlich einzugrenzen erweist sich sicherlich als äußerst schwierig, die zeitliche Benennung einer historisch-spezifisch hegemonialen Weltanschauung ebenso ist jedoch als Resultat zivilgesellschaftlicher Kämpfe und als dann abhängig von einer
Bestätigung durch gesellschaftliche Praxen eventuell besser zu identifizieren. Die Verhandlung des Falls Lohfink, welche weniger im Gerichtssaal als viel eher in einer medialen Diskursarena erfolgte, kann als Indikator verwandt werden, um die Existenz des Deutungsmusters: weibliche Inferiorität / männliche Hegemonie anzuzeigen oder in Frage zu stellen. Das Fazit von Lohfmks Anwalt Benecken, das trotz Verurteilung seiner Klientin im Bezug auf die sexuelle Selbstbestimmung der Frau durch die Verschärfung des Sexualstrafrechts positiv ausfällt, kann im Hinblick auf die gewaltsame öffentliche Diffamierung der Angeklagten nicht geteilt werden. Judith Butlers Ansatz der Performativität als „struktureller Konstitutionsmodus“34 einer heterosexuellen Machtformation verweist darauf, dass Sprechakte das Objekt im Prozess der Bezeichnung erst hervorbringen. „Sprechakte sind immer Zitate aus dem Kontext von Machtformationen, da diese den Rahmen der Sprechakte darstellen. Äußerungen müssen sich, um verständlich und wirksam zu sein, auf Normen beziehen; sie müssen diese zitieren. Im Zitieren derNormen bringen sie >Wirklichkeit< hervor.“35 Wenn also Thomas Fischer, als öffentlich anerkannter Richter des Bundesgerichtshofes in seiner ZEIT-Kolumne Gina-Lisa Lohfink als ,,[...] Mensch mit dem Beruf 'Vorzeigen-von-dicken- Silikonbrüsten'[...]“36 charakterisiert oder sich im gleichen Artikel über Frauen folgendermaßen äußert: „Und dann - vielleicht, eventuell - wird die Selbstbestimmung der deutschen Frau ein Niveau erreicht haben, das ihrer Sehnsucht genügt: Die Verschmelzung von Louboutin-Trägerin, Aufsichtsratsvorsitzender und ewigem Kind. Auf hohen Absätzen, doch immerzu missbraucht. Auf lukrativen Posten, doch immer noch zu kurz gekommen. Auf immer unverstanden sowieso: Kaum trippelt man selbstbestimmt im kurzen schwarzen Spitzenkleidchen übers Parkett, honigblond hochgesteckt, Augen bewimpert, Lippen geschürzt, Brust irgendwie gestützt - da starren frech schon wieder: Männer.“37, dann reproduziert er als organisierender Intellektueller im gramscianischen Sinne eine frauenverachtende Weltanschauung, die die Frau auf ihren Körper reduziert und ihre Unvollständigkeit betont, die falls überhaupt überwindbar, nur durch Angleichung an das männliche Ideal behoben werden kann.
Ebenso führt die einseitige Stilisierung Lohfmks zum Opfer (weil weiblich?), ausgedrückt etwa in den Parolen feministischer Demontranten/Innen vor dem Gerichtsgebäude wie etwa: „Bildet Banden, macht sie platt, Macker gibt’s in jeder Stadt.“38 und in einer allgemeinen Welle von Solidarität, die auch noch nach dem Urteilsspruch Gina-Lisa Lohfink in ihrem Opferstatus verteidigt, zu einer Wiederholung hegemonialer Deutungsmuster, die sich innerhalb dieses Prozesses materialisieren und verfestigen.
Die Reproduktion der heterosexuellen Norm und damit einhergehend die Wiederholung der Vorstellung von einer Differenz zwischen den Geschlechtern, resultiert, und das zeigt sich im Fall Gina-Lisa Lohfink, in einem Fortbestehen geschlechtlicher Asymmetrie an Hand tradierter Rollenbilder. Die mediale Charakterisierung Gina-Lisa Lohfmks als „wasserstoffblonde Hessin“, „Blondine mit Schmuddelimage“, „Luder“, „Beruf: Vorzeigen-von-dicken-Silikonbrüsten“ ebenso wie die Beschimpfung „Gina-Lisa, du Hure“ innerhalb des Gerichtsgebäudes durch unbekannte Männer, von denen keine Personalien aufgenommen wurden, und die Tatsache, dass das besagte Video noch immer im Internet zugänglich ist,39 verdeutlicht ein innerhalb zivilgesellschaftlicher Institutionen und Praxen getragen eines wiederholt und damit bestätigtes hegemoniales Deutungsmuster, welches die Frau mit ihrem Körper gleichsetzt, sie objektifiziert und dem männlich, geistigen Ideal unterordnet.
Dieser Artikulation hegemonialer Männlichkeitjedoch mit einer einseitigen Täter-Opfer Zuweisung als Kritik zu begegnen beschreibt einen ebenso gewaltvollen Akt der Vertiefung der Differenz, die eher durch die Dekonstruktion und Entnaturalisierung des binären Geschlechtsmodells behoben werden sollte, deren zweigeschlechtliche Rollenmodelle andernfalls in der Reproduktion der Differenz nie Gleichheit erlauben.
Literaturverzeichnis
Abdi-Herrle, Sasan, Ein Nein reicht aus, in:ZEIT ONLINE, [07.07.2016], http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-07/sexualstrafrecht-ueberblick-vergewaltigung- sexuelle-belaestigung-abschiebung. Stand:31.08.2016.
Baumann, Heidrun (Hg.),“Frauen-Bilder“ in den Medien. Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen, Münster 2000.
Beger, Nico J./Hark, Sabine/Engel, Antke/et al. (Hg.), Queering Demokratie. Sexuelle Politiken, Berlin 2000.
Buckel, Sonja/Fischer-Lescano, Andreas (Hg.), Hegemonie gepanzert mit Zwang. Zivilgesellschaft und Politik im Staatsverständnis Antonio Gramscis, Baden-Baden 2007.
Bullion, Constanze von, Die heikelsten Punkte der „Nein heißtNein“-Reform, imSüddeutsche Zeitung, [07.07.2016], http://www.sueddeutsche.de/politik/nein-heisst-nein-die-verschaerfung-des- sexualstrafrechts-ist-keine-kleinigkeit-1.3067324. Stand:31.08.2016.
Dackweiler, Regina-Maria/Schäfer, Reinhild (Hg.), Gewalt-Verhältnisse. Feministische Persepektiven auf Geschlecht und Gewalt, Frankfurt a.M. 2002.
Fischer, Thomas, Die Schutzlückenkampagne, imZEIT ONLINE, [3.02.2015], http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-02/sexuelle-gewalt-sexualstrafrecht. Stand:31.08.2016.
Fischer, Thomas, Es gibtkeinen Skandal, in:ZEIT ONLINE, [10.02.2015], http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-02/sexuelle-gewalt-sexualstrafrecht- schutzluecke/komplettansicht. Stand:31.08.2016.
Fischer, Thomas, Frauenfilme zu Frauenwahrheiten und Frauenfragen, imZEIT ONLINE, [21.06.2016], http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht- vergewaltigung-taeter-opfer-fischer-im-recht/komplettansicht. Stand:31.08.2016.
Fischer, Thomas, Zum letzten Mal: Nein heißtNein, in:ZEIT ONLINE, [28.06.2016], http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/rechtspolitik-sexualstrafrecht-nein- heisst-nein-fischer-im-recht/komplettansicht. Stand: 31.08.2016.
Gerhard, Ute/Jansen, Mechthild/Maihofer, Andrea/et al. (Hg.), Differenz und Gleichheit. Menschenrechte haben (k)ein Geschlecht, Frankfurt a.M. 1990.
Hildebrandt, Antje, Gina-Lisa Lohfink vor Gericht als „Hure“ beschimpft, in: DIE WELT, [01.06.2016], http://www.welt.de/vermischtes/article 155887115/Gina-Lisa-Lohfmk-vor-Gericht-als-Hure- beschimpft.html. Stand:31.08.2016.
Kemekenidou, Penelope, Das Luder spricht, in:ZEIT ONLINE, [23.06.2016], http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-06/sexismus-vergewaltigung-luder-medien-sprache- boulevardpresse. Stand:31.08.2016.
Kreisky, Eva/Lang, Sabine/Sauer, Birgit (Hg.), EU.Geschlecht.Staat, Wien 2001.
Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hg.), Feministische Standpunkte in derPolitikwissenschaft. Eine Einführung, Frankfurta.M. 1995.
Kulawik, Teresa/Sauer, Birgit (Hg.), Der halbierte Staat. Grundlagen feministischer Politikwissenschaft, Frankfurta.M. 1996.
Lakotta, Beate, Urteil gegen Gina-Lisa Lohfink: „Ein Hohn für echte Vergewaltigungsopfer“, in:SPIEGEL ONLINE, [23.08.2016], http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gina-lisa-lohfmk-urteil-ein-hohn-fuer- echte-vergewaltigungsopfer-a-1108961.html? utm_content=buffercd28b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff er, Stand:31.08.2016.
Ludwig, Gundula, Geschlecht regieren. Zum Verhältnis von Staat, Subjekt und heteronormativer Hegemonie, Frankfürt a.M. 2011.
Ludwig, Gundula/Sauer, Birgit/Wöhl, Stefanie (Hg.), Staat und Geschlecht. Grundlagen und aktuelle Herausforderungen feministischer Staatstheorie, Baden-Baden 2009.
Radisch, Iris, Viel zu viele Wahrheiten. Die mutmaßlich vergewaltigte Gina-Lisa Lohfink wird verklagt, imZEIT ONLINE, [30.062016]http://www.zeit.de/2016/26/sexualstrafrecht-gina-lisa-lohfink- vergewaltigung. Stand:31.08.2016.
Rosenfeld, Dagmar, Der falsche Fall, imZEIT ONLINE, [07.07.2016], http://www.zeit.de/2016/27/gina- lisa-lohfink-vergewaltigung-sexualstrafrecht. Stand:31.08.2016.
Rudolf, Beate (Hg.), Geschlecht im Recht. Eine fortbestehende Herausforderung, Göttingen 2009.
Rückert, Sabine, Das Schlafzimmer als gefährlicher Ort, imZEIT ONLINE, [2.07.2016], http://www.zeit.de/2016/28/sexualstrafrecht-verschaerfung-kritik. Stand:31.08.2016.
Sadigh, Parvin, „Eigentum ist besser geschützt als die sexuelle Selbstbestimmung“, imZEIT ONLINE, [23.06.2016], http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/sexualstrafrecht-gina-lisa- lohfink-recht-vergewaltigung. Stand:31.08.2016.
Sanyal, Mithu, „Das Huren-Stigma spielt eine große Rolle“, in: derFREITAG, [29.08.2016], https://www.freitag.de/autoren/louisatb/das-huren-stigma-spielte-eine-grosse-rolle? utm_content=buffer3124c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff er, Stand:31.08.2016.
Sanyal, Mithu, Warum Gina-Lisa Lohfink unsere Heldin ist, in: Missy Magazine, [14.08.2016], https://missy-magazine.de/2016/06/14/warum-gina-lisa-lohfink-unsere-heldin-ist/. Stand:31.08.2016.
Schäfer, Reinhild, Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse. Die politischen Strategien derNeuen Frauenbewegung gegen Gewalt, Bielefeld 2001.
Steinitz, Sylvia Margret, Ein schmutziges Spiel geht zu Ende, in: STERN, [07.08.2016], http://www.stern.de/panorama/sylvia-margret-steinitz/gina-lisa-lohfmk-prozess—ein-schmutziges- spiel-geht-zu-ende-6998596.html, Stand:31.08.2016.
Yaghoobifarah, Hengameh, Männliche Unschuld, imMissy Magazine, [09.08.2016], https://missy- magazine.de/2016/08/09/maennliche-unschuld/. Stand:31.08.2016.
[...]
1 Zitiert in: Dackweiler/Schäfer 2002, S.29.
2 Vgl.Sanyal2016.
3 Alle Informationen dieses Abschnitts: Vgl. Fischer 2016, Abdi-Herrle 2016, Sadigh 2016, Kemekenidou 2016, Radisch 2016, Rosenfeld 2016, Lakotta 2016, Steinitz 2016, Sanyal 2016, Hildebrandt 2016, Yaghoobifara 2016.
4 Vgl. Buckel/Fischer-Lescano 2007, S.86.
5 Lakotta2016.
6 Vgl. Kreisky/Sauer 1995, S.71ff.
7 Kreisky/Sauer 1995, S.89.
8 Ute Gerhard zitiert in: Kreisky/Sauer 1995, S.144.
9 u.a. Vgl. Gerhard/Jansen/Maihofer/etal. 1990.
10 Vgl.Luwig2011,S18ff.
11 Vgl. Dackweiler/Schäfer2002, S.83ff, 107ff.
12 Dackweiler/Schäfer2002,S.110.
13 Kreisky/Sauer 1995,S.17.
14 Vgl. Schäfer 2001, S.85ff, 106ff, 144ff.
15 Dackweiler/Schäfer2002,S.116.
16 Dackweiler/Schäfer2002, S.118ff.
17
18 Vgl. Rudolf2009, S.130-190.
19 Zitiert in: Hildebrandt 2016.
20 Lakotta 2016.
21 Gramsci zitiert in: Buckel/Fischer-Lescano 2007, S.95.
22 Vgl. Buckel/Fischer-Lescano 2007, S.95.
23 Buckel/Fischer-Lescano 2007, S.88.
24 Vgl. Stefanie Wohl in: Buckel/Fischer-Lescano 2007, S.77-80.
25 Vgl. Ludwig 2011, S.47.
26 Vgl. Lakotta 2016.
27 Radisch2016.
28 Geschlecht als Regulativ und heteronormative Hegemonie: Beide Begriffe/ Vorstellungen stammen von Gundula Ludwig. Vgl. Ludwig 2011.
29 Ludwig 2011, S.72.
30 Vgl. Buckel/Fischer-Lescan 2007, S.87ff.
31 Vgl. Ludwig 2011, S.29ff.
32 Zitiert in: Luwig 2011, S.93.
33 Vgl. Alex Demirovic's Beitrag in: Buckel/Fischer-Lescano 2007, S.21-40.
34 DieserAusdruckstammtvonlsabell Lorey, zitiert in: Ludwig2011, S.164.
35 Ludwig2011,S.165.
36 Fischer 2016. (Frauenfilme zu Frauenwahrheiten und Frauenfragen)
37 Fischer 2016. (Frauenfilme zu Frauenwahrheiten und Frauenfragen)
38 Lakotta2016.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Der Fall Gina-Lisa Lohfink - Ausdruck eines Kampfes um hegemoniale Männlichkeit?
Worum geht es in dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung analysiert den Fall Gina-Lisa Lohfink aus einer feministischen Perspektive, unter Berücksichtigung von Hegemonie-Theorien nach Gramsci und Queer-Theorien nach Judith Butler. Es wird untersucht, ob der Fall als Indikator für hegemoniale Männlichkeit dienen kann.
Wie wird der Fall Gina-Lisa Lohfink zusammengefasst?
Der Fall beginnt mit einem Vorfall im Juni 2012, bei dem Gina-Lisa Lohfink mit zwei Männern, Paradis F. und Sebastian C., feiert und Geschlechtsverkehr hat. Die Männer filmen Teile dieses Verkehrs mit ihren Handys und versuchen, das Material an Boulevardzeitungen zu verkaufen. Nachdem dies scheitert, verbreiten sie das Video über WhatsApp und Facebook. In dem Video sind Aussagen von Lohfink wie "Hör auf" und "Nein, nein, nein" zu hören. Lohfink erstattet später Anzeige wegen Vergewaltigung, die jedoch aufgrund von Ungereimtheiten und Gutachten, die K.O.-Tropfen ausschließen, in eine Anklage wegen falscher Verdächtigung mündet. Lohfink wird schließlich verurteilt.
Welche feministischen Kämpfe werden im Kontext des Falls beleuchtet?
Die Ausarbeitung geht auf die historische Entwicklung feministischer Bewegungen ein, insbesondere die Dekonstruktion des Patriarchats und die Offenlegung der geschlechtsspezifischen Spaltung von privat und öffentlich. Es werden die Forderungen nach einer Reform des Sexualstrafrechts und die Auseinandersetzung mit häuslicher Gewalt gegen Frauen thematisiert.
Welche Rolle spielt das Recht in Bezug auf Emanzipation?
Das Recht wird nicht nur als repressives Instrument betrachtet, sondern auch als produktiver Organisator von Lebensweisen. Es wird im Sinne Gramscis als Reflexion gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse interpretiert, das die gesellschaftlichen Verhältnisse und Errungenschaften einer feministischen Denkweise verdeutlichen.
Wie wird die mediale Resonanz auf den Fall Lohfink bewertet?
Die mediale Resonanz wird als gewaltförmig analysiert. Es werden sowohl die normsetzende Kraft des hegemonialen Diskurses um sexuelle Selbstbestimmung als auch direkte verbale Angriffe gegen die Angeklagte thematisiert. Die Reduktion Lohfmks auf ihren Körper und die Verwendung diskriminierender Stigmata werden kritisiert.
Was bedeutet "Performativität" im Kontext des Falls?
Im Sinne Judith Butlers wird "Performativität" als der Modus Operandi von Macht betrachtet. Heterosexualität als hegemonialer Deutungsrahmen führt zur Konstitution des Subjekts über einen binär vergeschlechtlichten Körper. Durch performative Akte, also eine Wiederholung der Norm, wendet das Subjekt Macht auf sich und subjektiviert sich.
Welche Schlussfolgerung wird aus dem Fall Gina-Lisa Lohfink gezogen?
Die Ausarbeitung kommt zu dem Schluss, dass die öffentliche Diffamierung Lohfmks und die Wiederholung hegemonialer Deutungsmuster (z.B. Frau = verletzungsoffen/Mann = verletzungsmächtig) zu einer Verfestigung geschlechtlicher Asymmetrie führen. Es wird betont, dass eine Dekonstruktion des binären Geschlechtsmodells notwendig ist, um Gleichheit zu ermöglichen.
- Quote paper
- Imke Felicitas Gerhardt (Author), 2016, Der Fall Gina-Lisa Lohfink. Ausdruck eines Kampfes um hegemoniale Männlichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992104