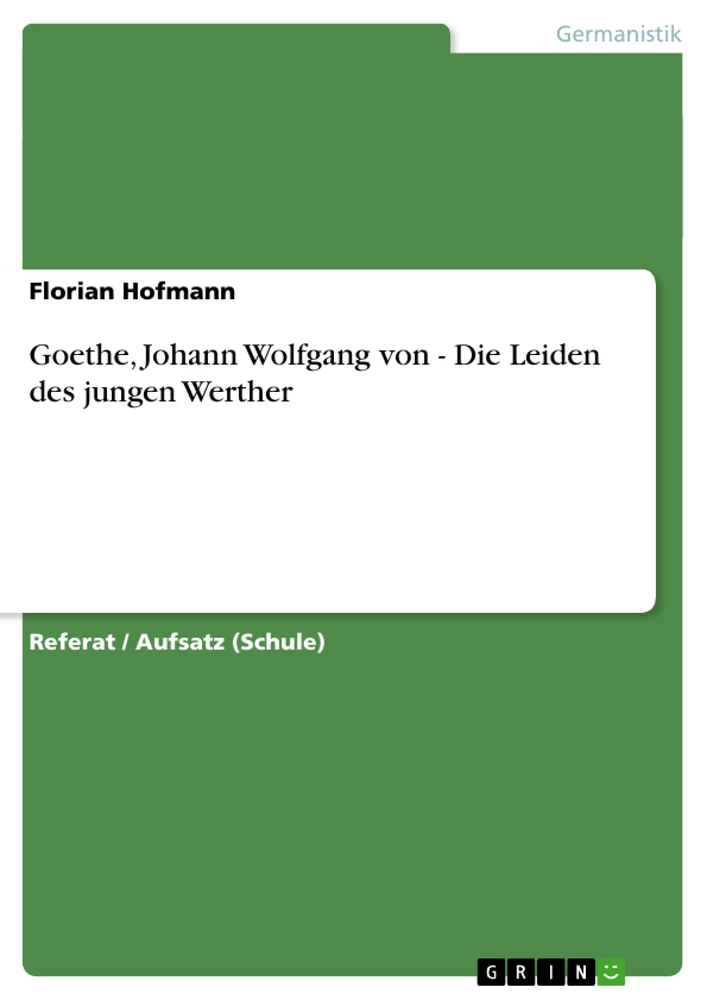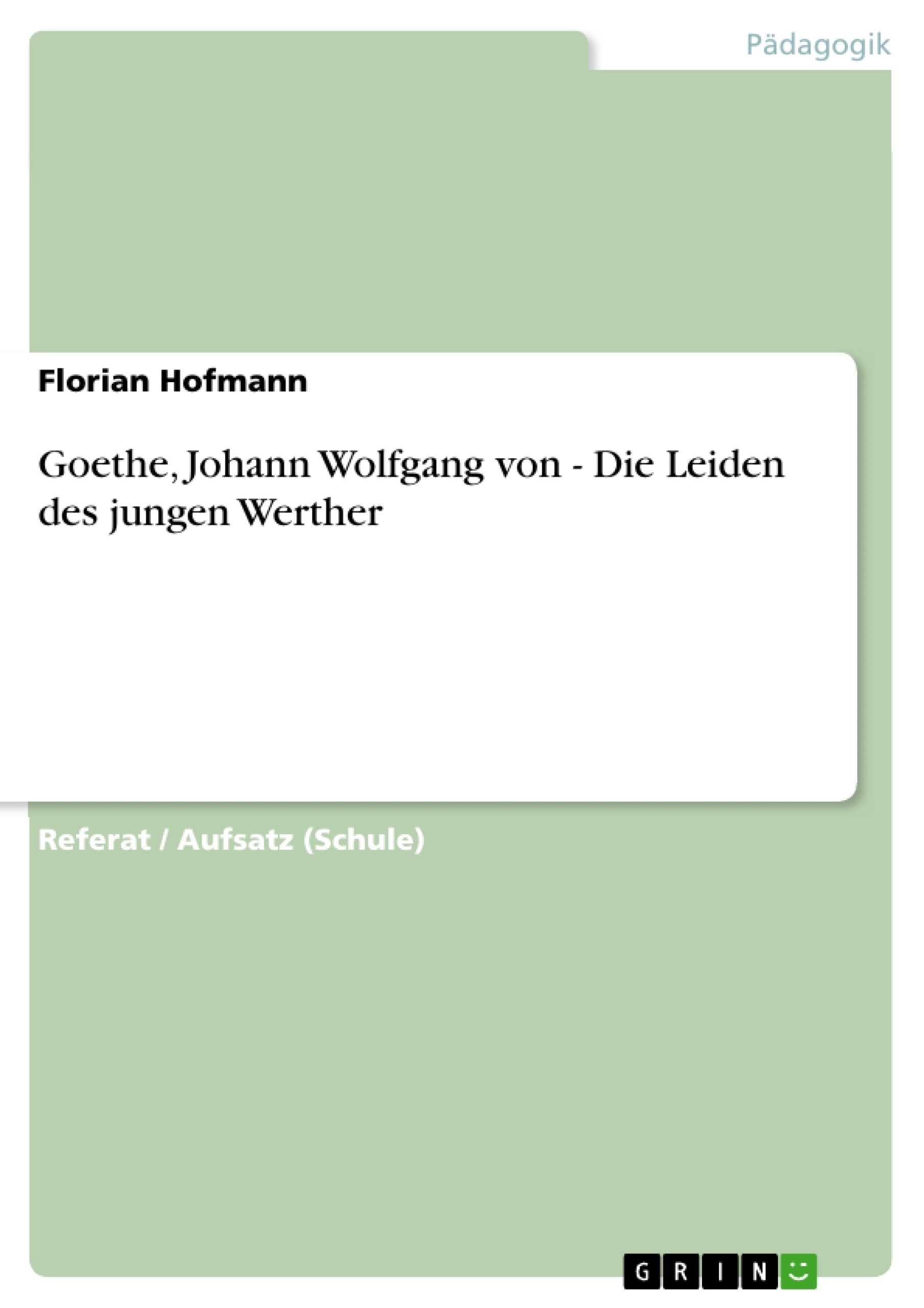Ein Herz in Aufruhr, eine Liebe, die zur Obsession wird, und eine Gesellschaft, die den freien Geist erstickt – Johann Wolfgang von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" ist ein zeitloses Meisterwerk der deutschen Literatur, das die Abgründe der menschlichen Seele erkundet. Werther, ein sensibler und künstlerisch begabter junger Mann, flieht vor den Konventionen der Stadt und sucht Trost in der idyllischen Landschaft Walheims. Dort begegnet er Charlotte, einer jungen Frau von unvergleichlicher Schönheit und Güte, die jedoch bereits mit Albert verlobt ist. Gegen jede Vernunft entbrennt in Werther eine leidenschaftliche Liebe zu Charlotte, die ihn in einen Strudel aus Glück und Verzweiflung stürzt. Er idealisiert sie, stilisiert sie zur Projektionsfläche seiner unerfüllten Sehnsüchte und verliert sich zunehmend in einer Welt der Fantasie und der Selbstzerstörung. Die Briefe an seinen Freund Wilhelm werden zum Spiegelbild seiner inneren Zerrissenheit, seiner Kritik an der oberflächlichen Gesellschaft und seiner wachsenden Todessehnsucht. Gefangen zwischen unerreichbarer Liebe, gesellschaftlichem Druck und der Unfähigkeit, sich anzupassen, sieht Werther schließlich nur noch einen Ausweg: den Freitod. Goethes Roman ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Liebe, Leidenschaft, gesellschaftliche Entfremdung und die Grenzen der menschlichen Existenz. Er zeigt auf erschütternde Weise, wie eine unglückliche Liebe zum Auslöser für eine existenzielle Krise werden kann und wie die Unvereinbarkeit von individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen in den Untergang führen kann. "Die Leiden des jungen Werther" ist nicht nur ein Roman über eine unglückliche Liebe, sondern auch eine Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen des 18. Jahrhunderts und eine Erkundung der menschlichen Psyche in all ihren Facetten. Ein Muss für Liebhaber der Klassik, der deutschen Literatur und für alle, die sich mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen möchten, ist dieses Werk, das auch heute noch Leser jeden Alters in seinen Bann zieht und zum Nachdenken anregt. Tauchen Sie ein in Werthers Welt, erleben Sie seine Leidenschaft und Verzweiflung und lassen Sie sich von Goethes Sprachgewalt fesseln. Eine Geschichte von Liebe und Verlust, die unter die Haut geht und noch lange nachhallt. Erleben Sie die literarische Epoche des Sturm und Drang, in der das Gefühl über die Vernunft siegt, hautnah.
INHALTSANGABE
Die Hauptperson des Romans ,,Die Leiden des jungen Werther", Werther schreibt seinem Freund Wilhelm Briefe von einer Reise, in denen er seine Erlebnisse schildert.
Der Roman besteht hauptsächlich aus zahlreichen Briefen Werthers an Wilhelm.
Das wesentliche Ereignis des Romans ist die Bekanntschaft Werthers mit Charlotte, in die er sich prompt verliebt. Charlotte ist eine leidenschaftliche Tänzerin, deren Begeisterung zum Tanz keine Grenzen gesetzt sind. Der total verliebte Werther verbringt schließlich einen herrlichen Abend mit ihr.
Als Charlotte an diesem Abend den Namen des Dichters Klopstock * erwähnt, weiß Werther das er seine Seelenverwandte gefunden hat und küsst Charlottes Hand. Werther ist von Amors Pfeilen getroffen und von Charlottes Liebe so entflammt, daß er die Zeit und die Welt um ihn herum total vergisst.
Der kleine, unscheinbare und zufällig gewählte Ort Walheim spiegelt für Werther den Himmel auf die Erde, da er nur eine halbe Stunde von Lotte entfernt wohnt.
Als am 30. Juli 1771 ihr Verlobter Albert zurückkehrt lässt das Gefühl des reinen Glückes, das Werther zuvor verspürte erheblich nach.
Da Charlotte ihm endgültig eine Absage erteilt, weis Werther nicht was er mit seinem Leben anfangen soll und diskutiert mit Albert sogar über Selbstmord.
Albert lehnt Werthers Selbstmord- Gedanken als unmoralisch ab.
Werther hingegen kommt zu dem Schluß das man immer die Motive einer Tat kennen müsse. Die Liebe zu Lotte belastet Werther in den nächsten Tagen sehr stark.
Seine Gedanken an Selbstmord werden im Gegensatz zu der Hoffnung auf Charlottes Liebe immer stärker.
Er ist fest davon überzeugt das er sie verloren hat.
Er beschließt eine Stelle bei Hofe anzutreten.
Werther ist Sekretär bei einem Gesandten, mit dem er aber kein gutes Verhältnis pflegt. Für Werther ist der einzige Trost das Verständnis des Grafen C. der ihm sehr mit seiner Denkweise hilft.
Die Bekanntschaft mit dem Grafen und Fräulein von B. die ihn an seine so geliebte Charlotte erinnert ist für Werther von großer Bedeutung.
Da sich Adlige bekanntlich stören, wenn ein Bürgerlicher im Saal ist muß Werther diesen bei einer Abendgesellschaft des Grafen verlassen.
Diese für Werther höchst peinliche und demütigende Situation veranlasst ihn um Entlassung bei Hofe zu bitten.
Werther ist sich der Tatsache das Charlotte vergeben bzw. verheiratet ist zwar bewußt, trotzdem zieht er aber wieder in ihre Nähe.
Die Ähnlichkeit mit seinem eigenen Leben findet Werther in einem Gespräch mit einem Bauernknecht, von dessen Liebe zu seiner Herrin er bereits geschrieben hatte. Dieser Bursche verfiel in großer Leidenschaft, als seine Herrin seine Liebe erwiderte. Der Bursche wollte sie Vergewaltigen, daß wurde aber durch ihren Bruder verhindert, der den Burschen danach aus dem Hause warf.
Werther empfindet großes Mitgefühl mit ihm, da auch er nun an Selbstmord denkt. Werthers Briefe enden mit seiner festen Überzeugung das Charlotte um einiges Glücklicher mit ihm, als mit Albert wäre. Seine Liebe war und ist unvermindert. Er ist der festen Überzeugung das Charlotte mit ihm viel glücklicher wäre als mit Albert. Zu diesem Zeitpunkt beendet Werther den Briefkontakt.
Die letzten Ereignisse fast ein Herausgeber so zusammen das Werther Charlotte küsst und sie ihn deswegen nie mehr sehen will. Werther leiht sich untere falschem Vorwand von Albert eine Pistole aus und begeht Selbstmord um die Ehe Charlottes nicht zu gefährden. Werther wird von einem Bediensteten gefunden. Dieser holt einen Arzt, der Werther aber nicht mehr helfen kann. Als Charlotte diese Nachricht erfährt, fällt sie ihn Ohnmacht. Der Herausgeber kann Charlottes und Alberts Bestürzung nicht in Worten ausdrücken. Werther wird nachts begraben. Da Selbstmord als schweres Verbrechen gegen Gott gilt, darf kein Geistlicher den Sarg begleiten.
* KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb,
dt. Dichter, * 2.7. 1724 Quedlinburg, aus einer eingesessenen Pastoren- u. Juristenfamilie stammend, + 14.3. 1803 Hamburg, begraben in Ottensen. - K., im pietistischen Sinne erzogen, besuchte zunächst das Gymnasium in Quedlinburg. 1739 erhielt er ein Stipendium f. die Fürstenschule Schulpforta, wo er, u.a. unter dem Einfluß der Literaturtheorie Bodmers u. Breitingers, den Plan zu einem großen Nationalepos faßte, das den Werken Homers u. Miltons ebenbürtig sein sollte. Nachdem er das epische Gedicht Heinrich der Vogler« noch in der Planung wieder aufgegeben hatte, begann er 1745 in Jena das Theologiestudium u. verfaßte die ersten Gesänge des »Messias«. 1746 wechselte er nach Leipzig, arbeitete die Prosaentwürfe in Hexameter um u. führte diese damit in die dt. Dichtung ein. In Leipzig erhielt K. Verbindung zu den Herausgebern der »Bremer Beiträge« u. veröffentliche in dieser Zschr. 1748 anonym die ersten drei Gesänge des Messias« u. einige Oden. 1748-50 war K. als Hofmeister in Langensalza tätig, wo die unerfüllte Liebe zu Maria Sophia Schmidt ihren Niederschlag in den »Oden an Fanny« fand. 1750 besuchte er Bodmer in Zürich, enttäuschte durch seine Weltoffenheit jedoch die Erwartungen seines Gastgebers. Da ihm der dän. Kg. eine Rente gewährte, ging K. 1751 nach Kopenhagen, wo er einen dt.-dän. Dichterkreis um sich sammelte, dem u.a. Gerstenberg u. Stolberg angehörten. Im gleichen Jahr lernte er die Hamburger Kaufmannstochter Meta Moller kennen, die »Cidli« seiner Oden, die er 1754 heiratete. Nach ihrem Tod 1758 lebte er v. 1759-63 in seiner Heimat, kehrte 1764 nach Dänemark zurück u. nahm 1770 nach dem Sturz seines Gönners Bernstorff seinen Wohnsitz in Hamburg. 1774 reiste er nach Karlsruhe zum Mgf. v. Baden, der ihm eine Stelle als Hofrat anbot. Unterwegs wurde er vom Göttinger Hain u. Goethe in Frankfurt begeistert empfangen, doch kam es schon 1775 zum Bruch mit den Stürmern u. Drängern. 1791 heiratete K. die verwitwete Johanne Elisabeth v. Winthem. - Zu seinem Lebzeiten wurde K. hoch geehrt, doch begründet sich sein Ruhm vorwiegend aus seinen Jugendwerken. Er überwand in seinem Werk spätbarocke Dichtübungen u. nahm mit seiner individuell u. irrational geprägten Weltsicht vor allem in den ersten Gesängen des »Messias« Elemente der Empfindsamkeit u. des Sturms u. Drangs voraus. Seine Abkehr v. der Alltagssprache u. seine sprachmächtigen Neuprägungen schufen eine neue Intensität v. Bildern u. Rhythmen u. entwickelten die bislang geübte metrische Tradition über eine Anlehnung an antike Vorbilder weiter bis hin zu freier Gestaltung. Sein »Messias« (1748-73), das erste große neuhd. Epos, blieb jedoch dem Geist der Zeit verhaftet u. zeigt nach anfänglich begeisterter Aufnahme (Bodmer, Wieland, Herder) das Erlahmen der dichterischen Kraft K.s. Auch in seinen Oden behandelte er ausschließlich erhabene Themen in pathet. Empfindung. Seine übrigen Arbeiten stehen im Schatten dieser beiden Werke u. konnten kaum Wirkung entfalten. Unter den theoret. Schriften (u.a. über Metrik, Poetik, Orthographie u. Etymologie) ist die unvollendete Prosaschrift »Die dt. Gelehrtenrepublik« (1774) am wichtigsten. Sie fordert die Freiheit des Dichters v. jedem Regelzwang u. strebt einen Zusammenschluß aller dt. Schriftsteller an. Die anfängliche Nähe K.s zur frz. Revolution
(1792 frz. Ehrenbürger) wich aber bald scharfer Ablehnung.
In seinen »Bardieten« versuchte er, die antike Mythologie durch eine germ. zu ersetzen u. schuf eine neue dramatisch-lyrische Form, die aber kaum Resonanz fand u. v. Schiller heftig angegriffen wurde. K., v. der Literaturwiss. zw. Spätbarock u. Klassik eingeordnet, hat prägend f. die Entwicklung der Aufklärung in Dtld. gewirkt, indem er dazu beitrug, die Bedeutung der Religion durch eine Synthese mit der Dichtung zurückzudrängen u. sie durch einen romant. Historismus zu ersetzen. Die Begeisterung seiner Leser ging aber ständig zurück, da in seinen Werken die Abstraktion zunahm, die handelnden Personen unglaubwürdig wirkten u. die künstlerische Stimmung fehlte. Bleibend ist seine Bedeutung als Spracherneuerer, der f. die Trennung der Sprache v. Poesie u. Prosa eintrat, durch seine neue Ausdrucksweise im Ton äußerster Erregung den Leser durch die »heilige Wahrheit« erschüttern wollte u. deshalb die Sprache praktisch wie theoretisch erschloß. Seine Wirkung ist beim Göttinger Hain u. Goethes Sturm-u.-Drang-Gedichten unmittelbar erkennbar, Anregungen wurden v. Wieland, Schiller u. Hölderlin aufgenommen, in seiner Tradition stehen Rilke u. Stefan George. Als erster »freier Dichter«, der im Gegensatz zu den »Hofpoeten« seine geistige Unabhängigkeit wahrte u. mit seinen Werken Gewinn erwirtschaftete, hat K. Status u. Selbstverständnis des dt. Dichters nachhaltig beeinflußt. - K.- Haus in Quedlinburg (1899), K.-Sammlung in Schulpforta. Nachlaß: Stadt- u. Universitätsbibliothek Hamburg; Denecke 190.
Werke:
Der Tod Adams (Trag., 1757); Geistl. Lieder (2 Tle., 1758-69); Salomo (Trag., 1764); Hermanns Schlacht (Drama, 1769); David (Trag. 1772); Hermann u. die Fürsten (Drama, 1784); Hermanns Tod (Drama, 1787); Über Sprache u. Dichtkunst (mit Orthographiereform) (1779/80); Grammatische Gespräche (1794). - Ausgaben: K.s Oden u. Elegien, 1771, Nachdruck 1974; K.s Trauerspiele, 1776; Werke, hrsg. v. Joseph Georg Traßler, 8 Bde. 1785- 86; Poetische Werke, hrsg. v. F.A. Schrämbl, 7 Bde. 1794-95; Werke, hrsg. v. Georg Joachim Göschen, 12 Bände.
CHARAKTERISIERUNG DER HAUPTPERSONEN
Werther:
Zur Hauptsache besteht die Geschichte aus den Briefen die Werther an Wilhelm schreibt, somit fehlen dem Leser Vorkenntnisse über die Person Werthers.
Über das Äußere Werthers, sowie über sein Alter oder seinen Werdegang, erfährt der Leser nichts, man kann aber davon ausgehen, das er sehr gut aussieht und jünger als zwanzig Jahre alt ist.
Diese Dinge werden dadurch belegt, da er nicht nur Charlotte, sondern auch seiner Mutter, sowie seiner Tante gefällt.
Werther besitzt eine große Allgemeinbildung. Er beherrscht die griechische Sprache, und hat Kenntnisse über die Thesen bedeutsamer Theologen und Kunsthistoriker der Weltgeschichte. Werther hat einen skeptischen Bezug zur Wissenschaft. Er vertraut mehr auf sein Gefühl, als auf den Verstand.
Seine künstlerische Begabung zeigt sich darin, das er zeichnet und eine große Liebe für die Literatur hegt.
Werther braucht sich um finanzielle Angelegenheiten keine Sorgen zu machen, da er aus einer Familie stammt die dem gehobenem Bürgertum angehört und somit über ein großes Vermögen verfügt. Er tritt also nicht des Geldes willen in die Dienste des Gesandten ein, sondern weil er sich von Charlotte entfernen will. Es ist trotzdem falsch zu sagen Werther sei ein verwöhnter Sohn aus besserem Hause der sein Leben einzig der Liebe widmet.
Werther ist ein Mensch der sich mit vielen Dingen auseinander setzt.
Er setzt sich bspw. häufig mit der Gesellschaft in der er lebt auseinander:
Seine Vorliebe für Kunst ist darauf zurückzuführen, dass er der Gesellschaft und den Verhaltensweisen der Menschen oftmals kritisch gegenüber steht.
Werther kritisiert mehrmals den Adel, da dieser sich für hochrangiger hält und das einfache Volk meidet.
Dies wird insbesondere deutlich als er sich bei Hofe aufhält und die Rangsucht die dort zu finden ist sehr stark ablehnt.
Er kann und will nicht akzeptieren, dass die Geburt eines Kindes darüber entscheidet welchen Charakter, welche Bildung oder welche Fähigkeiten ein neu entstandener Mensch haben soll.
Das Misstrauen des Bürgertums gegenüber dem Adel äußert sich darin das Werther den Menschen am Hofe nicht vertraut.
Werther lehnt jegliche Grenzen ab, da er mit ihnen nicht leben kann.
Er sucht nach Vergleichen die seine Position am Hofe darstellen.
Er kommt zu dem Entschluß, das er eine Art Marionette oder ein Galeerensklave ist. Werther vermißt die Freiheit, die Schlichtheit und Einfachheit früherer Verhältnisse.
Versuche Freundschaften am Hofe zu finden scheitern an sozialen Grenzen.
Im ,,krassen" Gegensatz dazu, steht aber das er die Ungleichheit der Menschen akzeptiert, da er sie für nötig hält und von ihr sogar profitiert.
Wenn ihm Privilegien Nützen, will er sie nicht abschaffen.
Es geht ihm vielmehr um sein eigenes Glück, als um die Gerechtigkeit der Gesellschaft. Werther hat es schwer sich bei Hofe durchzusetzen, da man ihm sein Glück nicht gönnt.
Die Natur spielt in Werthers Leben ebenfalls eine wichtige Rolle:
Die Natur ist in der zentrale Begriff des Buches und wird schon in dem ersten Brief angesprochen. ,,Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen ringsherum eine unaussprechliche Schönheit der Natur".
Hier wird die Stadt (triste Alltagswelt, Zivilisation, Grenzen) der Natur (Schönheit, Ort des Rückzugs bzw. Flucht, Freiheit, Genie, Gefühl) gegenüber gestellt. Das Stadtleben sieht Werther mit Haß an, weil das für ihn eine Starke Abweichung von Natürlichkeit bedeutet.
Er wechselt von der Gesellschaft in die Natur.
Das Gleichgewicht das er sucht, spiegelt sich seiner Ansicht nach nur in der Natur wieder, da man sich in ihr vollkommen seinen Gefühlen hingeben kann. In Kindern und im einfachen Volk wirkt die Natur noch perfekt.
Sie beide stehen für Unverdorbenheit und Unschuld, und stehen so mit Spontanität und Naivität als Inbegriff für die Natur. Genau aus diesem Grund kommt Werther besonders gut mit diesen Bevölkerungsschichten aus. Er fühlt in der Natur Gott, zudem sieht er in ihr seinen besten Freund.
Im Laufe des Romans verändert sich Werthers ,,Natur- Ansicht", weil er unter der vergeblichen Liebe zu Lotte leidet. Das Maß der Ansicht verändert sich in ähnlichen Maß, wie sein Liebeskummer.
Ist Werther glücklich, empfindet er die Natur sehr genau. Ist er aber unzufrieden, ist seine Vorstellungskraft enorm eingeschränkt.
Die Natur ist eine Art Spiegelung von Werthers innerer Verfassung.
Der aber sicherlich wichtigste Aspekt mit dem sich Werther auseinander setzt, ist die Liebe:
Einzig und allein bei einer verstorbenen Freundin die älter war als er, konnte Werther alle seine Fähigkeiten entwickeln. Diese freundschaftliche Beziehung war eine Seelenverwandtschaft, in der er selbst seine innersten Gefühle preis geben konnte und somit sein Selbstwertgefühl steigerte.
Er erhoffte sich bei Lotte eine Wiederholung dieser Verständigung.
Werther schreibt allerdings, dass er so etwas wohl nie mehr erleben wird.
In dem Moment, als sich Werther in Charlotte verliebt, strahlt sie Idylle, Naivität und Unschuld aus. Aus diesen Gründen kann sich Werther nicht mehr von ihr losreißen- er befindet sich in ihrem Bann. Werther möchte durch die Liebe zu Lotte Teil dieser Idylle werden. Diese Idylle entspricht aber nicht der Realität, es ist viel mehr nur eine Projektion Werthers.
Er bemerkt nicht das auch Lotte viele Probleme hat, wie zum Beispiel die Versorgung der Kinder und dem Haushalt.
In Charlottes Gegenwart und in Werthers Gedanken scheint seine reale Welt zu verschwinden.
Werther tritt in einen Zustand, in dem er befreit von allen negativen Überlegungen ist. Nach diesem Gefühl sehnte er sich bereits in den ersten Briefen.
Die Seelenverwandtschaft die er zu Charlotte spürt, wird bereits im Brief vom 16. Junius angesprochen. Diese bezieht sich hier auf das gemeinsame Interesse für den Dichter Klopstock und kommt für Werther einem Liebesgeständnis gleich. Lotte gewährt ihm Eindrücke in ihre Empfindungen, und Werther ist imstande, diese Empfindungen zu teilen.
Solche Seelenverwandtschaften und die daraus hervorgehenden Gefühlsbeziehungen sind ein wiederkehrendes Thema in Werthers Briefen.
Werther betont oftmals, das Lotte bei ihm glücklicher wäre als mit Albert. Er begründet das immer mit Alberts fehlender Empfindsamkeit.
Im Brief vom 26. Mai beschreibt Werther denjenigen als wirklich Liebenden, ,,der ganz und ausschließlich in dieser Liebe aufgeht". Diese Intensität der Gefühle, kann man aber nur kurz durchhalten.
Werthers Auffassung der Liebe hat also keine Chance sich durchzusetzen.
Zu Lotte entwickelt sich also, eine intensive, geheiligte Liebe, die Lotte nur mit Freundschaft beantwortet. Die langsame Entwicklung zu Charlottes Liebe führt zur Krankheit Werthers. Er will sich von ihr lösen, schafft das aber nicht.
Es ergeben sich also folgende Punkte um Werthers Liebesvorstellung zu erklären:
In der Liebe:
- Entfaltet der Mensch alle Möglichkeiten.
- Gelangt der Mensch zu neuem Selbstwertgefühl.
- Sind die Gefühle der Menschen fähig zu kommunizieren.
Die Liebe lässt sich nicht einschränken, da sie den Gegensatz zur Vernunft bildet.
Werthers große Liebe führt zur geistigen Krankheit:
Die geistige Krankheit die zu seinem Tode führt ist auf die Unerfüllbarkeit seiner Liebe zurückzuführen.
Die Harmonie seines Geistes ist komplett zerstört.
Seine Gefühle zu Lotte sind nicht zu bändigen. Das bedeutet das Ende Werthers!
Er zeigt auf dem Höhepunkt seiner Verzweiflung, Depressionen, Realitätsverluste und eine Abgrenzung nach Außen auf. Dies kommt endgültig zum Ausbruch als Werther einsieht, dass die Liebe zu Lotte keine Möglichkeit auf Erfüllung hat (Letzter Kuss und Ablehnung von Lotte). Um die Frau die er liebt nicht mehr zu belasten begeht er Selbstmord. Dabei durchfährt ihn aber auch ein Gefühl der Zufriedenheit, da er für die Frau sterben kann die er liebt und somit nicht in Vergessenheit gerät.
Charlotte/ Lotte:
Lotte wird als sehr hübsch beschrieben.
Der frühe Tod ihrer Mutter hat äußerlich, sowie innerlich nicht gekennzeichnet. Sie liest viele Romane, in denen sie ihre eigene Person oft wiederfindet. Zudem ist sie eine leidenschaftliche Tänzerin. Durch das Interesse am Tanz, der Literatur und der Musik ist eine Seelenverwandtschaft zu Werther gegeben. Für Werther symbolisiert sie das Bild der älteren, natürlichen Frau, von dem er häufig schwärmt.
Charlotte symbolisiert für Werther Natur und Herz.
In ihrer Familie fühlt Werther sich verstanden und aufgenommen. Werther schafft sich damit einen Ersatz für seine unglückliche Kindheit. Lotte kritisiert an Werther, das er übertrieben Empfindlich und Leidenschaftlich ist. Für sie sind die Regeln der Gesellschaft hoch anzusehen. Sie benötigt einen festen Rahmen, der ihr Rückhalt bieten kann. Zu Albert fühlt sie sich durch ihre Verlobung und Hochzeit verpflichtet bzw. verbunden.
Lotte befindet sich in einem Zwiespalt.
In dieser Zeit hätte sich wohl jede Frau für Albert entschieden, da er als einer der Wenigen ein sicheres, geregeltes Leben bieten konnte.
Charlotte ist sehr bescheiden, weil sie fest davon überzeugt ist, ihre Mutter nicht voll ersetzten zu können. Diese Attribute passen aber sehr gut auf sie, da sie eine gute Christin ist und an das Paradies glaubt.
Lotte ist in der Liebe sehr naiv und unerfahren. Sie ist sich ihrer erotischen Ausstrahlung, die sie nicht nur Werther zeigt, nicht bewußt.
Charlotte ist indirekt schuld an Werthers Tod. Er will sich wegen ihr umbringen. Sie weiß davon reicht ihm aber durch ihr Mittleid bzw. Mitgefühl die Pistole in die Hand.
Hier zeigt sich das auch ein reiner Engel (Zitat Werthers) den Konflikten der realen Welt nicht entkommen kann.
Lotte lässt sich gegen Ende des Romans von Werthers Verstörtheit anstecken. Was früher einmal für sie realistisch wirkte ist jetzt ist jetzt nur noch blasphemisch. Sie zerfließt immer mehr in Mittleid und Trauer.
Desto mehr sich Werther in seine Gefühle hineinsteigert, desto konsequenter muß sie die Grenzen ziehen.
Albert:
Albert ist das Gegenteil von Werther. Er ist erfolgreich, Werther hingegen scheitert bei Hofe. Werther ist leidenschaftlich und launisch, Albert vernünftig, zuverlässig und gelassen.
Albert beschäftigt sich stets mit seiner Arbeit.
Er zieht stets Konsequenzen, d.h. er ist stets verantwortungsbewußt.
Trotz seiner Prinzipienfestigkeit zeigt er viel Gefühl, Mitleid, Sympathie und Einfühlung. Seine Gefühle treten aber hinter die Grenzen der Gesellschaft und der Sitte zurück. Er vertritt außerdem die Seite des Gesetztes.
Die Gelassenheit die Albert ausstrahlt, empfindet Werther als negativ und deshalb als zusätzlichen Kontrastpunkt zu seiner Person.
Der ehrliche und verlässliche Mensch Albert weist sich gegenüber dem genialischen Werther aber als stärker aus.
Werther muß um Lotte werben, Albert ,,besitzt" sie schon. Werther kritisiert oft Alberts Mangel an Sensibilität. Albert ist Werther poetisch nicht genug.
Dadurch fühlt sich Werther ihm gegenüber als etwas besonderes.
Zu einem Konflikt zwischen Albert und Werther kommt es jedoch nicht wegen der gemeinsamen Liebe zu Lotte, sondern wegen den unterschiedlichen Auffassungen über das Thema des Selbstmords.
Albert verurteilt denjenigen, der Selbstmord ausübt, Werther hingegen ist davon überzeugt das man die Gründe einer Tat kennen muss.
Albert bittet Charlotte das sie Abstand von Werther nimmt. Er hat Angst um seine Arbeit und um seinen guten Ruf. Er wird langsam eifersüchtig und merkt erst jetzt, was er an ihr hat bzw. hatte.
Alberts letzte Kritik an Werther und dessen Selbstmord zeigt sich daran, das er Werthers Sarg nicht begleitet.
Mutter:
Sie erscheint nur beiläufig und distanziert. Das einzige, im Buch genannte Motiv zum Aufenthalt in der unbeliebten Stadt, gilt eine Erbregelung, die Werther für sie erledigen soll. Werther ergreift Partei für die Seite der Tante.
Mit dieser Entscheidung ist die Angelegenheit beendet.
Die Mutter wird zusätzlich noch in Verbindung mit der gescheiterten Karriere Werthers gebracht.
Mit ihren Interessen verkörpert sie das bürgerliche Standesbewußtsein, dem Werther entfliehen will.
Werther kann seiner Mutter niemals verzeihen, dass sie ihn in der Stadt eingeschlossen hat.
Der Leser empfindet das Verhältnis Werthers und seiner Mutter als kalt.
Kinder:
Die Person des Werthers lässt immer wieder Parallelen zu Kindern erkennen. Er vergleicht sich oft mit Kindern:
- ,,O was ich ein Kind bin".
- ,,Kinder greifen nach allem, was ihnen lieb ist".
In Kindern sieht er die unverfälschte, reine Natur.
Bauernknecht:
Er tritt als Naturerscheinung im letzten Brief vor dem ersten Treffen mit Lotte als Naturerscheinung auf. Er zeichnet sich hier durch Reinheit, Unschuld und Ausdrucksstärke aus.
In dem Bauernknecht sieht Werther sein Schicksal voraus.
Werther erfährt sein Todesurteil, als der Amtmann ihm eröffnet das der Bauernknecht nicht mehr zu retten ist.
Werther identifiziert sich mit dem Bauernknecht, obwohl beide Schicksale mit dem Tod enden. Der einzige Unterschied ist der, das der Bauernknecht seine Angebetete vergewaltigt. Werther hingegen traut sich das nicht.
Ehemaliger Schreiber:
Werther findet sich auch in dieser Person wieder. Er beneidet ihn um seine Krankheit, da der Schreiber seiner Ansicht nach damit glücklich ist.
Er sieht ihn als eine Art Doppelgänger an.
Fräulein von B.:
Für Werther ist sie die einzige fühlende und empfindsame Seele bei Hofe. Er erkennt bei ihr Charakterzüge von Lotte und sich selbst.
Auch sie fühlt sich eingeschränkt und sieht keine Möglichkeit sich von ihren Standesgrenzen zu lösen.
In Werther findet sie einen Gesprächspartner, der ihre Gefühle und Gedanken nachempfinden kann.
Die Tochter des Schulmeisters:
Ähnlich wie beim Bauernknecht ist diese Erzählung durch zwei gegenläufige Episoden im ersten und zweiten Teil des Romans wiederzufinden.
Sie spiegelt für Werther das unverfälschliche Bild der paradiesischen Anmut wieder. Werther sieht in ihr nur Harmonie und Idylle. Das, das aber nicht der Fall ist sieht man bspw. im Beispiel der Wasserträgerin. Er bemerkt nicht das sie eine große Last auf ihrem Kopf tragen muß, sondern einzig die Verkörperung der Leidenschaft. Werther bemerkt grundsätzlich nicht das ,,der dritte Stand" ein hartes Leben zu führen hat.
Wilhelm:
Werther muß ihn verlassen, obwohl er ihm wiederholt seine Freundschaft gesteht.
Ein Gleichklang der Seelen oder zumindest ähnliche Ansichten sind selten zu erkennen. Wilhelm vertritt die Vernunft des Bürgertums (ähnlich wie Albert), während Werther bekanntlich das leidenschaftliche und geniale Sucht.
Gegen Ende des Buches wird deutlich das sich beide nicht mehr ,,öffnen" können. Der Briefkontakt wird seltener und kürzer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Inhaltsangabe von ,,Die Leiden des jungen Werther"?
Die Hauptperson des Romans ,,Die Leiden des jungen Werther", Werther schreibt seinem Freund Wilhelm Briefe von einer Reise, in denen er seine Erlebnisse schildert. Der Roman besteht hauptsächlich aus zahlreichen Briefen Werthers an Wilhelm. Das wesentliche Ereignis des Romans ist die Bekanntschaft Werthers mit Charlotte, in die er sich prompt verliebt. Werther ist von Amors Pfeilen getroffen und von Charlottes Liebe so entflammt, daß er die Zeit und die Welt um ihn herum total vergisst. Nachdem Charlotte ihm endgültig eine Absage erteilt, weis Werther nicht was er mit seinem Leben anfangen soll und diskutiert mit Albert sogar über Selbstmord. Er beschließt eine Stelle bei Hofe anzutreten. Da sich Adlige bekanntlich stören, wenn ein Bürgerlicher im Saal ist muß Werther diesen bei einer Abendgesellschaft des Grafen verlassen. Werther ist sich der Tatsache das Charlotte vergeben bzw. verheiratet ist zwar bewußt, trotzdem zieht er aber wieder in ihre Nähe. Die letzten Ereignisse fast ein Herausgeber so zusammen das Werther Charlotte küsst und sie ihn deswegen nie mehr sehen will. Werther leiht sich untere falschem Vorwand von Albert eine Pistole aus und begeht Selbstmord um die Ehe Charlottes nicht zu gefährden.
Wer ist Klopstock und welche Bedeutung hat er im Roman?
Friedrich Gottlieb Klopstock war ein deutscher Dichter. Werthers Begeisterung für Klopstock, insbesondere als Charlotte seinen Namen erwähnt, verstärkt Werthers Überzeugung, seine Seelenverwandte gefunden zu haben.
Wie wird Werther charakterisiert?
Werther wird als ein gebildeter, gefühlvoller Mann dargestellt, der der Gesellschaft kritisch gegenübersteht und eine große Liebe zur Natur und Literatur hegt. Er ist unglücklich verliebt und kämpft mit seinen Gefühlen. Er ist ein Mensch der sich mit vielen Dingen auseinander setzt. Werther ist auch sehr naturverbunden und empfindet die Natur als Spiegelung seiner inneren Verfassung.
Wie wird Charlotte/Lotte charakterisiert?
Lotte wird als hübsch, häuslich und vernünftig beschrieben. Sie ist verlobt/verheiratet mit Albert und befindet sich in einem Zwiespalt zwischen ihrer Zuneigung zu Werther und ihren Verpflichtungen gegenüber Albert. Charlotte symbolisiert für Werther Natur und Herz.
Wie wird Albert charakterisiert?
Albert wird als das Gegenteil von Werther dargestellt: erfolgreich, vernünftig, zuverlässig und gelassen. Er vertritt die Seite des Gesetzes und der gesellschaftlichen Normen.
Welche Rolle spielt die Natur in Werthers Leben?
Die Natur spielt eine zentrale Rolle. Sie ist ein Ort des Rückzugs, der Freiheit und des Gefühls. Die Natur spiegelt Werthers innere Verfassung wider: Ist er glücklich, empfindet er die Natur sehr genau; ist er unzufrieden, ist seine Vorstellungskraft eingeschränkt.
Welche Rolle spielt die Liebe in Werthers Leben?
Liebe ist ein zentrales Thema. Werther sieht in der Liebe die Möglichkeit, alle seine Fähigkeiten zu entfalten, ein neues Selbstwertgefühl zu erlangen und sich mit anderen zu verbinden. Seine unerfüllte Liebe zu Lotte führt jedoch zu seiner geistigen Krankheit und schließlich zu seinem Selbstmord. Die Liebe lässt sich nicht einschränken, da sie den Gegensatz zur Vernunft bildet.
Wer sind die Nebenfiguren und welche Rolle spielen sie?
Die Nebenfiguren wie der Bauernknecht, der ehemalige Schreiber, Fräulein von B. und die Tochter des Schulmeisters spiegeln Aspekte von Werthers Charakter und Schicksal wider oder verdeutlichen gesellschaftliche Probleme. Wilhelm, der Adressat von Werthers Briefen, verkörpert die Vernunft und das Bürgertum im Gegensatz zu Werthers Leidenschaft.
Was sind die Gründe für Werthers Selbstmord?
Werthers Selbstmord ist das Ergebnis seiner unerfüllten Liebe zu Lotte, seiner Unfähigkeit, sich in die Gesellschaft einzufügen, und seiner zunehmenden geistigen Krankheit. Um die Frau die er liebt nicht mehr zu belasten begeht er Selbstmord.
Wie wird das Verhältnis Werthers zu seiner Mutter dargestellt?
Das Verhältnis zwischen Werther und seiner Mutter wird als kalt und distanziert dargestellt. Sie verkörpert das bürgerliche Standesbewusstsein, dem Werther entfliehen will. Der Leser empfindet das Verhältnis Werthers und seiner Mutter als kalt.
- Quote paper
- Florian Hofmann (Author), 2001, Goethe, Johann Wolfgang von - Die Leiden des jungen Werther, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99202