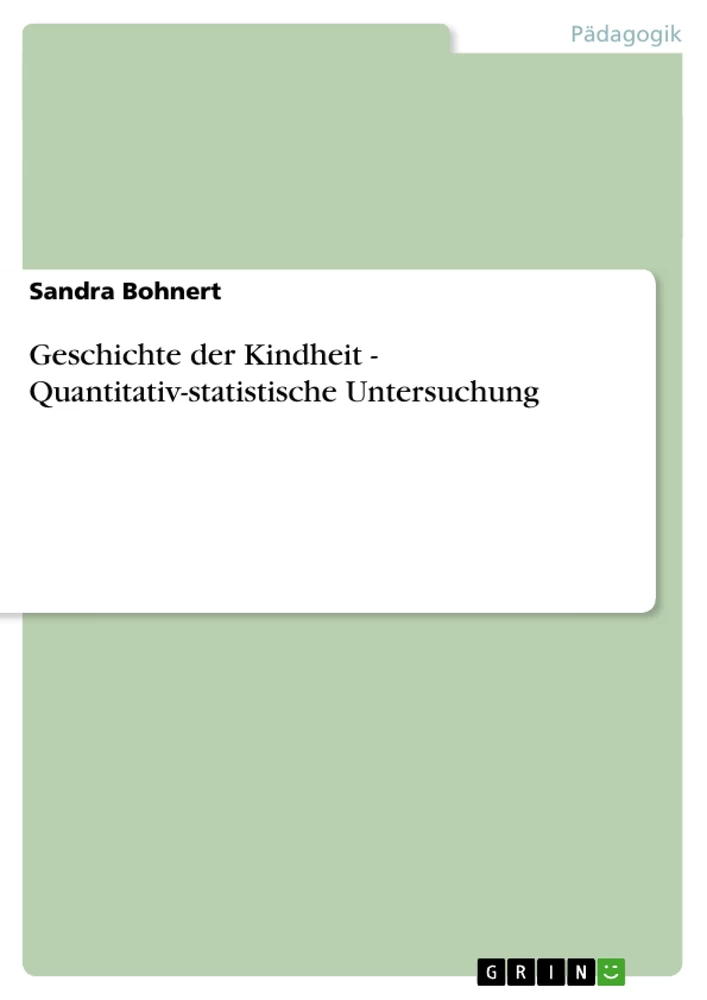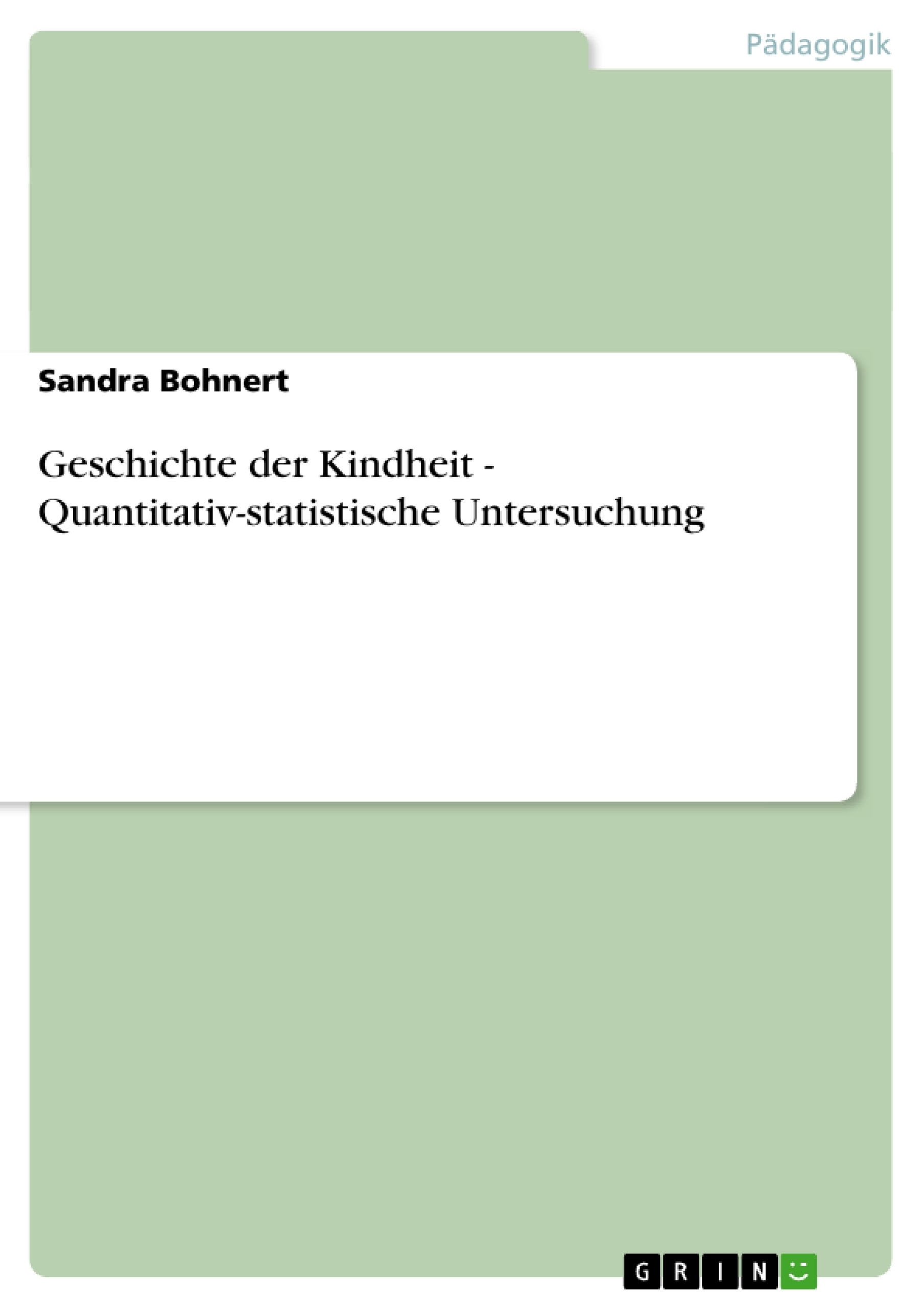1.Quantitativ-statistische Untersuchung
Tabelle 26 (Anmerkung der Hausarbeiten Redaktion: Tabelle war nicht in Hausarbeit enthalten)
Das untersuchte Sample besteht aus 19 Autobiographen, von denen 18 einem psychogenetischen Modus zugeordnet werden konnten. Die Autobiographie Schweinichens wird nur in Bezug auf bestimmte Größen herangezogen und vergrößert das Sample auf 20. Wenn z.B. keine bestimmten Daten für einen Autobiographen zu ermitteln waren, fallen wiederum Autobiographien heraus.
Folgende Beschreibungsmerkmale wurden ausgewählt:
Konfession, Schicht, psychogenetischer Modus von Orientierungs- und Fortpflanzungsfamilie, früher Verlust der Eltern durch Tod, Alter bei der ersten dauerhaften Trennung von Familie, Kindersterblichkeit in Orientierungs- und Fortpflanzungsfamilie. Das Wichtigste bei dem statistischen Vergleich der Autobiographien ist der psychogenetische Modus. Er basiert auf einer qualitativen Analyse. Sie stellt den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit dar.
Abbildung 38 (Anmerkung der Hausarbeiten Redaktion: Abbildung war nicht in Hausarbeit enthalten)
2. Psychogenetischer Modus bezogen auf:
a) Orientierungs- und Fortpflanzungsfamilie: Die Beziehung zwischen Autobiograph und Vater bzw. Mutter lässt sich bei der Orientierungsfamilie sehr häufig nachweisen. Die Beziehungsqualität in der Fortpflanzungsfamilie lässt sich nur selten nachweisen. Das liegt daran, dass die Autobiographen ihre Beziehungen zu ihren Kindern kaum und wenn, dann nur undetailliert darstellen. Z.B. beschreibt auch T. Platter seine Beziehung zu seinen Kindern so vage, dass eine Rekonstruktion der gefühlsmäßigen Beziehung praktisch nicht möglich ist. Hier kann der Modus nur aus der Autobiographie von F. Platter erschlossen werden.
Tabelle 26 an die Tafel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alle anderen hatten entweder keine Fortpflanzungsfamilie oder es ist darüber nichts bekannt.
b) Konfession: Die Mitglieder des Samples werden in drei Kategorien eingeteilt: katholisch, protestantisch und konvertiert (Übertritt von der kath. zur protestantischen Konfession). Da aber jeder Konvertierte katholisch aufgewachsen ist, sind die entsprechenden Kindheitserfahrungen mit der kath. Konfession der Eltern verknüpft. (z.B. T. Platter und Sastrow). Die Autobiographie selbst steht dabei häufig in engem Zusammenhang mit der protestantischen Religionszugehörigkeit. Von den 20 Mitgliedern sind 8 katholisch, 7 protestantisch und 5 konvertiert. Bis 1520 sind alle Autobiographen katholisch; Felix Platter (*1536) ist der erste protestantisch Erzogene. Ab 1550 sind alle protestantisch. (Luther: 1483- 1546, Thesenanschlag:1517).
c) Schicht: Zur Einteilung der Autobiographen in Schichten, spielten vor allem Aussagen über adlige Abstammung und den Beruf des Vaters eine wichtige Rolle. Es wurde in drei Schichten eingeteilt: Ober-, Mittel- und Unterschicht (O, M, U). Zur Oberschicht gehören 7 Autobiographen, zur Mittelschicht 9 und zur Unterschicht 4. Dabei gibt es bei vielen Autobiographen Unklarheiten bei der Schichtzugehörigkeit, z.B. hätte Weinsberg der Oberschicht zugerechnet werden können, da sein Vater Ratsmitglied war. Aber er wurde dann letztlich doch der Mittelschicht zugewiesen. Es gibt in dem Sample nur eine klare Zuweisung: T. Platter konnte ganz klar zur Unterschicht gerechnet werden. Die Oberschicht ist hier über-, die Unterschicht unterrepräsentiert. Das liegt daran, dass Autobiographen gute wirtschaftliche Bedingungen, sowie Muße und finanzielle Mittel brauchen, um sich einer solchen Arbeit widmen zu können.
d) Alter bei der ersten dauerhaften Trennung von der Familie und Verlust der Eltern:
Hier geht es um die Aufenthalte außerhalb der Familie, die für längere Zeit erfolgten. Es wird deutlich, dass die Kinder früher häufiger Aufenthalte außer Haus erlebten als heute. Allerdings konnte hier nicht berücksichtigt werden, welcher Art die Weggaben waren. So stellt z.B. die Weggabe des 10jährigen Butzbach an einen Bacchanten eine erheblich problematischere Erfahrung dar, als etwa die Weggabe Sibenhars mit 7 Jahren, der zu einem Verwandten kommt und dadurch eine gute Ausbildung erhält. Zwei Autobiographen, F. Platter und Birken, hatten keine Weggabeerfahungen als Kind gemacht. Die spätesten Weggaben finden sich bei F. Platter und Birken, die früheste bei Butzbach mit neun Monaten. Bei T. Platter und Diesbach ist das Datum nicht klar.
Der Weggabevorgang steht häufig im Zusammenhang mit dem frühen Verlust eines Elternteils. Alle sehr frühen Verluste (Tod eines Elternteils vor Erreichen des sechsten Lebensjahrs des Kindes) waren mit der Weggabe verbunden und fanden vor Beginn des 16. Jahrhunderts statt. Beim Tod eines Ehepartners wurde häufig die existierende Familie ganz aufgelöst. Dies kann als Hinweis auf mangelnde Bindung an das Kind interpretiert werden. Es entsteht bei den Kindern ein Doppeltrauma: erst erleben sie den Tod eines Elternteils und werden dann auch noch weggegeben. Sie stehen mit ihrer Trauer völlig alleine da.
e) Anzahl der Kinder und Kindersterblichkeit: Die Anzahl der erfassten Kinder liegt bei 166 Kindern. 40% davon sind bis zum Alter von 14 Jahren gestorben. Darunter sind 35% Jungen und 45% Mädchen. Bei einer statistischen Überprüfung kann aber ein deutlicher Unterschied in den Sterblichkeitsraten von Jungen und Mädchen anhand der hier vorliegenden Daten nicht behauptet werden. Das Datenmaterial ist zur Untersuchung empirischer Fragen in Bezug auf die Kindersterblichkeit nicht geeignet. Die Anzahl der Geschwister konnte dagegen leicht erfasst werden (siehe Tabelle 24). Für Seuse und Butzbach konnten keine Angaben gemacht werden. Es wurden nur echte Geschwister erfasst. M. Schwarz´ Vater hatte aus drei Ehen 31 Kinder und wird deshalb auf den höchsten Rangplatz gesetzt, auch wenn wohl die meisten davon Halbgeschwister waren.
2.1 Zusammenhänge
Zusammengefasst kann gesagt werden:
1.) Je später der Zeitpunkt der Kindheit des jeweiligen Autobiographen, desto höher ist der psychogenetische Modus.
2.) Zusammenhang zw. Konfessionszugehörigkeit und psychogenetischem Modus: psychogentischer Modus ist häufig höher bei Vorliegen der protestantischen Religionszugehörigkeit.
3.) Je höher der psychogenetische Modus, desto später erfolgt die erste dauerhafte Trennung von den Eltern.
4.) Zusammenhang zw. Konfessionszugehörigkeit und Epoche: protestantische Konfessionszugehörigkeit kommt in späteren Zeitabschnitten häufiger vor.
5.) Je später der Zeitpunkt der Kindheit des jeweiligen Autobiographen, desto mehr Geschwister hat er.
6.) Je höher die Schicht, desto später erfolgt die erste dauerhafte Trennung von den Eltern.
3. Verschiedene Zusammenhänge
3.1 Der Zusammenhang zwischen Epoche und Modus
Wie Abb. 38 zeigt, finden sich ab ca. 1500 höhere Modi, als der Modus der Weggabe. Es liegt allerdings kein evolutionärer Anstieg, sondern eine Art plötzliches und gleichzeitiges Auftreten der höheren Modi vor. Der intrusiv-sozialisatorische Modus bei Weinsberg liegt schon im Jahr 1500 vor. Vor 1500 werden alle Kinder weggegeben (Sonderfall: Seuse); danach existieren sehr verschiedene Modi, einschließlich des Weggabemodus. Es lässt sich also keine Übergangsphase ausmachen, und Weinsbergs Modus, der höchste Rangplatz im Sample, tritt sofort nach dem schlagartigen Wechsel auf. Der deMause´sche Modus müsste vom 17. Jahrhundert auf das 16. Jahrhundert vordatiert werden.
3.2 Der Zusammenhang zwischen Konfession und psychogenetischem Modus
Protestanten weisen tendenziell einen höheren psychogenetischen Modus auf. Je später der Zeitpunkt der Kindheit eines Autobiographen, desto wahrscheinlicher ist er Protestant. Es kann vermutet werden, dass der Zusammenhang zwischen Konfessionszugehörigkeit und Modus einfach den Zusammenhang von Epoche (Zeitpunkt der Autobiographie) und Modus widerspiegelt.
3.4 Der Zusammenhang zwischen Schicht und psychogenetischem Modus
Von den 9 Mitgliedern des Weggabemodus gehören 3 (Diesbach, Rem, M. Schwarz) der Oberschicht an; 1 (Zink) gehört der Mittelschicht an; 2 (T. Platter, Sibenhar) gehören der Unterschicht an. Es lässt sich festhalten, dass alle Angehörigen der Unterschicht zum Weggabemodus gehören. Weiss man also, dass einer der Autobiographen der Unterschicht angehört, so kann sicher auf den Modus Weggabe geschlossen werden. Umgekehrt kann allerdings nicht vom Modus auf die Schicht geschlossen werden. Drei der Oberschicht gehören zum Weggabemodus, d.h. Zugehörigkeit zur Oberschicht garantiert nicht einen Platz in den oberen Modi: Seuse ist z.B. Adeliger (=O) und ist als die problematischste im Sample anzusehen. Die fünf psychogenetisch höchsten Rangplätze werden von Angehörigen der Mittelschicht eingenommen.
3.5 Der Zusammenhang zwischen psychogenetischem Modus und dem Alter des Kindes bei der ersten dauerhaften Trennung von den Eltern
Trennungen von der Familie erfolgen bei den höheren Modi in späterem Alter. Das hängt mit einer gesteigerten elterlichen Zuwendung zusammen, die unabhängig von der Epoche ist. Dieses Ergebnis stützt die Annahme, dass frühe Trennungen mit einer mangelnden Zuwendung zum Kind,bzw. einer vergrößerten emotionalen Distanz der Eltern zum Kind, einhergehen.
3.6 Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Geschwister und der Epoche
In späteren Zeitabschnitten wurden mehr Kinder geboren. Dieser Zusammenhang ist aber nicht besonders deutlich. Die Autobiographen sagen wenig über ihre Geschwister aus. Es kann somit darauf geschlossen werden, dass die Autobiographen keine starke emotionale Beziehung zu ihnen hatten. Die ausführlichsten Darstellungen von Geschwistern finden sich bei Seuse, Weinsberg, Sastrow und F. Platter.
3.7 Überprüfung der expliziten Forschungshypothesen
Alle formulierten Forschungshypothesen werden im Folgenden genannt und das Ergebnis in Kurzfassung wiedergegeben.
H 1a: ,,Historisch frühere Kindheiten weisen mit höherer Wahrscheinlichkeit einen niedrigeren Modus auf als historisch spätere."
Die Hypothese kann beigehalten werden. Es liegt ein Trend vor, der als Höherentwicklung aufgefasst werden kann.
H 1b: ,,Dysfunktionales (gestörtes) elterliches Erziehungsverhalten findet sich häufiger in historisch früheren Autobiographien."
Diese Hypothese ist nicht völlig eindeutig formuliert. Zum Teil wird hiermit im Grunde genommen die Zuweisungsart mit Hilfe anderer Formulierungen wiederholt. Bei einem Überprüfungsversuch dieser Hypothese ist danach zu fragen, ob etwa der Weggabe-Modus verknüpft sein kann mit zugewandten Elementen in der Zeit vor der Weggabe. Derartige Phänomene könnten in theoretischen Ansätzen angenommen werden, die sozialisatorische Muster eher als gelerntes Verhalten und weniger als psychodynamisches Geschehen auffassen, bei dem Impuls- und Abwehraspekte zu erkennen sind. In Bezug zum Weggabemodus lässt sich kein auffällig zugewandtes Verhalten der später weggebenden Eltern erkennen. Weggabe ist fast immer mit ausgeprägter emotionaler Distanz zum Kind verknüpft. Die frühen Autobiographien von Seuse, Butzbach, Zink und Soest enthalten zudem die deutlichsten Hinweise auf Auswirkungen misslingender Beziehungsaspekte in der Kindheit. Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen wird die Hypothese akzeptiert.
H 1c: ,,Der psychogenetische Modus der Orientierungsfamilie ist meistens niedriger als der der Fortpflanzungsfamilie."
Diese Hypothese kann nur in Ansätzen überprüft werden, da die Autobiographen ihre Beziehung zu den eigenen Kindern nur äußerst rudimentär darstellen. Bei drei Autoren kann sowohl die Orientierungs- als auch die Fortpflanzungsfamilie relativ eindeutig einem Modus zugeordnet werden: Die Familien Schwarz und Platter zeigen einen evolutionären Trend, Weinsberg zeigt dagegen einen deutlichen Abwärtstrend. Die These einer evolutionären Höherentwicklung von Kindheit darf nicht so verstanden werden, dass die jeweils nachfolgende Generation demselben oder einem höheren Modus zugerechnet werden muss, also die Entwicklung einem eindeutig monotonen Trend folgt.
Die kann somit, vorsichtig akzeptiert werden.
H 2: ,,Personen, die später deutlich erkennbare psychische Beeinträchtigungen aufweisen, haben einen Mangel an zugewandten, positive
Beziehungserfahrungen erlebt. (Gleichzeitig lässt sich keine zugewandte Beziehungsfigur erkennen.)"
T. Platter und Butzbach hatten ausreichend gute Beziehungserfahrungen. In der zugespitzten Formulierung der Hypothese finden sich ebenfalls Hinweise im Sample. In bezug auf Seuse, Soest und Butzbach wurden sowohl psychopathologische Merkmale als auch fehlende oder eindeutig pathologische Merkmale der Beziehung zu den Eltern oder Bezugspersonen festgestellt. Zink zeigt eine Halluziation bei auftretenden Ängsten, deren emotionaler Hintergrund durch ein gravierendes infantiles Trennungstrauma gebildet wird. Andererseits ist die Formulierung nicht präzise genug, um direkt überprüft werden zu können. Es kann eine vorsichtige Akzeptanz der Hypothese erlaubt werden.
H 3: ,,Mädchen weisen eine erhöte Sterblichkeitsrate auf. Dies gilt insbesondere für Familien, für die problematische Beziehungsaspekte nachweisbar sind."
Hier wurde zwischen zwei verschiedenen methodologischen Überprüfungen unterschieden: a) der Logik des Einzelfalls und
b) der Untersuchung des Samples.
Es finden sich sowohl Familien, bei denen überproportional viele Jungen sterben (F.familie Rem), aber auch Familien mit auffällig hoher Mädchensterblichkeit (T. Platter). Bei T. Platter hängt dies damit zusammen, dass Schutzmaßnahmen gegen die Pest dem Sohn gelten, nicht aber der Tochter. Dies ist also ein konkreter Mechanismus, der zur erhöhten Mädchensterblichkeit in dieser Familie führt. Bezogen auf das Sample, wurde der Unterschied als nicht sehr deutlich festgestellt. Die Hypothese muss anhand anderer Daten ausgewertet werden.
H 4: ,,Für alle Kinheiten gilt: Vater und Mutter lassen sich in der Darstellung als wesentliche Bezugspersonen nachweisen."
Die Hypothese wird akzeptiert.
H 5 : ,,Väter spielen bei der Betreuung kleiner Kinder keine oder nur eine sehr geringe Rolle:"
Die Hypothese muss relativiert werden. Bei Weinsberg übernimmt der Vater Betreuungsaufgaben. Insgesamt allerdings, sielt der Vater wohl eine relativ geringe Rolle bei der Betreuung für das kleine Kind. Für verschiedene Kinder des Samples wird in der späteren Kindheit der Vater die zentrale Beziehungsfigur, was mit ambivalenten und positiven Aspekten verknüpft ist (Weinsberg, F. Platter, Güntzer). Erst ab dem 16. Jhd. erlangen Väter diese gesteigerte Bedeutung für ihre Kinder.
H 6: ,,Alle Kinder des Samples wurden von ihren Eltern geschlagen."
Diese Hypothese wurde in direktem Widerspruch zur Untersuchung von Pollock formuliert, wobei die fehlerhafte Begründung ihrer Argumentation zurückgewiesen wurde. 55% der Autobiographen wurden mit Sicherheit als Kind geschlagen, bei 20% besteht die Annahme. Von 8 Autobiographen, die das Thema Schläge nicht erwähnen, wurden 5 dem Weggabe-Modus zugerechnet. Die meisten der zugehörigen Darstellungen sind kurz und undetailliert. Diese stammen aber ganz klar von den Autobiographen, die die problematischsten Kindheiten erlebt haben. Insofern sind innerhalb des vorliegenden Samples berichtete Schläge als Prädiktor für einen höheren psychogenetischen Modus als den der Weggabe anzusehen. Das kann auf zwei Weisen interpretiert werden:
1.) Annahme: Die fehlenden Berichte über Schläge entsprechen fehlenden Erfahrungen von Schlägen.
Erklärungsversuch: Die zugehörigen Beziehungen waren derart distanziert, dass Schläge in der Beziehungsrealität eine geringere Rolle spielten. Im Falle von Konflikten wurde das Kind weggegeben.
2.) Annahme: Die fehlenden Berichte über Schläge rühren daher, dass die wesentlichen emotionalen Probleme mit den Eltern nicht anhand des Schlage-Themas artikuliert wurden, sondern in der meist detailarmen Darstellung der Weggabe enthalten sind.
Erklärungsversuch: Zu vermuten wäre dann, dass die Autobiographen Schläge erlebt haben, diese aber nicht für mitteilenswert hielten.
Pollocks Ausführungen konnten als falsch begründet werden. Sie geht von einer relativ geringen Verbreitung der Praxis des Schlagens aus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieser quantitativ-statistischen Untersuchung von Autobiographien?
Die Untersuchung analysiert ein Sample von Autobiographien, um Beziehungen zwischen verschiedenen Merkmalen wie Konfession, Schicht, psychogenetischem Modus, frühem Elternverlust und Kindersterblichkeit herzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf dem psychogenetischen Modus, der durch qualitative Analyse bestimmt wird.
Wie wurde das Sample der Autobiographien für die Untersuchung zusammengestellt?
Das Sample besteht aus 19 Autobiographien, wobei 18 einem psychogenetischen Modus zugeordnet werden konnten. Die Autobiographie Schweinichens wird teilweise einbezogen, um die Stichprobe in bestimmten Aspekten zu vergrößern. Die genaue Größe des Samples variiert je nach verfügbaren Daten für die einzelnen Autobiographen.
Welche Beschreibungsmerkmale wurden für die Analyse der Autobiographien ausgewählt?
Folgende Merkmale wurden berücksichtigt: Konfession, soziale Schicht, psychogenetischer Modus der Herkunfts- und Fortpflanzungsfamilie, früher Verlust der Eltern durch Tod, Alter bei der ersten dauerhaften Trennung von der Familie sowie Kindersterblichkeit in beiden Familien.
Wie wurde der psychogenetische Modus in Bezug auf die Orientierungs- und Fortpflanzungsfamilie analysiert?
Die Beziehung zwischen dem Autobiographen und seinen Eltern wurde häufig in der Herkunftsfamilie untersucht. Die Beziehungsqualität in der Fortpflanzungsfamilie war schwieriger zu ermitteln, da die Autobiographen ihre Beziehungen zu ihren Kindern meist nur vage beschrieben.
Wie wurde die Konfession bei der Analyse der Autobiographien berücksichtigt?
Die Mitglieder des Samples wurden in katholisch, protestantisch und konvertiert (von katholisch zu protestantisch) eingeteilt. Da alle Konvertierten katholisch aufgewachsen sind, wurden ihre Kindheitserfahrungen mit der katholischen Konfession ihrer Eltern in Verbindung gebracht. Die Religionszugehörigkeit steht oft im Zusammenhang mit dem Inhalt der Autobiographie selbst, besonders im protestantischen Kontext.
Wie wurde die soziale Schicht der Autobiographen bestimmt?
Die Einteilung in Ober-, Mittel- und Unterschicht erfolgte hauptsächlich anhand von Aussagen über adlige Abstammung und dem Beruf des Vaters. Es gab jedoch einige Unklarheiten bei der Zuordnung, da manche Autobiographen aufgrund verschiedener Faktoren verschiedenen Schichten hätten zugeordnet werden können.
Welche Rolle spielte das Alter bei der ersten dauerhaften Trennung von der Familie und der Verlust der Eltern?
Kinder erlebten früher häufiger längere Aufenthalte außerhalb der Familie. Der frühe Verlust eines Elternteils (vor dem 6. Lebensjahr des Kindes) war oft mit der Weggabe des Kindes verbunden, was als Doppeltrauma interpretiert werden kann.
Wie wurde die Kindersterblichkeit im Sample erfasst und analysiert?
Von den 166 erfassten Kindern starben 40% bis zum Alter von 14 Jahren. Es wurde versucht, Unterschiede in der Sterblichkeitsrate zwischen Jungen und Mädchen zu ermitteln, jedoch erwies sich das Datenmaterial als nicht ausreichend geeignet für eine eindeutige Untersuchung empirischer Fragen zur Kindersterblichkeit.
Welche Zusammenhänge wurden zwischen den verschiedenen Beschreibungsmerkmalen festgestellt?
Es wurden folgende Zusammenhänge identifiziert: Je später der Zeitpunkt der Kindheit, desto höher der psychogenetische Modus; der psychogenetische Modus ist häufig höher bei protestantischer Religionszugehörigkeit; je höher der psychogenetische Modus, desto später erfolgt die erste dauerhafte Trennung von den Eltern; protestantische Religionszugehörigkeit kommt in späteren Zeitabschnitten häufiger vor; je später der Zeitpunkt der Kindheit, desto mehr Geschwister hat der Autobiograph; je höher die Schicht, desto später erfolgt die erste dauerhafte Trennung von den Eltern.
Wie wurde der Zusammenhang zwischen Epoche und Modus untersucht?
Ab ca. 1500 traten höhere Modi auf. Es gab jedoch keinen evolutionären Anstieg, sondern ein plötzliches Auftreten der höheren Modi. Dies bedeutet, dass der deMause´sche Modus möglicherweise früher datiert werden muss.
Wie wurde der Zusammenhang zwischen Konfession und psychogenetischem Modus analysiert?
Protestanten neigten tendenziell zu einem höheren psychogenetischen Modus. Es wurde vermutet, dass dieser Zusammenhang den Zusammenhang zwischen Epoche und Modus widerspiegelt.
Wie wurde der Zusammenhang zwischen Schicht und psychogenetischem Modus untersucht?
Mitglieder der Unterschicht gehörten fast immer zum Weggabemodus. Die Zugehörigkeit zur Oberschicht garantierte jedoch keinen Platz in den oberen Modi. Die fünf psychogenetisch höchsten Rangplätze wurden von Angehörigen der Mittelschicht eingenommen.
Wie wurde der Zusammenhang zwischen dem psychogenetischen Modus und dem Alter des Kindes bei der ersten dauerhaften Trennung von den Eltern untersucht?
Trennungen von der Familie erfolgten bei den höheren Modi in einem späteren Alter. Dies wurde mit einer gesteigerten elterlichen Zuwendung in Verbindung gebracht.
Wie wurde der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Geschwister und der Epoche untersucht?
In späteren Zeitabschnitten wurden tendenziell mehr Kinder geboren. Dieser Zusammenhang war jedoch nicht besonders deutlich.
Wie wurden die formulierten Forschungshypothesen überprüft?
Alle formulierten Forschungshypothesen wurden genannt und die Ergebnisse in Kurzfassung wiedergegeben. Einige Hypothesen wurden bestätigt, während andere nur vorsichtig akzeptiert oder relativiert werden konnten. Einige Hypothesen erforderten weitere Daten für eine genauere Auswertung.
- Quote paper
- Sandra Bohnert (Author), 2000, Geschichte der Kindheit - Quantitativ-statistische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99194