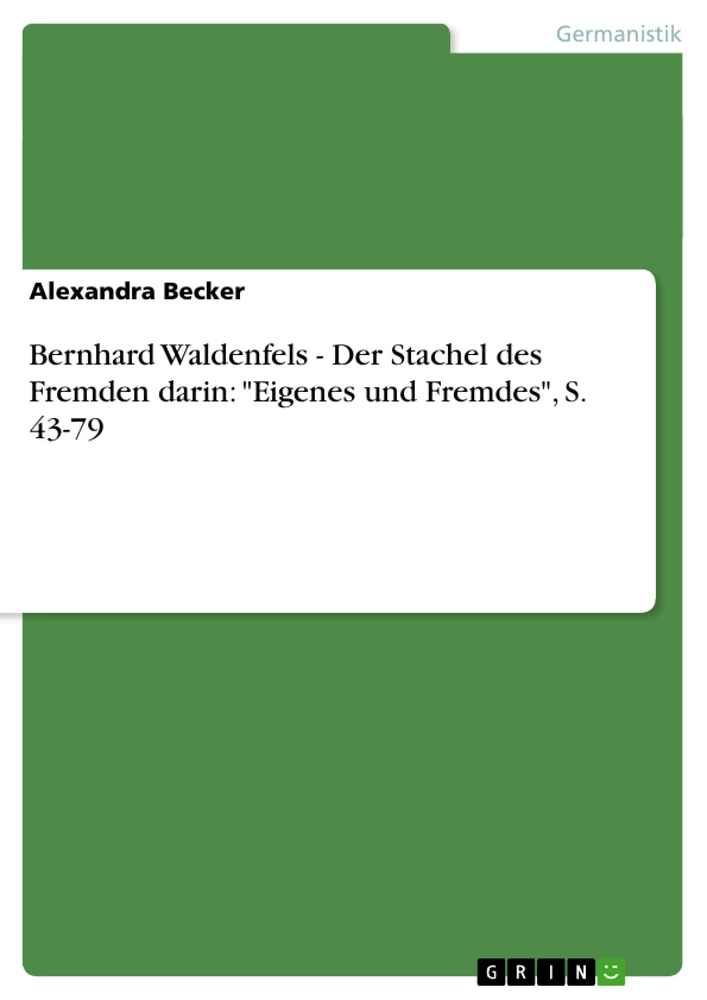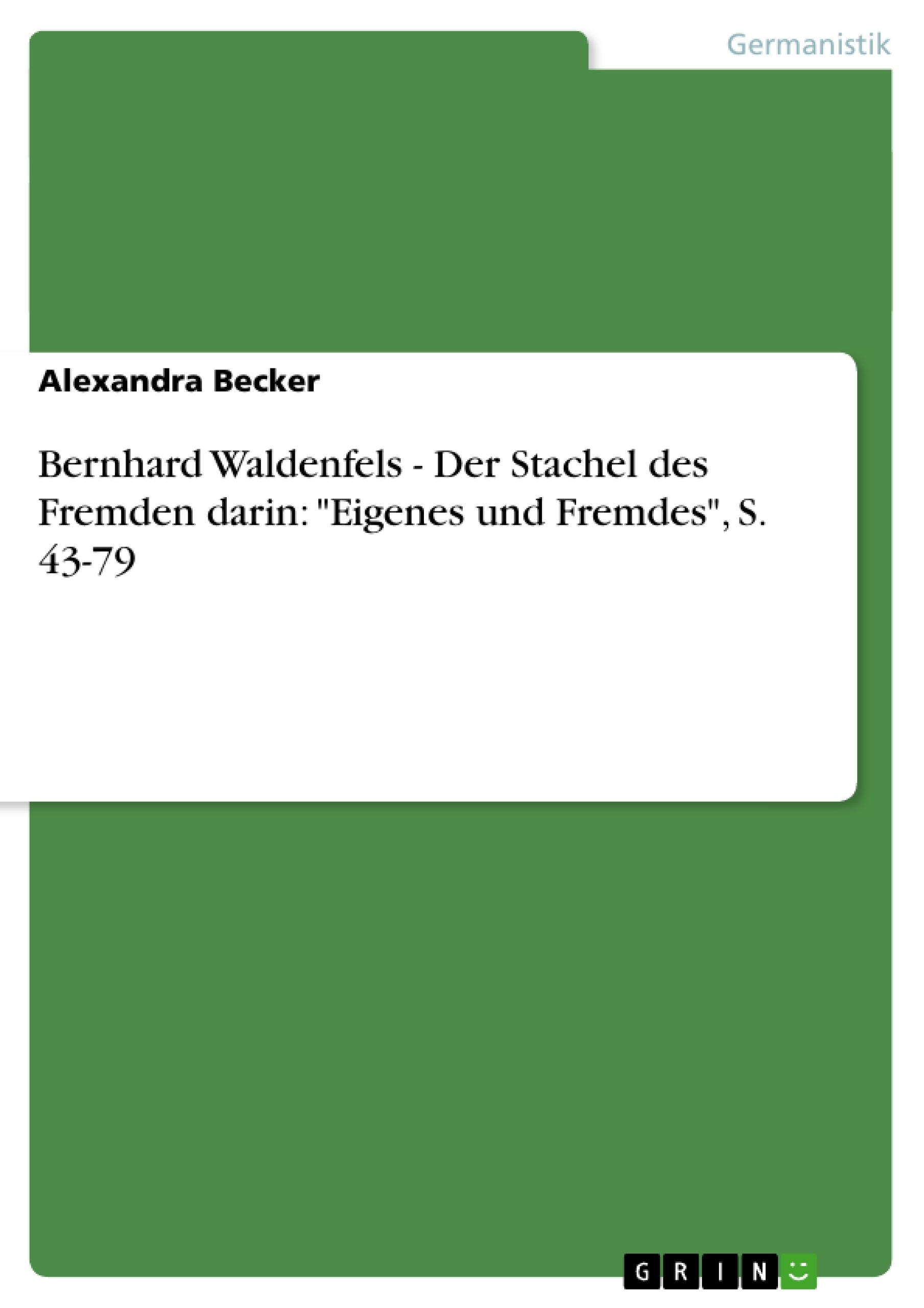Referat
Ich mache nun weiter mit den Kapiteln 3-5 und ihren Themen Dialog und Dialektik, Subjektivität und Intersubjektivität sowie Eigenes und Fremdes. Diese werden unter dem Aspekt der Zwiespältigkeit des Dialogs behandelt.
Das Wort Dialog bezeichnet eine Art Zwischenraum, das Präfix -dia weist hin auf einen Prozess der Teilung. Gegenläufig dazu findet durch den logos, die über allem stehende Vernunft, ein Prozess der Sammlung statt.
Diese Idee von einem logos, einer Vernunft, die als ,,leitende, schlichtende und zentrierende Instanz" letztlich alle Differenzen überbrückt und damit den Dialog zu einem ,,Monolog mit verteilten Rollen" macht, stellt W. in Frage. Im Folgenden zeigt er Punkte auf, an denen eben diese Einheit zerbricht.
Da das Subjekt in der Rolle des Dialogpartners eng mit der Vernunft verknüpft ist wird auch dessen Problematik erläutert.
Begonnen wird mit der Funktion der Frage.
Laut W. liegt ihr größter Vorzug darin, dass sie Verständnis-, Handlungs- oder Begegnungsräume eröffnet und die Selbstverständlichkeit des Offensichtlichen untergräbt. Da sie keinen Wahrheitsanspruch stellt und sich nicht beweisen lässt entzieht sie sich Forderungen nach Universalierbarkeit und Systematisierbarkeit.
Ebenso wenig kann sie als ein pures Wissensstreben mit dem Ziel Wahrheit betrachtet werden, da man sie keiner Fragebewegung einordnen kann. Wäre es anders · ,,... das hieße, dass Fragen nur geweckt, nicht eigentlich gestellt werden."
Manche Fragen stellen ,,sich" auch selbst, ohne dass man einen Fragenden ausmachen könnte, daher kann man sie nicht wie Handlungen kontrollieren.
Obwohl W. einräumt, dass auch die Frage bestimmten Ordnungsfunktionen unterliegt so scheint doch ihr Verdienst gerade der zu sein, dass sie Bereiche, die auf ,,Wahrheit, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit", also z.B. auch Ordnungsbereiche, eben !in Frage stellt!. Damit bildet sie eine wichtige Voraussetzung für einen offenen Dialog.
Desweiteren werden durch die Frage Redefelder organisiert, in denen Dialoge stattfinden können. Indem jede Frage ,,auf etwas hin" befragt, eröffnet sie ein thematisches Feld, Dazugehöriges wird von Nicht-Dazugehörigem getrennt.
Somit kommt der Frage eine elementare Ordnungsleistung zu: die der Selektion und Exklusion.
Stabilisiert werden derartige Redefelder durch die Ausbildung von Typiken, Wiederkehrendes, also typisches, wird von Atypischem nach Gesichtspunkten der Relevanz getrennt. Hinzu kommt der Prozess der Normalisierung, z.B. im Gesprächsstil, und letztlich der Regelung, wie bei Prüfungs- oder Parlamentsordnungen.
Bereits hier erkennt man, dass der Anspruch eines freien Dialogs nicht mehr gewahrt werden kann, W. stellt eine Existenz eines solchen überhaupt in Frage:
,,...es gibt ... aber keinen Freiraum, wo nichts zählt als die Wahrheit.".
Bisher wurde also gezeigt, wie der Widerspruch den Dialog beleben kann. Vorausgesetzt wurde allerdings ein homogenes Feld, denn nur dort kann er funktionieren.
Steht beim Wechselspiel Spruch <-> Widerspruch kein gemeinsamer Bezug zur Verfügung, so führt dies zu dem Phänomen des ,,Aneinandervorbeiredens".
Man sieht: die Rolle des Widerspruchs bröckelt, wenn der Dialog selbst ein Außen produziert, wie z.B. wenn verschiedene Diskursordnungen aufeinandertreffen. Da es keine übergreifenden Maßstäbe, keine allgemeingültige Ordnung gibt existiert auch keine Entscheidungsinstanz. Das homogene Feld zerbricht, der Dialog verzweigt sich in die Vielfalt eines Polylogs.
Hieran knüpft W. bereits das Problem des Subjekts. So lange der Dialog die Form eines ,,Monolog mit verteilten Rollen" besaß, bestand für die Subjekte die Möglichkeit, sich im Besonderen zu ergänzen und im Allgemeinen zu ersetzen.
,,Als Sinnenwesen sind wir einer unter anderen, als Vernunftwesen ist einer so gut wie der andere.".
Nun aber, da die einigende Vernunft, der Logos, sich zerteilt in viele logoi, was passiert mit den Subjekten, den ,,Statthaltern der Vernunft"? Sind sie nur noch Variable, die Leerstellen ausfüllen?
Es stellt sich die Frage: Funktioniert des Diskurs nur, indem er sich auf eine best. Ordnung fixiert?
Wir erinnern uns an die Ordnungsüberschreitende Rolle der Frage. Im Diskurs zeigen sich solche Überschreitungen durch die ihm inneliegende Interdiskursivität und Transdiskursivität. Zu ersterem: Die Linien, die Ordnungen ausgrenzen, überschneiden sich. Absolute Eigenheit und absolute Fremdheit existieren nicht, es gibt Überlappungen, Konsonanzen oder Äquivalente.
Zur Transdiskursivität: Was eine Ordnung ausschließt ist dadurch nicht einfach nicht mehr vorhanden, vielmehr existiert es als Ausgeschlossenes weiter. Ersichtlich wird dies in Abweichungen, Verformungen und Verfremdungen.
Durch diese Erkenntnis werden dem Dialog neue Perspektiven eröffnet. Was diese Perspektiven erschließen sieht man an den drei folgenden Problembereichen Intersubjektivität, Subjektstruktur und Sprachgeschehen.
Intersubjektivität, also ein Austausch und eine Verflechtung von Eigenem und Fremdem findet statt, wenn ein Dialog nicht länger der Ordnung eines Diskurses folgt, wenn der Austausch zwischen Sender und Empfänger nicht mehr durch einen gemeinsamen Code ermöglicht wird, wenn also der Dialog selbst seine Ordnung ändert.
Es ist nicht mehr möglich, Fremdes und Eigenes säuberlich zu trennen, statt in einer symmetrischen stehen sie sich nun in einer asymmetrischen Beziehung gegenüber.
Auch ist das Subjekt selbst bereits durchdrungen von einem anderen, um mit W. zu sprechen: ,,Die Andersheit der Anderen bliebe eine bloße Zutat meiner Erfahrung, wäre sie nicht schon angezeigt in der Andersheit meiner selbst.".
Wo das Subjekt nicht einer festen Ordnung unterliegt geht also auch seine Einheit in die Brüche.
Man erkennt das an der Trennung des Ich in I und Me bei G.H. Mead; D. Lagache erklärt Halluzinationen dadurch, dass die Trennung von Je und Moi, von ,,ich spreche" und ,,es spricht" rückgängig gemacht wurde.
Der Gefahr eines Abgleitens des Subjekts in ein pures ,,es spricht" und damit in eine Rolle eines Untertans, kann man nach W. entgegensteuern, indem man die Mischung, das I und Me fest im Auge behält und damit ,,Handlungen und Äußerungen als dosierte Mischung von Tun, Geschehen und Widerfahrnis, von Eigenem und Fremden betrachtet.".
Wie das Subjekt, so befindet sich auch die Sprache in einem derartigen Mischzustand. Laut Bachtin, dessen Arbeit W. hier zitiert, kann man nicht ,,etwas" bezeichnen, ohne gleichzeitig auch fremde Wörter, Wertungen und Akzente, die in dieses ,,etwas" miteingegangen sind, ebenfalls zu bezeichnen, womit man sich wieder in einem Zwischenraum zwischen Eigenem und Fremdem befindet.
In diesem Zusammenhang wird auch klar, dass ein idealer Autor wie ein idealer Leser bloße Konstrukte sind:
-"Es gibt weder ein erstes, noch ein letztes Wort...".
Im Rahmen der Doppelkrise Vernunft und Subjekt behandelt W. in Kapitel 4 die Herausforderung des Fremden und Bewältigungsmethoden.
Zunächst zur Definition:
Wie Schütz von Neuem und Neuartigem spricht W. von Fremdem und Fremdartigen.
Das Fremde betrifft hier Erfahrungsgehalte und Erfahrungsbereiche:
- ,,Fremd ist, was jenseits der Grenzen dessen liegt, was man mit Husserl Eigenheitssphäre nennen könnte...", z.B. Eigenheit des Leibes, der Wohnung, der Generation, des Heimatlands usw. .
Das Fremdartige betrifft Erfahrungsstrukturen und Erfahrungsordnungen, der Begriff wird dann relevant, wenn Ordnungsgrenzen überschritten werden.
Es gibt 3 Stufen der Fremdartigkeit: Sie tritt auf auf
- gleicher Stufe (ähnlich weit entwickelte Lebensstufen oder Kulturen)
- früherer Stufe (Kindheit <-> Erwachsenendasein, Primitive <-> Zivilisation) und in
- abartigen Zuständen wie Anomalien, Heterologien und Pathologien, also z.B. in Traum, Ekstase und Krankheit.
Daraus ergeben sich drei zentrale Figuren des Fremdartigen:
Das Kind, der Wilde und der Irre bzw. der Narr, dazu kommen in gewisser Weise noch Tier und Automat.
Die Frage ist: Gibt es einen Kern unantastbarer Normalität? Oder durchdringen Eigenartiges und Fremdartiges sich so, ,,dass wir mit Rousseau vom Kind im Erwachsenen, vom Wilden in den Städten, mit Freud vom Kranken im Gesunden, mit Darwin vom Tier im Menschen reden müssen?".
Laut W. ruft alles Fremde zunächst nach Eindämmung und Einschränkung. Zwei klassische Methoden einer solchen Bewältigung, die der Aneignung und Enteignung, werden im Folgenden aufgezeigt.
Zur Aneignung:
Zunächst geht diese Methode davon aus, dass Eigenes und Fremdes klar getrennt sind und die Welt sich aufteilt in eine physische sowie eine soziale Komponente.
Dem wird begegnet durch Egozentrismus und Logozentrismus.
Im Egozentrismus wird alles im Bezug auf das eigene Ich gesehen, das Fremde wird zur bloßen Variation des Eigenen, wobei dieses dem Fremden überlegen scheint.
Im Zuge des Logozentrismus wird alles als Teil einer großen Gesamtordnung unter der Leitung der Vernunft, des Logos, verstanden, das Fremde wird in letzter Konsequenz aufgelöst.
Die Vorgehensweise der Aneignung wird klar, wenn man sich Merleau-Pontys dreifaches ,,Monopol der Vernunft" ansieht:
,,Der Erwachsene hat recht gegenüber dem Kind, der Zivilisierte gegenüber dem sogenannten Primitiven, der Gesunde gegenüber dem Kranken...".
In diesem Zusammenhang wäre dann noch der Ethnozentrismus als Zusammenwirken von Egozentrik und Logozentrik zu erwähnen, wie es sich z.B. in den Kreuzzügen oder der Kolonialisierung zeigt.
Zur Enteignung, man kann sie vielleicht als gegenläufige Methode zur Aneignung betrachten, wird nun die eigene Kultur, das Eigene, aufgegeben zugunsten des Fremden:
,,Das Kind wird zum rettenden Kind, der Wilde zum guten Wilden, Krankheit zur heiligen Krankheit.".
Damit scheint die Egozentrik beseitigt. Jedoch nur vordergründig, wie W. meint:
,,...ein europäischer Buddhist bleibt ein Europäer, der sich zum Buddhismus bekehrt hat".
Der Logozentrik wiederum wird die Aufteilung des logos in eine Vielzahl von logoi entgegengesetzt. Dadurch steuert man einer Entgrenzung zu, einer Auflösung der Grenzen zwischen Fremdem und Eigenem.
W. hält diese Auflösung der Grenzen jedoch für einen Fehler, denn, er zitiert hier Rousseau:
,,Wenn man die Menschen erforschen will, muss man sich in seiner eigenen Umgebung umsehen; will man jedoch den Menschen erforschen, so muss man lernen, seinen Begriff in die Fremde zu lenken.".
Ich hoffe, es ist klar geworden, dass W. beide diese Methoden ablehnt. Vielmehr empfiehlt er ,,ein Agieren und Denken auf der Grenze", wie wir im Folgenden sehen werden.
So sollten z.B. Erfahrungen gemacht und nicht nur gesammelt werden, was ermöglicht wird, in dem man Erfahrungen als eine Auseinandersetzung mit anderem und anderen im Rahmen eines Zwischenraums begreift.
Statt das Fremde als etwas Außenstehendes zu betrachten kann nun mit ihm zusammengearbeitet werden.
Es wird klar, dass eine Trennung zwischen Eigenem und Fremden per se und unauflöslich, nicht besteht. Vielmehr bedeutet Erfahrung einen Prozess, in dem Eigenes und Fremdes durch Differenzierung in versch. Formen und Graden entstehen.
Es gibt also keine Trennung und keine Verschmelzung, vielmehr sieht W. diesen Prozess als eine Art Verflechtung, sein Ergebnis vergleicht er mit den Bändern der Geflechte in romanischen Kirchen. Es wird nicht klar, was was ist, man erlebt vielmehr eine ,,Form der Abhebung im gemeinsamen Feld".
Klarer wird das vielleicht noch in den folgenden drei Formen der Andersheit:
1.Die Andersheit der Anderen
Erinnert man sich an die Annahme, Fremdes und Eigenes seien durch eine Kluft getrennt, so schlägt sich dieses im Diskurs nieder. Bleibt dieser reproduktiv , beschränkt sich also auf ,,Wiedergabe und Weitergabe eines präfabrizierten Sinnes", so mag dies funktionieren.
Je produktiver der Diskurs jedoch wird, also je mehr er Maßstäbe nicht nur anwendet sondern neue schafft, desto weniger kann klar zwischen Sprecher und Hörer, Autor und Leser unterscheiden, vielmehr ,,ergibt ein Wort das andere".
Ich finde mich im Anderen und das Andere in mir im Zuge eines Wechselspiels, das Merleau-Ponty als Chiasma bezeichnet.
2. Die Andersheit meiner selbst
Wenn sich Eigenes im Zusammenspiel mit Fremdem entwickelt und dies ein nie endender Prozess ist, so gibt es keinen originären Eigenbereich mehr.
,,Es gibt keinen Sprecher und Täter, der sich als reiner Autor seiner Reden und Taten aufspielen könnte, es gibt kein Reden und Tun, das nicht auch ein Antworten wäre.". In einer Ordnung, die also nicht fixiert ist, findet das Ich nie ganz zu sich, wieder trägt die Trennung in I und Me.
3. Die Andersheit der fremden Ordnung
Treffen fremde, nicht gleichstufige Ordnungen aufeinander, so darf das nicht als Zeichen absoluter Fremdheit betrachtet werden. Vielmehr gibt es eine anfängliche Zusammengehörigkeit, wie der Vergleich mit der Sprache es zeigt:
W. erwähnt hier einen Versuch von Sapir. Die Silben ,,mil" und ,,mal" sollten wahlweise einem großen und einem kleinen Tisch zugeordnet werden, 80% der Befragten wählten hierbei ,,mil" für den kleinen, ,,mal" für den großen Tisch. Somit existiert eine übergreifende Lautsymbolik, die über der Verschiedenheit der Sprachen steht.
Für die Ordnungen gilt: ,,Die Abweichung von bestehenden Ordnungen bedeutet dann zunächst Andersheit, Verschiedenheit und nicht bloße Unordnung".
Im letzten Kapitel, Kapitel 5, geht es nun noch um das Subjekt.
Zunächst wird es definiert als Markierungszeichen, es grenzt ab und aus. Dadurch bleibt es jedoch immer berührt und bedroht von dem Ab- bzw. Ausgegrenzten. Das Gewicht des Subjekts wird gestärkt durch das Objekt. Dies gilt jedoch nur so lange, wie es abstrakt, und somit ,,Jedermann" ist, schlüpft es jedoch in die Rolle eines ,,Jemand", so steht es in einer Reihe von Mit- und Gegensubjekten.
Je mehr das Subjekt in die Ordnung eingreift, desto mehr wird es von ihr beeinflusst, verliert also seinen Status als etwas, das allem voraus- und zugrunde liegt.
War das Subjekt bisher, um einen Vergleich anzuwenden, eine Art konstitutioneller Herrscher, der weder seine Untertanen noch deren Verfassung machte, sondern als Repräsentant der Ordnung über ihr stand, so wird es selbst zum Untertan, sobald es diesen ,,Thron" verlässt.
Schon kann das Subjekt nicht mehr an seiner Einheit festhalten.
schriftliche Dokumentation / Thesenpapier / Handout
Julika Funk
,,Die Erfindung des Fremden - Europäische Literatur und fremde Welten im 19. Jahrhundert" Referat zu
Bernhard Waldenfels: Stachel des Fremden, Frankfurt/M. 1989, darin ,,Eigenes und Fremdes", 43-79
Referentin: Alexandra Becker
I. Dialog und Diskurse
1. Zwiespältigkeit des Dialogs
Präfix -dia weist hin auf Trennung
Logos weist hin auf Sammlung
Die Idee des Dialogs: die Vernunft überbrückt alle Differenzen
Dialog = ,,Monolog mit verteilten Rollen
2. Vom globalen Diskurs zu regionalen Diskursen
a.) Der Einbruch der Frage
Frage eröffnet Verständnis-, Handlungs- und Begegnungsräume
untergräbt Selbstverständliches
durchlöchert fixe Ordnungen
b.) Ordnungen der Rede
Fragen immer ,,auf etwas hin" · Eröffnung von thematischen Feldern Unterscheidung in Dazugehöriges und Nicht-Dazugehöriges
- Exklusion und Selektion
Stabilisierung der Redefelder durch Typisierung, Normalisierung und Regelungen
c.) Widerspruch und Widerstreit
Widerspruch funktioniert nur im homogenen Feld
Kein gemeinsamer Bezug · Aneinandervorbeireden
Aufeinandertreffen versch. Ordnungen : keine Entscheidungsinstanz:
Dialog => Polylog
d.) Die Rolle des Subjekts
Subjekt = Dialogpartner
Bisher: Ergänzung im Besonderen (~ Sinnenwesen) und Ersetzung im
Allgemeinen (~ Vernunftwesen)
Nun: Keine ,,Einheit" der Vernunft mehr
Subjekte = Variable, die Leerstellen ausfüllen?
3. Verknüpfung und Überschreitung von Diskursen
Interdiskursivität: Überschneidung der Ordnungsgrenzen
Transdiskursivität: Weiterbestehen des Ausgeschlossenen als Ausgeschlossenes!
- neue Perspektiven des Dialogs
a.) Verflechtung von Eigenem und Fremden und die Andersheit der Anderen
Intersubjektivität = Verflechtung von Eigenem und Fremden
Der Dialog ändert seine Ordnung: Beziehung assymetrisch (=keine klare Trennung)
b.) Die Andersheit des Ich
Subjekt außerhalb eines homogenen Felds durchdrungen vom Anderen Ersichtlich: Ich => I / Me (G.H. Mead)
,,Handlung und Äußerungen als dosierte Mischung von Tun, Geschehen und Widerfahrnis, von Eigenem und Fremdem.".
c.) Die Vielstimmigkeit der Sprache
Bezeichnung von ,,etwas" · Mitbezeichnung von Fremdem in diesem ,,etwas"
- ewiger Prozess: ,,Es gibt weder ein erstes noch ein letztes Wort.".
II. Fremderfahrung zwischen Aneignung und Enteignung
1. Fremdheit und Fremdartigkeit
Fremd: Erfahrungsgehalte und -bereiche
Fremdartig: Erfahrungsstrukturen und -ordnungen
3 Stufen der Fremdartigkeit : · gleiche Stufe (Kulturen ähnlicher Entwicklungsstufen)
- frühere Stufe (Kindheit <-> Erwachsenendasein)
- abartiger Zustand (Anomalie, Heterologie, Pathologie)
- 3 zentrale Figuren der Fremdartigkeit: Kind / Wilder / Irrer bzw. Narr
2. Methoden der Fremdenbewältigung
a.) Aneignung
Voraussetzungen: Trennung Eigenes / Fremdes, Trennung physische / soziale Welt
Egozentrismus: Eigenes über Fremdes
Logozentrismus: Auflösung des Fremden im einigenden Logos
Vgl. Ethnozentrismus
b.) Enteignung
vs. Egozentrismus: Aufgabe des Eigenen zugunsten des Fremden
vs. Logozentrismus: Logos · logoi
c.) Alternative: Erfahrung als Auseinandersetzung, Verflechtung
Erfahrung: Innerhalb eines Zwischenraums Entstehung von Eigenem und Fremdem durch Differenzierung · weder Trennung noch
Verschmelzung, vielmehr:
Verflechtung: ,,Abhebung im gemeinsamen Feld"
Wieder 3 Formen der Andersheit:
- Andersheit der Anderen (Wechselspiel Andere <-> Ich)
- Andersheit meiner Selbst (Ich · I / Me)
- Andersheit der fremden Ordnung
Vergleich Sprache: Lautsymbolik über versch. Sprachen
- Zusammengehörigkeit der Ordnungen über Verschiedenheit hinaus
III. Jenseits des Subjektprinzips
1. Subjektproblem und Subjektstreit
Subjekt = Markierungszeichen: grenzt aus und ab
- Aus- und Abgegrenztes als Berührendes und Bedrohendes vorhanden
Subjekt = Jedermann · über der Ordnung
Subjekt = Jemand · Teil der Ordnung
Vermischung von sinnlicher und rationaler Subjektivität · Vielfalt des Subjekts
,,harte" und ,,weiche" Subjekt-Konzeptionen: Diskussion über das Subjekt
aber: was bleibt ist die Verflechtung im Zwischenraum
2. Die Andersheit
Andersheit anderer Subjekte: Wechselrede und Wechselhandlung · Differenz im Zwischenraum
Andersheit von Objekten: Widerspiel geht über den
zwischenmenschlichen Bereich hinaus,
Objekt nicht länger nur Material · Tod des bloßen Objekts
Die Andersheit des eigenen Subjekts: Subjekt nie rein, sondern in
Schranken der Welt
3. Ordnung diesseits von Autonomie und Heteronomie
Traum von Allgemeinheit, Auflösung in Zwischensphäre
aber: jede Rede-, Handlungs- oder Lebensordnung · Selektion und Exklusion
weder Selbst- noch Fremdgesetzgebung
4. Die Schatten des Fremden und Fremdartigen
Objekt = mehr als nur Objekt, Subjekt = mehr als nur Subjekt, aber: Mehr ~ Mit- und Nebenspieler, der nur mitspielt indem er sich den Regeln entzieht
, Handlungs- oder Lebensordnung · Selektion und Exklusion weder Selbst- noch Fremdgesetzgebung
4. Die Schatten des Fremden und Fremdartigen
Objekt = mehr als nur Objekt, Subjekt = mehr als nur Subjekt, aber:
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Der Text behandelt Dialog und Diskurse, Fremderfahrung zwischen Aneignung und Enteignung sowie das Subjektprinzip und seine Grenzen. Die Zwiespältigkeit des Dialogs, die Rolle der Frage, die Überschreitung von Diskursen und die Verflechtung von Eigenem und Fremdem sind zentrale Aspekte.
Was versteht der Text unter "Dialog"?
Der Dialog wird als ein Zwischenraum beschrieben, der sowohl Teilung (durch das Präfix "-dia") als auch Sammlung (durch den Logos) beinhaltet. Die Idee, dass die Vernunft alle Differenzen überbrückt und den Dialog zu einem "Monolog mit verteilten Rollen" macht, wird kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielt die Frage im Dialog?
Die Frage eröffnet Verständnis-, Handlungs- und Begegnungsräume und untergräbt die Selbstverständlichkeit des Offensichtlichen. Sie entzieht sich Forderungen nach Universalisierbarkeit und Systematisierbarkeit und stellt Bereiche wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit in Frage.
Was sind die Ordnungen der Rede?
Redefelder werden durch Fragen organisiert, die thematische Felder eröffnen und Dazugehöriges von Nicht-Dazugehörigem trennen. Diese Redefelder werden durch Typisierung, Normalisierung und Regelungen stabilisiert.
Was passiert, wenn es keinen gemeinsamen Bezugspunkt im Dialog gibt?
Wenn beim Wechselspiel zwischen Spruch und Widerspruch kein gemeinsamer Bezugspunkt vorhanden ist, kommt es zu einem "Aneinandervorbeireden". Der Dialog verzweigt sich in einen Polylog, wenn verschiedene Diskursordnungen aufeinandertreffen.
Wie wird das Subjekt im Dialog betrachtet?
Das Subjekt wird als Dialogpartner betrachtet, der sich im Besonderen ergänzt und im Allgemeinen ersetzt. Da sich die einigende Vernunft in viele Logoi zerteilt, wird die Rolle des Subjekts als Statthalter der Vernunft hinterfragt.
Was bedeutet Interdiskursivität und Transdiskursivität?
Interdiskursivität beschreibt die Überschneidung der Ordnungsgrenzen, während Transdiskursivität das Weiterbestehen des Ausgeschlossenen als Ausgeschlossenes bezeichnet. Beide Konzepte eröffnen neue Perspektiven für den Dialog.
Wie verhalten sich Eigenes und Fremdes zueinander?
Eigenes und Fremdes sind miteinander verflochten und nicht klar trennbar. Das Subjekt ist bereits von einem Anderen durchdrungen, und es findet ein asymmetrischer Austausch statt.
Was sind die Definitionen von "Fremdheit" und "Fremdartigkeit"?
"Fremd" bezieht sich auf Erfahrungsgehalte und Erfahrungsbereiche, während "fremdartig" sich auf Erfahrungsstrukturen und Erfahrungsordnungen bezieht.
Welche Methoden der Fremdenbewältigung werden im Text beschrieben?
Die Methoden der Aneignung (Egozentrismus und Logozentrismus) und Enteignung (Aufgabe des Eigenen zugunsten des Fremden) werden beschrieben. Eine Alternative ist die Erfahrung als Auseinandersetzung und Verflechtung, bei der Eigenes und Fremdes durch Differenzierung entstehen.
Was ist die Rolle des Subjekts im Kontext des Fremden?
Das Subjekt wird als Markierungszeichen definiert, das abgrenzt und ausgrenzt. Es wird sowohl von dem Ab- als auch Ausgegrenzten berührt und bedroht. Das Subjekt kann entweder als "Jedermann" über der Ordnung oder als "Jemand" Teil der Ordnung agieren.
Was bedeutet die Andersheit der Anderen, meiner Selbst und der fremden Ordnung?
Die Andersheit der Anderen beschreibt das Wechselspiel zwischen Ich und Anderem. Die Andersheit meiner Selbst betont, dass es keinen originären Eigenbereich mehr gibt. Die Andersheit der fremden Ordnung erkennt eine anfängliche Zusammengehörigkeit über die Verschiedenheit hinaus an.
- Quote paper
- Alexandra Becker (Author), 2001, Bernhard Waldenfels - Der Stachel des Fremden darin: "Eigenes und Fremdes", S. 43-79, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99178