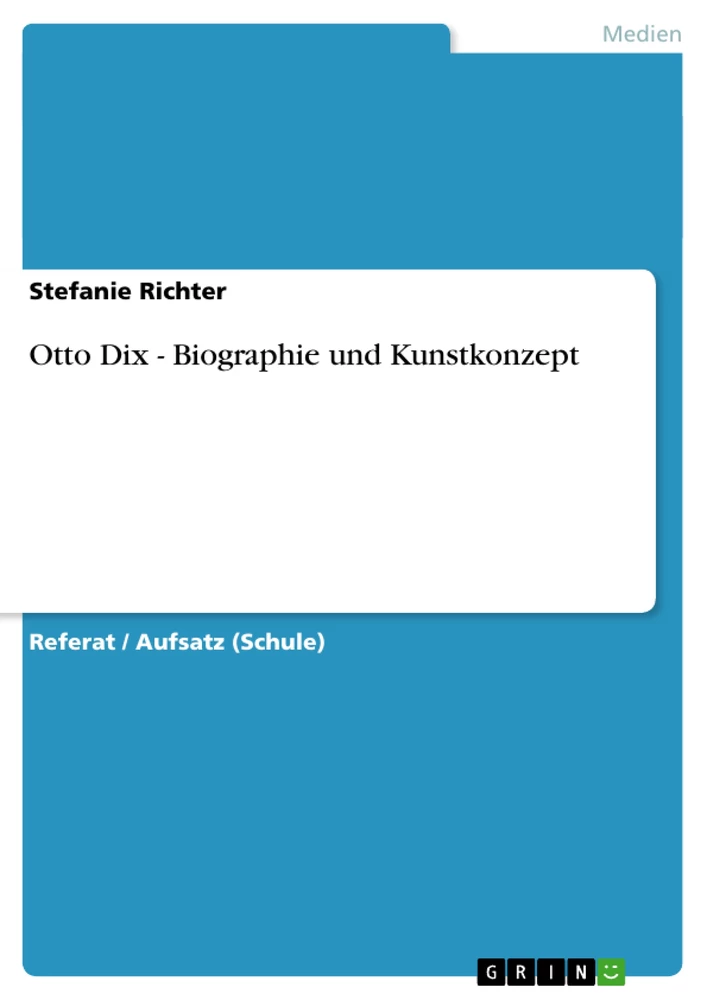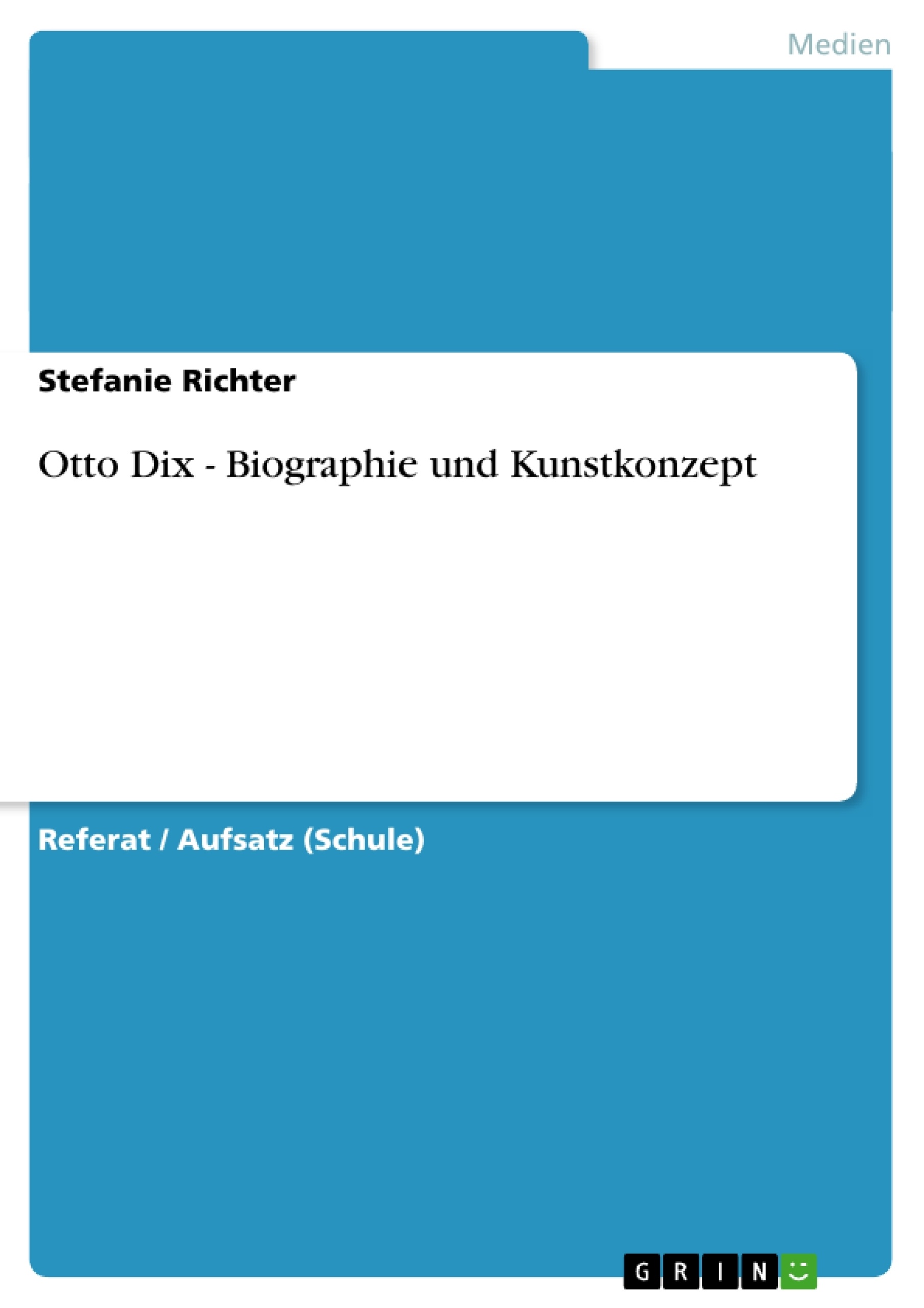Was machte Otto Dix zu einem der bedeutendsten und kontroversesten Künstler des 20. Jahrhunderts? Diese fesselnde Biografie enthüllt das Leben und die künstlerische Entwicklung eines Mannes, der sich von einfachen Verhältnissen in Gera zu einem gefeierten, aber auch verfemten Maler der Weimarer Republik und der Nachkriegszeit entwickelte. Verfolgen Sie Dix' Weg von den frühen Einflüssen durch seinen Cousin und die Kunstgewerbeschule in Dresden über seine traumatischen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, die seine schonungslose Darstellung von Krieg und Gesellschaft prägten. Erleben Sie, wie er zum Mitbegründer der Dresdner Sezession wurde und sich in der Kunstszene von Düsseldorf und Berlin etablierte, wo er mit seinen schonungslosen Porträts und sozialkritischen Werken für Furore sorgte. Tauchen Sie ein in die Welt der Neuen Sachlichkeit, des Dadaismus und des Expressionismus, die Dix' Stil maßgeblich beeinflussten. Die Biografie beleuchtet auch die dunklen Jahre des Nationalsozialismus, in denen Dix als "entartet" diffamiert und aus seinem Lehramt an der Kunstakademie Dresden entlassen wurde. Erfahren Sie, wie er sich in den Jahren des Exils am Bodensee der Landschaftsmalerei zuwandte, ohne jedoch seine künstlerische Integrität zu verlieren. Entdecken Sie die Vielschichtigkeit eines Künstlers, der sich nach dem Krieg stilistisch neu erfand und bis zu seinem Tod im Jahr 1969 ein beeindruckendes Œuvre schuf, das von schonungsloser Ehrlichkeit, sozialer Verantwortung und einem tiefen Verständnis der menschlichen Natur geprägt ist. Diese Biografie ist ein Muss für alle Kunstinteressierten, die mehr über das Leben und Werk dieses außergewöhnlichen Malers erfahren möchten, dessen Bilder bis heute nichts von ihrer Brisanz und Aktualität verloren haben. Sie bietet einen umfassenden Einblick in die künstlerischen Einflüsse, die persönlichen Schicksalsschläge und die gesellschaftspolitischen Umstände, die Otto Dix zu dem Künstler machten, der er war. Schlüsselwörter: Otto Dix, Biografie, Neue Sachlichkeit, Expressionismus, Dadaismus, Weimarer Republik, Erster Weltkrieg, Entartete Kunst, Kunstgeschichte, deutsche Kunst, Porträtmalerei, Kriegsdarstellung, Sozialkritik, Dresdner Sezession, Kunstakademie Dresden, Bodensee, Landschaftsmalerei, 20. Jahrhundert, deutsche Geschichte, Künstlerbiografie.
Biographie Otto Dix
2.12.1891 Geboren in Gera-Untermhaus als Ältester von vier Geschwistern
Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen
Eltern: Franz (1862-1942; Former in Eisengießerei) und Louise (1863-1953) Dix
1899-1905 Besuch der Volksschule in Gera-Untermhaus
1905-1909 Dekorationsmalerlehre im Geschäft des Geraer Malermeisters Carl Senff danach für ein halbes Jahr als Geselle nach Pößneck
1909 ausgestattet mit einem kleinen Stipendium nach Dresden
1910 Studieneintritt an der Königlichen Kunstgewerbeschule
Grundsemester bei Richard Mebert und Paul Neumann Danach Eintritt in die Klasse für Dekorative Malerei von Richard Guhr Wohnte währenddessen beim Hausmeister der Schule; pflegte enge Freundschaft zu dessen Tochter Helene Jakob, an die er später seine Kriegsaufzeichnungen und Feldpostkarten zur Aufbewahrung schickte; Über Herrn Jakob bekam Dix erste kleinere Aufträge
1913 Reise nach Österreich und Italien
Sommer 1914 freiwilliger Eintritt in den Militärdienst zu Beginn des 1. Weltkrieges
Herbst 1914 nahe Dresden Ausbildung zum Artilleristen
Frühjahr 1915 Ausbildung zum Schützen am Maschinengewehr in Bautzen
Herbst 1915 Fronteinsatz
Stationen: 12/1915 Bétheniville, Frankr.; Frühjahr 1916 Aubérive, Frankr.; Sommer 1916 Reims, Frankr.; Herbst 1916 Angres, Frankr.; Ende 1916 Flandern Nähe Knoecke;
1917 Ostfront bei Gorodniki, Rußland; Anfang 1918 Westfront in der Nähe von Langemarck; Spätsommer 1918 Ausbildungslehrgang als Fliegeranwärter,
Ausbildungslager Schneidebühl/Schlesien
während des 1. Weltkrieges mehrmalige Beförderung bis zum Vizefeldwebel
Weihnachten 1918 verbringt D. bei seiner Familie in Gera
Anfang 1919 wieder zurück nach Dresden
1919 Fortsetzung der Ausbildung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in der Klasse von Max Feldbauer
29.1.1919 Mitgründer von Dresdner Sezession- Gruppe 1919
Herbst 1919 wird Meisterschüler von Otto Gußmann
Bekommt ein Einzelatelier im Gebäude der ehemaligen Technischen Lehranstalten
Ende 1920 Reise nach Hamburg
10/1921 Reise nach Düsseldorf; lernt Martha Koch kennen, die beiden verlieben sich; bei seiner Rückkehr nach Dresden begleitet sie ihn
März 1922 Zusammenschluß Junges Rheinland, Dredner Sezession und Berliner Novembergruppe zu einem Kartell fortschrittlicher Künstlergruppen in Deutschland; enger Kontakt zu den Ebenfallsmitgliedern Gert Wollheim, Arthur Kaufmann und Otto Pankok Herbst 1922 verläßt Dresden, geht nach Düsseldorf, wird Meisterschüler beim Expressionisten Heinrich Nauen
2/1923 Heirat mit Martha Koch
14.6.1923 Geburt der Tochter Nelly
Frühjahr 1924 mehrmonatige Italienreise
1925 Umzug nach Berlin
1.10.1926 Dix wird unter Verleih der Dienstbezeichnung Professor als Lehrer in der Akademie der Bildenden Künste in Dresden angestellt
Frühjahr 1927 Umzug mit Familie nach Dresden
11.3.1927 Geburt des Sohnes Ursus
10.10.1928 Geburt des Sohnes Jan
1931 wird als ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Künste berufen
1933 mit der Machtergreifung der Nazis wird ein Parteigänger der Nazis Rektor der Akademie; Dix wird von Anfang an abgelehnt
6.4.1933 Entlassung aus der Akademie wegen ,,unsittlichen und den Wehrwillen beeinträchtigenden" Bildern
Dix gibt außerdem der Forderung nach, aus der Preußischen Akademie der Künste auszutreten
1933 Dix gehört zu den ersten Künstlern, deren Werke in entsprechenden Ausstellungen durch die Nazis diffamiert werden
Sommer 1933 Umzug nach Schloß Randegg am Bodensee; Unterkunft bei Hans Koch (1. Mann von Martha); die Familie ist wirtschaftlich am Boden
1.1.1934 Trotz Ablehnung durch die Nazis erhält Dix die Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer
1934 Dix erhält Ausstellungsverbot in Deutschland
Karl Nierendorf, Freund und Galerist, Zeiten versucht, trotzdem Aufträge und Ausstellungen zu bekommen
1936 Erbschaft für Martha Dix Verbesserung der wirtschaftlichen Lage; Umzug in eigenes Haus nach Hemmenhofen am Bodensee
Ende 44 Anf. 45 Otto Dix wird zum Volkssturm eingezogen
4/1945 Dix gerät in frz. Kriegsgefangenschaft
2/1946 Rückkehr aus Kriegsgefangenschaft nach Hemmenhofen
1949 Ablehnung von Angeboten für Professuren in Dresden und Berlin
25.7.1969 Tod nach Schlaganfall im Krankenhaus in Singen
Künstlerische Entwicklung und Kunstkonzept
Otto Dix kam schon früh mit der Malerei in Kontakt, da er bei seinem Cousin mütterlicherseits, Fritz Amann, einem Naumburger Künstler, schon als Kind in der Werkstatt und manchmal auch Modell saß. Dies weckte in ihm den Wunsch, Maler zu werden. In der Volksschule entdeckte sein Lehrer Ernst Schuncke sein Talent, dieser förderte ihn auch später während der Dekorationsmalerlehre weiter. Gemeinsam unternahmen sie regelmäßig Ausflüge in die Umgebung, wobei erste Aquarelle und Landschaften in Öl entstanden (z.B. Aquarell Landschaft mit Brücke, 1905).
In der Klasse für Dekorative Malerei von Richard Guhr wurde v.a. dekoratives Entwerfen und Modellieren sowie figurales Zeichnen nach Abgüssen und Modellen gelehrt. So entstanden 1909/1910 Landschaften im damals üblichen spätimpressionistischen Stil (z.B. Blick auf Radebeul, um 1910,
Blick auf Dresden-Neustadt, 1910).
Ab 1911 beschäftigte sich Dix mit F. Nietzsche, besonders intensiv mit Die fröhliche Wissenschaft, Zarathustra und Menschliches, Allzumenschliches. Der Einfluß dieser Philosophie war bis in die 30er Jahre spürbar.
In den Jahren 1911/1912 machte Dix auch erste plastische Versuche unter Richard Guhr. Außerdem besuchte er häufig die Dresdner Gemäldegalerie. Besonders beeindruckt war er von der italienischen Malerei des 15. Und 16. Jahrhunderts und der der altdeutschen Maler (vor allem Lukas Cranach, Hans Baldung Grien und Albrecht Dürer).
1912 bis 1913 entstanden viele Selbstporträts, darunter das mit der Nelke. Dabei setzt sich Dix sowohl in der Art der Porträtfassung als auch in der Wahl der malerischen Mittel mit der altdeutschen und der italienischen Malerei des 15. Und 16. Jahrhunderts auseinander. Die Maltechnik bestand darin, mehrere Farbschichten übereinander zu setzen, was als Anfang der Lasurmalerei betrachtet werden kann, mit der Dix sich erst ab 1923 wieder beschäftigte. Im Januar 1912 fand die erste umfassende Expressionisten-Schau in Dresden statt, die ihn auch nachhaltig beeinflußte. Auch die zweite Aufsehen erregende Ausstellung, ebenfalls von der Galerie Arnold organisiert, diesmal mit 41 Zeichnungen von van Gogh, beeinflußten Dix sehr, und die Verarbeitung der Eindrücke erfolgte in den nächsten Jahren in Bildern wie Elbe mit Blick auf die Loschwitzberge, 1912, und Nacht in der Stadt, 1913.
1913 wurde Dix durch die Futuristenschau Waldens in Dresden zur Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Futurismus angeregt.
In den Jahren 1914 bis 1918 entstanden in Gestaltung und Farbgebung vom Expressionismus geprägte Bilder wie Im Unterstand, 1915, und Granattrichter in Blütenform, 1916 , die auch futuristische Elemente aufweisen. Außerdem entstanden zahlreiche Bleistift- und Kreidezeichnungen von den täglichen Kriegserlebnissen. 1916 fand in Dresden eine Ausstellung einiger dieser Zeichnungen statt, die von Helene Jakob zur Verfügung gestellt wurden, der sie von Dix zur Aufbewahrung geschickt worden waren.
Am Anfang des Jahres 1919 war Otto Dix einer der Mitgründer der Dresdner Sezession- Gruppe 1919, weitere Gründungsmitglieder waren Conrad Felixmüller, Otto Schubert, Will Heckroth, Constantin vom Mitschke-Collande, Lasar Segall und Hugo Zehder, Oskar Kokoschka war Ehrenmitglied. Die Hauptgrundsätze der expressionistischen Vereinigung mit sozialkritischen Tendenzen waren Wahrheit- Brüderlichkeit- Kunst.
1919 entstanden zahlreiche Holzschnitte und 16 Gemälde mit expressionistischen, kubistischen und futuristischen Formelementen wie z.B. Das Mondweib. Bildthemen wie Eros, Tod und Geburt, die auch in den folgenden Jahren einen Schwerpunkt von Dix` Arbeit bilden, erscheinen erstmals in diesem Umfang (z.B. Vergänglichkeit, Leda mit dem Schwan, Schwangeres Weib, alle 1919).
Durch seine freundschaftlichen Beziehungen zum Pianisten Erwin Schulhoff, zu Otto Griebel und zu Kurt Günther wurde Dix zunehmend durch die Dada-Bewegung beeinflußt, so daß er ab dem Ende des Jahres 1919 auch die Collage als Stilelement nutzte.
In dieser Zeit arbeitete Dix sehr produktiv. Ab jetzt nahmen die Bilder aggressiv und kritisch zum Zeitgeschehen Stellung. Es entstanden u.a. Prager Stra ß e, Der Streichholzhändler I, Die Skatspieler, Die Erinnerung an die Spiegelsäle in Brüssel, Der Lustmörder (alle 1920). Dix thematisiert nun zum ersten Mal seit der Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg die sozialen und menschlichen Folgeerscheinungen des Krieges.
1920 war Dix auf der 1. Internationalen Dadamesse in Berlin mit seinem Bild Die Kriegskrüppel, 1920, vertreten, welches im Mittelpunkt der Ausstellung stand. Weiterhin wurde er von Conrad Felixmüller in die Techniken von Radierung und Lithographie eingeführt. Über dessen Kontakte zur Düsseldorfer Künstlergruppe Junges Rheinland begann Dix, Radierungen nach Düsseldorf an Johanna Ey zu verkaufen und später dann (ab 1921) über sie auch an Sammler, wodurch er Karriere machte.
1920 machte sich eine Wandlung in Dix` Werk bemerkbar. Er malte vermehrt Porträts in realistischer Darstellungsweise, die den Anfang einer Malerei bildete, die später als Neue Sachlichkeit bekannt wurde. Nach einer Reise Ende 1920 nach Hamburg entstanden Abschied von Hamburg, Alma und Matrosenliebste (alle 1921).
1921 entstanden Porträts mit karikaturistischen Zügen, wie Bildnis Dr. Paul Ferdinand Schmidt, Bildnis Dr. med. Heinrich Stadelmann und Bildnis Rechtsanwalt Dr. Fritz Glaser. Derartige Porträts begründen Dix` Ruf als überragender Porträtist der Neuen Sachlichkeit. Im Mai 1922 fand die 1. Internationale Kunstausstellung statt, bei der Dix` Bilder Fleischerladen, 1920, und Zwei Kinder, 1921, ausgestellt wurden. Im Herbst des Jahres, nachdem er Dresden verlassen hat und nach Düsseldorf gegangen ist, erweiterte Dix seine Kenntnisse der Radiertechnik bei Wilhelm Herberholz, speziell lernte er das grafische
Verfahren der Aquatinta-Technik kennen, die die Grundlage für seine Mappe Der Krieg, 1924, bildete.
1922 entstanden über 200 Aquarelle, 1923 130 Arbeiten. Die Themen waren wieder Eros und Tod,
Porträts, das Spelunken- und Prostituiertenmilieu. Außerdem karikierte Dix humorvoll das Spießer- und Kleinbürgertum. Beispiele sind Bilder wie Der Gott der Friseure, 1922, Dienstmädchen am Sonntag, 1923, und Stra ß enszene, 1922.
1922 und 1923 wurde Dix jeweils einmal wegen Verbreitung ,,unzüchtiger" Bilder angeklagt. Gemeint waren zwei Bilder, die das Prostituiertenmilieu darstellten: Mädchen im Spiegel, 1921 und Salon II, 1921. Dix wurde zwar in beiden Fällen freigesprochen, schickte aber zukünftig derartige Bilder wie auch Drei Weiber, 1926 , nicht mehr auf Ausstellungen. 1923 schuf Dix das Ölbild Der Schützengraben, welches, wie 1 Jahr später der Radierzyklus Der Krieg und 1932 das Kriegstriptychon, in abschreckender Weise die wahnwitzige Grausamkeit des Krieges darstellte.
Dass Dix Vater geworden war, spiegelte sich ab 1923 in den folgenden Jahren in zahlreichen Aquarellen und Zeichnungen, aber auch in Ölbildern, wie Nelly in Blumen, 1924, und Ursus mit Kreisel, 1928 , wider.
Die Düsseldorfer Zeit bedeutete den Durchbruch von Dix` Karriere. Nach dem Umzug nach Berlin erlebte er dort seinen endgültigen Durchbruch als Porträtist. Es entstanden u.a. Bildnis der Tänzerin Anita Berger, 1925 , Bildnis Rechtsanwalt Dr. Hugo Simons,1925, Bildnis des Fabrikanten Dr. Julius Hesse mit Farbprobe, 1926, Bildnis des Dichters Ivar von Lücken, 1926 , Bildnis des Kunsthändlers Alfred Flechtheim, 1926 und Bildnis der Journalistin Sylvia von Harden, 1926 . Seine Darstellungs-absicht dabei war die Erfassung des ersten Eindruckes. 1926 fand außerdem die erste Einzelausstellung von Dix` Werken statt und er war auf der Internationalen Kunstausstellung in Dresden mit mehreren Bildern vertreten. Im gleichen Jahr erwarb die Nationalgalerie Berlin das Bildnis des Philosophen Max Scheler, 1926.
Ab Ende 1926 unterrichtete Dix an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden anfänglich 10 bis hin zu 1933 21 Schüler. Dix gehörte der Gesellschaft der Hirsche an, einem Kreis ,,von Vertretern der verschiedenen künstlerischen und intellektuellen Berufe ohne politisches Credo"1.
Noch aus Berlin hatte Dix Entwürfe für das Gro ß stadttriptychon mitgebracht, das er 1928 fertigstellte.
1927 bis 1929 entstanden außerdem relativ viele Kinderbildnisse, u.a. Neugeborenes Kind, 1927, Bildnis Ursus mit Kreisel, 1928 und Nelly mit Puppe, 1929. Auch Auftragsporträts politischer Persönlichkeiten entstanden, ,,die nicht mehr die bissige Schärfe und genaue Beobachtung der Berliner Bilder besitzen"2.
Dix behauptete sich als etablierter Künstler, war erfolgreich als Professor und nahm an wichtigen Ausstellungen teil: 1928 Europäische Kunst der Gegenwart in Hamburg, 1929 Biennale in Venedig und Internationale Ausstellung Moderner Kunst im Brooklyn Museum, New York.
Ab 1930 beschäftigte sich Dix auch mit Aktdarstellungen, außerdem vermehrt mit allegorischen
Darstellungen, wie z.B. Melancholie, 1930, und Vanitas, 1932.
Als er 1931 zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste berufen worden war, hatte er den
Höhepunkt seiner Karriere als wichtiger Exponent der zeitgenössischen Kunst erreicht.
1932 stellte Dix sein Triptychon Der Krieg, an dem er seit 1929 gearbeitet hatte, erstmals auf der Herbstausstellung der Preu ß ischen Akademie der Öffentlichkeit vor.
1933 entstanden nur vier Gemälde, von denen das wichtigste, altmeisterlich gemalte, Die sieben Todsünden, als erste politische Allegorie verstanden werden kann.
Im September 1933 wurden außer von Kokoschka, Segal und Grosz auch Bilder von Dix (Schützengraben, 1923 , Kriegskrüppel, 1920) auf der Ausstellung Spiegelbilder des Verfalls, einem Vorläufer der Ausstellung Entartete Kunst, ausgestellt. Die zunehmende Diffamierung durch die Nazis machte es für Dix immer schwerer, mit seinen sozialkritischen Bildern Geld zu verdienen und seinen Ruf als Künstler zu verteidigen, so daß er sich ab 1934 langsam der Landschaftsmalerei zuwendete, die politisch unverfänglich und somit auch leichter zu verkaufen war. Noch malte er aber auch allegorische Bilder wie Triumph des Todes, 1934 . 1934 erhielt Dix Ausstellungsverbot.
Sein Studienfreund Franz Lenk, der zwar eigentlich parteilos, aber trotzdem zum Präsidialrat der Reichskulturkammer ernannt worden war, versuchte ihm zu helfen, indem er eine Doppelausstellung (Dix/Lenk; trotz Ausstellungsverbotes) Zwei deutsche Maler organisierte, auf der Dix seine Landschaftsbilder ausstellte, um wieder zu Geld zu kommen und wieder ,,gesellschaftsfähig" zu werden. Außerdem vermittelte Lenk ihm Aufträge wie den des Heeresbauamtes für ein Gebirgsbild für den Gemeinschaftsraum der Unteroffiziere.
In späteren Jahren umging Dix das Ausstellungsverbot, indem er im Ausland ausstellte wie z.B. 1938 in der Galerie Wolfsburg in Zürich bei einer Kollektivausstellung mit seinem letzten großen Kriegsbild Flandern, 1936 und Die sieben Todsünden.
Am 19.7.1937 eröffnete in München die Ausstellung Entartete Kunst, auf der mehrere Bilder von Dix zu sehen waren, u.a. Schützengraben und Die Kriegskrüppel. Im Ausstellungskatalog sind diese beiden Bilder unter der Überschrift Gemalte Wehrsabotage zu finden, was auch die Motive der Dix-Diffamierung durch die Nazis zusammenfaßt. In Zusammenhang mit der Ausstellung waren zuvor aus den deutschen Museen über 260 Bilder von Dix beschlagnahmt worden. Einige dieser Bilder wurden 1939 in Luzern versteigert, andere in eben diesem Jahr im Hof der Berliner Hauptfeuerwache unter Hitler verbrannt.
Außer mit Landschaftsbildern beschäftigte sich Dix von 1936 bis 1945 auch mit allegorischen und christlichen Themen (z.B. Lot und seine Töchter, 1939 ), wobei die Christoforus-Legende besonders oft (5 mal) dargestellt wurde.
Als französischer Kriegsgefangener bekam Dix dort ein eigenes kleines Atelier und durfte malen. So entstanden weitere Landschaftsbilder und Porträts von Offizieren.
Ab 1946 änderte sich Dix` Malweise noch einmal grundlegend. Er malte jetzt wieder wie vor 1922/1923 alla prima, wodurch er sich eine spontanere Malerei erhoffte. Jetzt lehnte er die altmeisterliche zeitaufwendige Lasurtechnik ab, die 20 Jahre Bestandteil seines Werkes gewesen war.
In seinem Spätwerk zeigte Dix noch einmal die gesamte Bandbreite seines Schaffens: außer Porträts,
Landschaften und Stillleben entwickelte er eine besondere Vorliebe für christliche Bildinhalte (Hiob, 1946, Gro ß e Auferstehung Christi II, 1949, Kleine Verkündung, 1950), wobei er sich aber nicht zum Religiösen hinwendete. Seine gegenständliche Malerei geriet mit der zunehmenden Dominanz der internationalen Abstraktion bald als ,,unmodern" ins Abseits, da er nichts von Abstraktion hielt, versuchte er auch nicht, entsprechend ,,modern" zu arbeiten. Er beteiligte sich an vielen Ausstellungen, konnte aber nicht an den Erfolg von vor 1933 anknüpfen. Das war auch finanziell nachteilig, da es keine Kaufinteressenten für seine Bilder gab. In den 50er und 60er Jahren erhielt er viele Ehrungen, z.B. 1959 Bundesverdienstkreuz und Corneliuspreis der Stadt Düsseldorf, 1966 zum 75. Geburtstag die Ehrenbürgerwürde der Stadt Gera und den Lichtwarkpreis der Stadt Hamburg und den Martin-Andersen-Nexö-Preis der Stadt Dresden.
Während seines gesamten Lebens entstanden zahlreiche Zeichnungen.
Quellenangaben
- CD-ROM Kunststück! © 1996 SoftKey International, Inc.
- Meyers gro ß es Taschenlexikon in 24 Bänden, 6. Auflage, B.I. Taschenbuchverlag; Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1998
- Dresdner Hefte 1999, Fritz Löffler: Gemütlichkeit und Dämonie- Malerei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Dresden, 1999
- Richter, Horst: Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert- Stile und Künstler, 8. Auflage, DuMont Buchverlag Köln, 1990
- Herzogenrath, Wolf und Schmidt. Johann-Karl, Dix, Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, 1991
[...]
1 F. Löffler, Otto Dix 1891 - 1969. _uvre der Gemälde, Recklingshausen 1981, S. 35
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments über Otto Dix?
Dieses Dokument bietet eine detaillierte Biographie von Otto Dix, beginnend mit seiner Geburt im Jahr 1891 bis zu seinem Tod im Jahr 1969. Es behandelt seine familiären Verhältnisse, seine Ausbildung, seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und seine künstlerische Entwicklung.
Wo wurde Otto Dix geboren?
Otto Dix wurde am 2. Dezember 1891 in Gera-Untermhaus geboren.
Was waren die Berufe seiner Eltern?
Sein Vater, Franz Dix, war Former in einer Eisengießerei, und seine Mutter, Louise Dix, war Hausfrau.
Welche Ausbildung hat Otto Dix erhalten?
Er absolvierte eine Lehre als Dekorationsmaler und besuchte anschließend die Königliche Kunstgewerbeschule in Dresden.
Wann trat Otto Dix in den Militärdienst ein?
Er trat im Sommer 1914 freiwillig in den Militärdienst zu Beginn des Ersten Weltkrieges ein.
An welchen Fronten war Otto Dix im Ersten Weltkrieg eingesetzt?
Er war an der Westfront (Frankreich, Flandern) und an der Ostfront (Russland) eingesetzt.
Wann wurde Otto Dix zum Professor ernannt?
Am 1. Oktober 1926 wurde Dix als Lehrer in der Akademie der Bildenden Künste in Dresden angestellt und erhielt den Titel Professor.
Wann wurde Otto Dix aus der Akademie entlassen?
Am 6. April 1933 wurde er aus der Akademie entlassen, aufgrund von Bildern, die als ,,unsittlich und den Wehrwillen beeinträchtigend" angesehen wurden.
Warum wurde Dix von den Nazis diffamiert?
Seine Werke, insbesondere seine Kriegsdarstellungen und sozialkritischen Bilder, wurden von den Nazis als entartet und wehrzersetzend angesehen.
Was geschah mit seinen Werken während der Nazi-Zeit?
Viele seiner Werke wurden aus deutschen Museen beschlagnahmt und in der Ausstellung "Entartete Kunst" diffamiert. Einige wurden versteigert oder verbrannt.
Was machte Otto Dix nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nach seiner Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft malte er weiterhin und entwickelte seinen Stil weiter. Er erhielt zahlreiche Ehrungen, konnte aber nicht mehr an den Erfolg vor 1933 anknüpfen.
Wann und wo starb Otto Dix?
Otto Dix starb am 25. Juli 1969 nach einem Schlaganfall im Krankenhaus in Singen.
Welche künstlerischen Einflüsse prägten Otto Dix?
Er wurde von Expressionismus, Futurismus und Dadaismus beeinflusst, sowie von altdeutscher und italienischer Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts.
Was ist die "Neue Sachlichkeit" und wie passt Otto Dix dazu?
Die "Neue Sachlichkeit" war eine Kunstrichtung, die in den 1920er Jahren in Deutschland entstand und sich durch einen realistischen und oft kritischen Blick auf die Gesellschaft auszeichnete. Dix gilt als einer der bedeutendsten Vertreter dieser Richtung.
Welche Themen behandelte Otto Dix in seinen Werken?
Er beschäftigte sich mit Krieg, Tod, Eros, sozialen Problemen, Porträts und später auch mit religiösen Themen und Landschaften.
Was ist die Bedeutung des "Großstadttriptychons"?
Das "Großstadttriptychon" ist ein bekanntes Werk von Otto Dix, das das pulsierende und dekadente Leben in der Großstadt während der Weimarer Republik darstellt.
Welche Quellen werden in diesem Dokument zitiert?
Die zitierten Quellen umfassen eine CD-ROM ("Kunststück!"), Meyers großes Taschenlexikon, Dresdner Hefte, "Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert" von Horst Richter und "Dix" von Herzogenrath und Schmidt.
- Quote paper
- Stefanie Richter (Author), 2000, Otto Dix - Biographie und Kunstkonzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99169