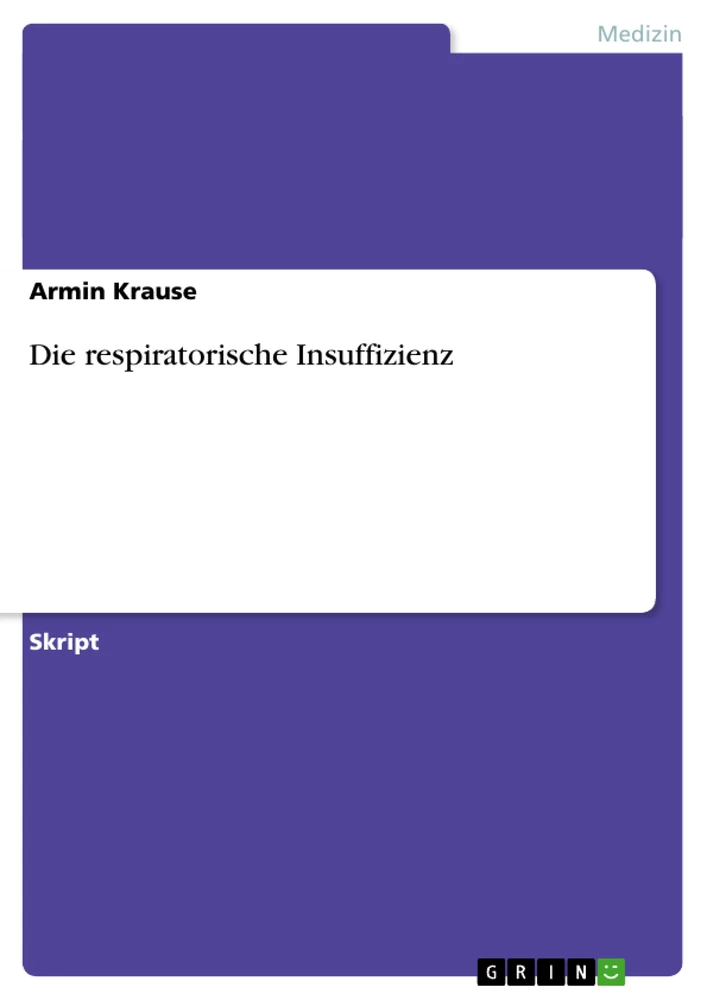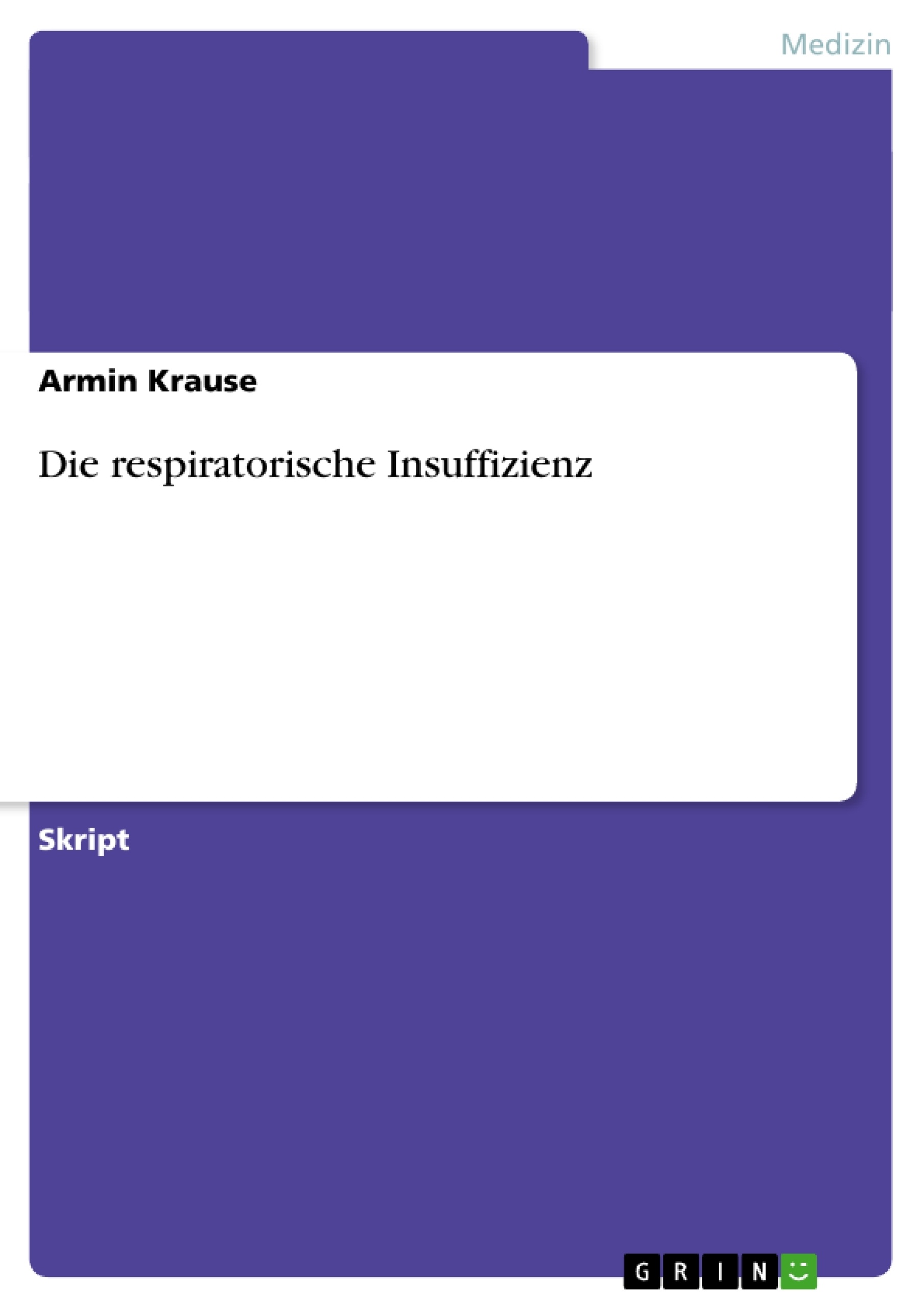Stellen Sie sich vor, Sie kämpfen um jeden Atemzug, ein unsichtbarer Feind raubt Ihnen die Luft. "Die respiratorische Insuffizienz" enthüllt die alarmierende Realität von Atemnotfällen und bietet essenzielles Wissen für Pflegekräfte, die an vorderster Front stehen. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden, der tief in die Erkennung, Behandlung und das Management von respiratorischen Insuffizienzen eintaucht. Von der subtilen Beobachtung erster Anzeichen wie Angst, Verwirrung und veränderter Hautfarbe bis hin zur Beherrschung nicht-invasiver Beatmungstechniken und der rechtzeitigen Erkennung der Notwendigkeit invasiver Maßnahmen – hier finden Sie praxisnahe Anleitungen. Lernen Sie, wie Sie modernste Geräte wie CPAP-Wandplatten und Clini-Jets effektiv einsetzen, potenzielle Komplikationen erkennen und ruhig und besonnen in lebensbedrohlichen Situationen handeln. Erfahren Sie, wie Sie Patienten mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COLD) sicher mit Sauerstoff versorgen und die Indikationen für eine Intubation richtig einschätzen. Vertiefen Sie Ihr Verständnis für verschiedene Atmungstypen, die Bedeutung der Atemhilfsmuskulatur und die Interpretation von Atemgeräuschen, um schnell und präzise zu handeln. Entdecken Sie die neuesten Erkenntnisse zu Ursachen, Symptomen und Therapieansätzen der respiratorischen Partial- und Globalinsuffizienz, von alveolärer Hypoventilation bis zu extrapulmonalen Störungen. Dieses Buch ist mehr als nur ein Lehrbuch; es ist ein Schlüssel, um Leben zu retten und Patienten in ihrer größten Not beizustehen. Es schärft Ihr Bewusstsein für die Bedeutung der kontinuierlichen Krankenbeobachtung, die Rolle von Lagerungstechniken zur Verbesserung der Lungenfunktion und die kritische Abwägung medikamentöser Therapien. Werden Sie zum Experten in der Atemwegsversorgung und meistern Sie die Herausforderungen der Intensivpflege mit diesem unverzichtbaren Kompendium, das Ihnen das nötige Rüstzeug für eine optimale Patientenversorgung an die Hand gibt und Sie befähigt, auch in den kritischsten Momenten einen klaren Kopf zu bewahren. Ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden, der sich der anspruchsvollen Aufgabe der Intensivpflege widmet und das Ziel verfolgt, seinen Patienten die bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Tauchen Sie ein in die Welt der Beatmung, der Sauerstofftherapie und der differenzierten Patientenbeobachtung, um in Notfallsituationen sicher und kompetent agieren zu können, stets das Wohl des Patienten im Blick.
Die respiratorische Insuffizienz
Die Atmung ist Voraussetzung für alle Lebensprozesse!
Ist gibt in der Intensivpflege nichts Vorrangigeres, als dem Patienten zu einer ausreichenden Atmung zu verhelfen. Patienten einer Intensivstation haben oft pathologische Blutgaswerte. Diese Patienten brauchen eine besondere Atemtherapie! Diese Atemtherapie muß nicht gleich die maschinelle Beatmung sein, dem Pflegepersonal stehen Heute eine Reihe von Hilfsmöglichkeiten zu verfügung um eine Verschlimmerung einer Ateminsuffizienz zu verhindern.
Die Krankenbeobachtung spielt dabei eine große Rolle:
- das Pflegepersonal sollte in der Lage sein eine respiratorische Insuffizienz zu erkennen; dies bezieht sich nicht allein auf Laborparameter sondern auf die körperliche Symptomatik bei einem Atemnotsyndrom.
Welche Hilfsmittel stehen dem PP zu verfügung:
- Das PP muß in der Lage sein, mit nicht invasiven Atemtherapiegeräten (CPAP-Wandplatte, Clini-Jet, diversen Aerosolvernebler) umzugehen und diese situationsgerecht bei einer Ventilationsstörung einzusetzten. Auch sollten sich alle Anwender bewußt sein, welche Komplikationen dabei auftreten können.
Das PP muß die Notwendigkeit für eine künstliche invasiven Beatmung erkennen können und wissen, wann und wie mit einer Beatmungstherapie begonnen werden muß und woran man erkennt, wie der Patient darauf reagiert.
Wichtig ist, daß das PP nicht die Indikation für eine künstliche Beatmung stellt, aber durch ständige Krankenbeobachtung bemerkt die Pflegekraft in der Regel eine Verschlechterung der Atmung als erstes.
Sie hat auch die Aufgabe den Arzt sofort davon zu verständigen.
Sie hat auch die Aufgabe durch ruhiges und umsichtiges Verhalten ein positives Umfeld für den Patienten zu schaffen. Ein Patient mit respiratorischer Insuffizienz hat Angst, die sich bis zur Todesangst (bei drohenden Ersticken) steigern kann. Es muß uns bewußt sein, daß dies ein existentieller Zustand für den Patienten ist. Die Angst des Patienten wird sicher nicht durch hektisches unadäquates Verhalten gemildert.
Bei einer letalen Bedrohung ist richtiges Handeln gefragt, auch wenn man dem Bedürfnissen und dem positiven Umfeld des Patienten nicht immer gerecht wird.
Eine akute Ateminsuffizienz führt zu einem Sauerstoffdefizit, das schnell zu einer Schädigung des Gehirns führen kann. Denken Sie an Hypoxie, wenn sie chrarakteristische zeichen wie Ängstlichkeit, Verwirrung und Agitiertheit sehen. Auch kann der Patient streitlustig oder aggresiv werden. Wie ist die Atmung? Ist eine Dyspnoe vorhanden, ist die Atemfrequenz und der Atemrhythmus verändert? Wie ist die Hautfarbe? Ist der Patient zyanotisch oder grau? Ohne Sauerstoff gerät ein solcher Patient schnell in eine Azidose und in einen Schock. Messen sie deshalb bei einem ängstlichen und verwirrten Patienten sofort den Blutdruck und den Puls( eine Bradykardie ist ein spätes Zeichen der Hypoxie und der Hyperkapnie).
Ist die Absaugvorrichtung in Takt, Pulsoxymeter, Sauerstoffsonde oder 100%-Ambubeutel, Intubationstablett und die dazu gehörigen Medikamente und ggf. ein Beatmungsgerät.
Die sofortige Sauerstoffgabe bei einem Patienten ist nicht ohne Gefahren, Pat. mit COLD ( chronische obstruktive Lungenerkrankungen) reagieren nicht mehr auf das CO2 im Blut sondern auf das O2 , bei Verabreichung von Sauerstoff erkennt das Atemzentrum nur noch auf den Stimulus "genügend Sauerstoff" und reagiert mit einer Atemdepression (O2-Narkose) -> Atemstillstand infolge von Hyperkapnie . Ein unruhiger ateminsuffizienter Patient sollte nur unter sorgfälltiger Kontrolle atemdepressive Medikamente (Analgetika, Sedativa) bekommen --> Respi.-Kontrolle.
Als Pflegepersonal sollte man immer bedenken, daß ein Patient mit schlechten Blutgaswerten nicht immer schlecht aussehen muß!
Atmungstypen
Zyanose: Ein spätes Zeichen
Eine gefährliche Hypoxie kann schon bestehen, bevor eine Zyanose sichtbar wird. Das Auftreten einer Zyanose ist zuerst an der Munschleimhaut sichtbar. Bei chronischer Hypoxie enstehen Trommelschlägelfinger und -zehen. Diese Zeichen finden sich gewöhnlich bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COLD) und bei Fallotscher Tetralogie. Bei Kohlenmonoxid-Vergiftung und eine Hb < 5g/dl tritt keine Zyanose auf.
Dyspnoe
Wie stark ist die Dyspnoe ausgeprägt? Wie stark wir der Patient von der Dyspnoe beeinträchtigt? Kann der Patient trotz Atemnot noch sprechen? Bei einer Orthopnoe wird der Patient eine flache Rückenlagerung nicht akzeptieren können.
Atemfequenz
Eine Atemfrequenz < 12 - und > 25 Atemzüge pro Minute kann ein Warnsignal bedeuten. Ein erhöhte Atemfrequenz garantiert keine ausreichende Lungenventilation. Die Tiefe eines Atemzuges ist genauso wichtig. Tiefe Atemzüge mit geringer Frequenz deuten auf einen Versuch des Körpers hin, toxische Produkte "abzuatmen". Bei flacher und schneller Atmung ist die Gefahr der ungenügenden Ventilation und der Hypokapnie gegeben -> Tetanie. Die Atemfrequenz sollte nicht allein durch die Respi.-Anzeige kontrolliert werden, beim resp. Insuffizienten Patienten ist es wichtig die Atemfrequenz manuell zu zählen.
Atemhilfsmuskulatur
Ein Patient mit starker Orthopnoe wird immer seine Atemhilfsmuskulatur zur Atmung benötigen. Mitbewegung des ganzen Thoraxbereiches einschließlich Schulter- und Bauchmuskulatur. Dieser Patient wird sich im Bett aufrischten und hinsetzten um besser Luft zu bekommen. Durch die starke Anstrengung bewegen sich die Nasenflügel stark.
Abnorme Thoraxbewegungen
Abnorm bewegliche Thoraxwand bzw paradoxe Wandbewegungen bei Pneumothorax Rippenserienfrakturen und Abriß der Rippen im Knorpelbereich. Bei angeborenen-
(Trichterbrust und Hühnerbrust) und bei erworbenen ( Faßthorax bei chronischen
Lungenemphysem) Thoraxabnormität.
Atemgeräusche
Ohne Stethoskop hörbar:
- brodelndes Geräusch bei Lungenödem
- Stridor (heiser, metallisch) , inspiratorisch oder exspiratorisch
--> Asthma bronchiale (exspiratorisch), Krupp (inspiratorisch)
- Brummende Töne enstehen durch Einengung der Atemwege (Verlagerung des Bronchialsystems durch Sekret)
Hörbar mit Stethoskop
- Bronchialatmen (laut, hochfrequent, deutl. Pausen zw. Inspir. und Exspr.) über Trachea und Bronchien. Bei allen pathologischen Verdichtungen des Lungengewebes z.B. Pneumonie.
- Vesikuläratmen (weiches, tieffrequentes, rasselndes oder knisterndes Geräusch, das mit der Einatmung anschwillt und bei der Ausatmung abnimmt ohne Pause dazwischen) hört man über allen Lungenbezirken außer Trachea und Bronchien.
- Fehlende oer verminderte Atemgeräusche können viellerlei Veränderungen anzeigen, z.B. Atemwegsobstruktion, Pneumothorax, Emphysem oder Pleuraerguß.
- Feinblasige Rasselgeräusche treten auf, wenn die Luft ausgetretene Flüssigkeit bewegt --> Lungenödem
- Mittelblasige oder grobblasige Rasselgeräusche (lautes, tieffrequentes Gurgeln) tritt auf, wenn starke Sekretansammlungen den Bronchialwänden anhaftet.
- Pleurareiben ("Schneeballknirschen") kann eine Pleuraerkrankung oder eine Lungenfibrose anzeigen, z.B. eine Pleuritis sicca
- Bronchophonie, beim Flüstern von "66" hört man über Bezirken von verdichtetem Lungengewebe oder Pleuraerguß die Worte deutlicher als über anderen Lungenbezirken.
Freihalten der Atemwege
Sobald Sie eine Atemnot bemerkt haben, ist es die erste Aufgabe, die Atemwege freizuhalten. Der Kopf sollte bei eingetrübten- und komatösen Patienten so gelagert werden, daß die Zunge nicht nach hinten fallen und die Luftwege versperren kann. Die Mundhöhle sollte auf Blut, Erbrochenes, Zahnprothese und andere Fremdkörper untersucht werden. Das richtige
Einlegen eines Guedel-Tubus, erleichtert das Absaugen und verhindert das die Zunge zurück fällt.
Patienten die noch bei bewußtsein sind, werden am besten in den "Pilotsitz" gebracht. Bei einem Herzbett wird das Kopfteil hochgestellt und das Fußteil abgelassen, so daß der Patient in eine gute Sitzposition gebracht wird. Bei starker Orthopnoe empfiehlt es sich die Arme mit Kissen zu unterstützen un den Thorax und damit die Atemhilfsmuskulatur zu entlasten.
Respiratorische Insuffizienz
Def.: Durch pulmonaler oder extrapulmonaler Ursachen ist der Wirkungsgrad der Atmung so weit herabgesetzt, daß es zur Blutgasveränderung kommt. Man unterscheidet 2 Formen der respiratorischen Insuffizienz:
A) Partialinsuffizienz mit Hypoxämie
B) Globalinsuffizienz mit Hypoxämie und Hyperkapnie
Ät.:
1) alveoläre Hypoventilation infolge Beeinträchtigung des Atemantriebs (Narkoseüberhang, Analgetika und Sedartiva)
2) pulmonale Diffusionsstörung
3) pulmonale Verteilungsstörung
A) Pulmonale Verteilungs- und Diffusionsstörung:
--> Lungenerkrankungen unterschiedlicher Genese
- Lungenödem
- COLD
- Exazerbation eines Asthma bronchiale
- Cor pulmonale
- Pneumonie
- ARDS
B) Extrapulmonale Ursache:
1) Störungen im ZNS: z.B. Apoplexie, Intoxikationen, Schädel-Hirn-Trauma Koma diabeticum und - uraemicum
2) Störungen im Rückenmark: z.B. Polyomyelitis, traumatische Schäden
3) Neuromuskuläre Schädigungen: z.B. Myasthenia gravis, Tetanus, Botulismus, Intoxikationen (Cholinsterasehemmer E 605, Curare)
4) Erkrankungen der Thoraxwand und Pleura: z.B. Rippenserienfraktur, Spannungspneumothorax, großer Pleuraerguß
5) Obstruktion der oberen Luftwege: z.B. Glottisödem, Laryngospasmus, Fremdkörper- aspiration
Pg.: Lungenerkrankungen führen zuerst zu respiratorischer Partialinsuffizienz (Hypoxämie)
Solange die Ventilation ausreichend gesteigert werden kann, bleibt die CO2-Spannung normal oder fällt durch Hyperventilation ab. Bei ventilatorischen Versagen ( infolge Ermüdung der Atemmuskulatur oder extrapulmonaler Ursachen - s.o.) findet sich degegen stehts eine respiratorische Globalinsuffizienzu (Hypoxämie + Hyperkapnie)
Kl.: Bei respiratorischer Partialinsuffizienz Symptome der Hypoxämie:
Zyanose, bei längerfristiger Hypoxämie Polyglobulie, motorische Unruhe, Verwirrtheit, Bewußtseinsstörungen, Tachykardie und Bradykardie, ev. Rhythmusstörungen Bei respiratorischer Globalinsuffizienz:
Symptome der Hypoxämie + Symptome der Hyperkapnie: Kopfschmerzen, Schwindel Schwitzen...
Verlauf:
1) akut: (z.B. Obstruktion der oberen Luftwege)
2) chronisch: ( fortgeschrittene Lungenerkrankungen)
Th.:
1) Kausale Therapie: Behandlung der Grundkrankheit
2) symptomatische Therapie:
* bei akuter respiratorischer Insuffizienz und Atemstillstand: Freimachen der Atemwege + Beatmung
* chronischer respiratorischer Insuffizienz evtl. O2-Langzeittherapie
Hinweis zur Behandlung mit O2:
A) Partialinsuffizienz:
Zyanotischer Patient mit Hypoxämie, aber pCO2 normal: O2-Gabe ohne Gefahr B Globalinsuffizienz
Merke: Der Atemantrieb durch O2-Mangel ist noch wirksam, wenn der Co2-An-
trieb durch Hyperkapnie ( > 60 mm Hg) schon ausgefallen ist, was bei diesen Patienten der Fall ist. Daher bringt man den Patienten mit unkontollierten O2-Gaben in ernste Gefahr, weil ihnen damit der letzte Atemantrieb genommen wird. Hier muß eventuell durch kontrollierte Beatmung mit einem Respiratorgerät O2 zugeführt werden, wodurch die Atmung erst gar nicht sistieren kann. Gleichzeitig kann gesteuert das pCO2 gesenkt werden und kannden Atemantrieb wieder übernehemen.
Nicht nur die BGA ist bei der respiratorischen Insuffizienz ausschlagggebend sondern auch die Krankenbeobachtung. Wird ein Kranker in der resp. Insufizienz unruhig, delirant bis aggresiv oder stupurös bis somnolent, kann dies immer ein Zeichen einer Verschlechterung sein. Wichtig ist aber zu beachten, daß es Patienten gibt die kaum oder gar keine Symptome einer resp. Insuffizienz (körpl.Symptome) zeigen
Indikation zur Intubation
Ind.: resp. Insuffizienz mit
* Atemfrequenzen > 35 Az/min
* art. Partialdruck (paO2) < 50 mm Hg unter O2-Gabe (6l/min)
* CO2-Partialdruck (paCO2) > 55 mm Hg (Ausnahme chronische Hyperkapni
bei COLD oder Asthma bronchiale
* Zeichen einer Hyperkapnie: Zyanose (kann bei CO-Vergiftung fehlen),
Kopfschmerzen, Gefäßerweiterung (Skleren,Händen), Tremor, Tachykardie,
Hypertonie, Somnolenz, Hirndruckzeichen, Koma
* Zeichen einer starken Orthopnoe
Nichtinvasive respiratorische Therapiemaßnahmen
1) Allgemeine Maßnahmen
a) Der Patient wird instruiert mit seiner Atemmuskulatur eine bessere Ventilation zustandezubringen
b) Der Patient wird instruiert seine Hustentechnik zu optimieren mit dem Ziel, die Bronchien sekretfrei zu halten
c) Durch diese Maßnhmen wird das inspiratorische AZV erhöht um eine besser oxygenation des Blutes zu gewährleisten.
2) Apparativ unterstützte, nicht invasive Atemtherapie
Die apparativ unterstützte, nicht invasive Atemtherapie hat zu Ziel, die erniedrigte Residualkapazität zu vergrößern, kollabierte Lungenbezirke wieder zu belüften und den Hustenstoß zu verbessern. Andere Geräte haben zum Ziel, Sekret zu lösen und Atelektasen zu beseitigen und somit die Diffusion des O2 durch die Alveolare zu erleichtern.
Folgende Geräte stehen hierzu zu verfügung:
a) "interne" Atemtherpiegeräte
*CPAP-Wandplatte
*CPAP-Gerät von Firma De Vilbys
* Clini-jet
* IPPB-Geräte (Intermittent-positiv-pressure-breathing)
* Aerosol-Geräte zum Vernebeln (Medikamente) und anfeuchten der Atemluft
b) "externe" Atemtherapiegeräte oder Anwendungen
* Vibrax
* basale Stimulation
* intermittierendes "abvibrieren" des Thorax
c) Verbesserung der Lungenfunktion durch Lagerung
d) medikamentöse Therapie
e) bronchoskopisches Absaugen durch einen Anästhesisten
a) " interne" Atemtherapie
Die CPAP-Wandplatte erhöht die funktionelle Residualkapazität (FRC), während des
gesamten Atemzykluses herrscht ein positiver Druck vor. CPAP reduziert die inspiratorischeund erhöht die expiratorische Atemarbeit, d.h. CPAP verlagert die Atemanstrengung von der Inspiration auf die Exspiration.
Die Atemarbeit (Arbeit der Atemhilfsmuskulatur) kann sinken, da der inspiratorische Gasfluß die Einatmung erleichtert und evtl. die Compliance der Lunge verbessert. Um eine Rückatmung auszuschließen muß das Reservoir mit einem großen Gasfluß gespeißt werden (ca. dreifaches Atemminutenvolumen!)
- resp. Insuffizienz mit Eröffnung des Bronchialkollaps oder Atelektasen (Senkung des CO2 )
- Mobilisation von Sekret
- besserer Gasaustausch
- Abnahme des intrapulmonalen Shuntvolumen
Indikationen:
- Prophylaxe postoperativer Atemstörungen
- postopertaive und posttraumatische resp. Insuffizienz
- Entwöhnung vom Respirator
- akutes Lungenödem
Nebenwirkungen:
- durch zu niedrige Flow-Einstellung und zu hohe PEEP-Einstellung CO2-Narkose
- durch zu hohe Flow-Einstellung und zu hohe PEEP-Einstellung --> Überblähung der Alveolen mit zunahme des funktionellen Totraumes und Abnahme der Compliance
- Gefahr des pulmonalen Barotraumas (Pneumothorax)
- HZV-Abfall bei Volumenmangel
- akute Rechtsherzbelastung durch den steigenden Gefäßwiderstandes in der Lunge
- Aspirationsgefahr hoher insp.Flow führt bei Magenatonie zu erbrechen
Kontraindikationen:
- Magenatonie (Aspirationsgefahr)
- Herzinsuffizienz
- Lungenembolie
- Asthma und COLD
- Schock
Clini-jetR
Der Clini-jet arbeitet mit hoher Frequenz und niedrigem Volumen, es kann zusätzlich vernebelt werden. Die Gasstöße mit hoher Frequenz bewirken eine Sekretolyse und nachfolgend einer besseren Diffusion des O2. Diese Gerät kann auch bei der Asthma-Therapie eingesetzt werden. Dieses Gerät kann auch bei Traumen des Thoraxbereiches angewannt werden.
Nebenwirkung:
- Unangenehme Gasstöße für den Patienten
Kontraindikationen:
- Akuter Asthmaanfall
- Schwere Herzinsuffizienz
- Lungenfibrose / ARDS
IPPB-Gerät
Der Pat. löst einen vorgewählten Trigger aus, und läßt seine Lunge mit einem vorgewählten Flow passiv bis zur Erreichung des gewählten Druckes aufblähen. Nach ereichung des Druckes erfolgt die Umschaltung auf die Exspiration. Diese Atemtherapie vermindert die Atemarbeit für den Pat., erhöht das AZV und bewirkt ein Bronchodilatation (Geeignet zur Asthma-Therapie) und hat einen Sekretolytischen Effekt.
Indikationen:
- resp. Insuffizienz
- Atelektasen
- Asthma
- Pneumonie
Nebenwirkungen:
- Unangenehmer Flow ---> Gewöhnungszeit für den Patienten
- schwer für den Pat. erlenbar
- bei zu hohen Druck Gefahr des Barotraumas
Kontraindikationen:
- Herzinfarkt
- schwere Herzinsuffizienz
- COLD / akuter Asthmaanfall
b) "externe" Atemtherapiegeräte VibraxR
Vibrax, intermitterndes Abvibrieren des Thoraxes über mind. 10 min führt zu einer Sekretmobilisation in den verschiedenen Lungensegmenten.
Indikationen:
- Sekretstau
- Atelektasen
- Pneumonie
Kontraindikationen:
- frischer Herzinfarkt
- Herzrhythmusstörungen
- Schädel-Hirn-Trauma
- Verletzung der Wirbelsäule und des Thoraxes
c) Verbesserung der Lungenfunktion durch Lagerung
Sekretmobilisation durch 180o- und Bauchlagerung, auch so können
Lungenperfusionsstörungen günstig beeinflußt werden. Durch die "Drainage" kann so Sekret ablaufen und die Lungenareale besser belüftet werden.
Bei ARDS und bei beatmeten Pat. empfiehlt sich ein PulmonairR-Bett.
Nebenwirkungen:
- Abfall des HZV
- RR-Abfall
- anfänglich schlechtere Oxygenierung
Diese Erscheinungen verschwinden meist nach 10-20 min.
Kontraindikation:
- Schädel-Hirn-Traumen
- Verletzungen im Bereich der Wirbelkörper
- instabile Kreislaufverhältnisse
d) Medikamentöse Therapie
Die Verabreichung von Sekretolytika (ACC*, Mucosolvan, Bisolvon) ist sehr umstritten. Bei der Verabreichung dieser Medikamente muß immer darauf geachtete werden, daß der Pat. eine genügende Flüssigkeitszufuhr (parenteral/enteral) hat.
Broncholytika wie (Sultanol) werden mit größerm Erfolg eingesetzt, sie können eine Spastik der Atemwege günstig beeinflussen.
Nebenwirkung von Sultanol:
- Tachykardien
- ventrik. Rhythmusstörungen
- Pektanginöse Beschwerden
Häufig gestellte Fragen
Was ist respiratorische Insuffizienz?
Respiratorische Insuffizienz bedeutet, dass die Atmung aufgrund pulmonaler oder extrapulmonaler Ursachen so stark eingeschränkt ist, dass es zu Veränderungen der Blutgase kommt. Es gibt zwei Formen: Partialinsuffizienz (Hypoxämie) und Globalinsuffizienz (Hypoxämie und Hyperkapnie).
Welche Ursachen kann eine respiratorische Insuffizienz haben?
Ursachen können alveoläre Hypoventilation (z.B. durch Narkosemittel), pulmonale Diffusionsstörungen, pulmonale Verteilungsstörungen (z.B. Lungenödem, COLD, Asthma) oder extrapulmonale Ursachen (z.B. ZNS-Störungen, Rückenmarksschäden, neuromuskuläre Erkrankungen, Thoraxwandprobleme) sein.
Wie erkenne ich eine respiratorische Insuffizienz?
Achten Sie auf Symptome wie Zyanose, motorische Unruhe, Verwirrtheit, Bewusstseinsstörungen, Tachykardie oder Bradykardie. Bei Globalinsuffizienz kommen Kopfschmerzen, Schwindel und Schwitzen hinzu. Die Atemfrequenz kann verändert sein (< 12 oder > 25 Atemzüge pro Minute), Dyspnoe kann auftreten, und die Atemhilfsmuskulatur kann zum Einsatz kommen.
Was ist bei der Sauerstoffgabe zu beachten?
Bei Patienten mit COLD kann eine unkontrollierte Sauerstoffgabe zu einer Atemdepression führen (O2-Narkose). Atemdepressive Medikamente sollten bei ateminsuffizienten Patienten nur unter sorgfältiger Kontrolle verabreicht werden.
Welche Atemtypen gibt es und was bedeuten sie?
Die Zyanose ist ein spätes Zeichen für Hypoxie. Dyspnoe beschreibt Atemnot. Eine veränderte Atemfrequenz kann ein Warnsignal sein. Der Einsatz der Atemhilfsmuskulatur deutet auf starke Atemnot hin.
Welche Atemgeräusche sind relevant?
Ohne Stethoskop hörbare Geräusche sind z.B. brodelnde Geräusche bei Lungenödem oder Stridor bei Asthma oder Krupp. Mit Stethoskop können Bronchialatmen, Vesikuläratmen und Rasselgeräusche unterschieden werden. Fehlende Atemgeräusche können auf verschiedene Probleme hindeuten.
Wie halte ich die Atemwege frei?
Bei eingetrübten oder komatösen Patienten sollte der Kopf so gelagert werden, dass die Zunge die Atemwege nicht versperrt. Die Mundhöhle sollte auf Fremdkörper untersucht werden. Bewusstseinsklare Patienten können in den "Pilotsitz" gebracht werden.
Wann ist eine Intubation indiziert?
Indikationen sind respiratorische Insuffizienz mit Atemfrequenzen > 35 Az/min, art. Partialdruck (paO2) < 50 mm Hg unter O2-Gabe, CO2-Partialdruck (paCO2) > 55 mm Hg, Zeichen einer Hyperkapnie und starke Orthopnoe.
Welche nicht-invasiven Therapiemaßnahmen gibt es?
Allgemeine Maßnahmen sind die Instruktion des Patienten zur besseren Ventilation und Hustentechnik. Apparativ unterstützte Therapien umfassen CPAP-Geräte, Clini-Jet, IPPB-Geräte und Aerosolvernebler. Externe Therapien sind Vibrax, basale Stimulation und Lagerung.
Was bewirkt die CPAP-Therapie?
CPAP erhöht die funktionelle Residualkapazität (FRC) und reduziert die inspiratorische Atemarbeit. Es verlagert die Atemanstrengung von der Inspiration auf die Exspiration.
Was ist bei der Anwendung des Clini-jet zu beachten?
Der Clini-jet arbeitet mit hoher Frequenz und niedrigem Volumen und kann zusätzlich vernebeln. Er bewirkt eine Sekretolyse und verbessert die Diffusion des O2.
Wie funktioniert das IPPB-Gerät?
Der Patient löst einen Trigger aus und die Lunge wird mit einem vorgewählten Flow bis zum Erreichen eines bestimmten Druckes aufgebläht. Es vermindert die Atemarbeit und bewirkt eine Bronchodilatation.
Was ist die Vibrax-Therapie?
Vibrax, oder das intermitterndes Abvibrieren des Thoraxes, führt zu einer Sekretmobilisation in den verschiedenen Lungensegmenten.
Welche Rolle spielt die Lagerung des Patienten?
Die Lagerung, insbesondere die Bauchlagerung, kann die Lungenperfusion günstig beeinflussen und die Sekretmobilisation fördern. Bei ARDS empfiehlt sich ein PulmonairR-Bett.
Wie werden Medikamente eingesetzt?
Sekretolytika sind umstritten und erfordern eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Broncholytika wie Sultanol können eine Spastik der Atemwege günstig beeinflussen.
- Quote paper
- Armin Krause (Author), 1995, Die respiratorische Insuffizienz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99140