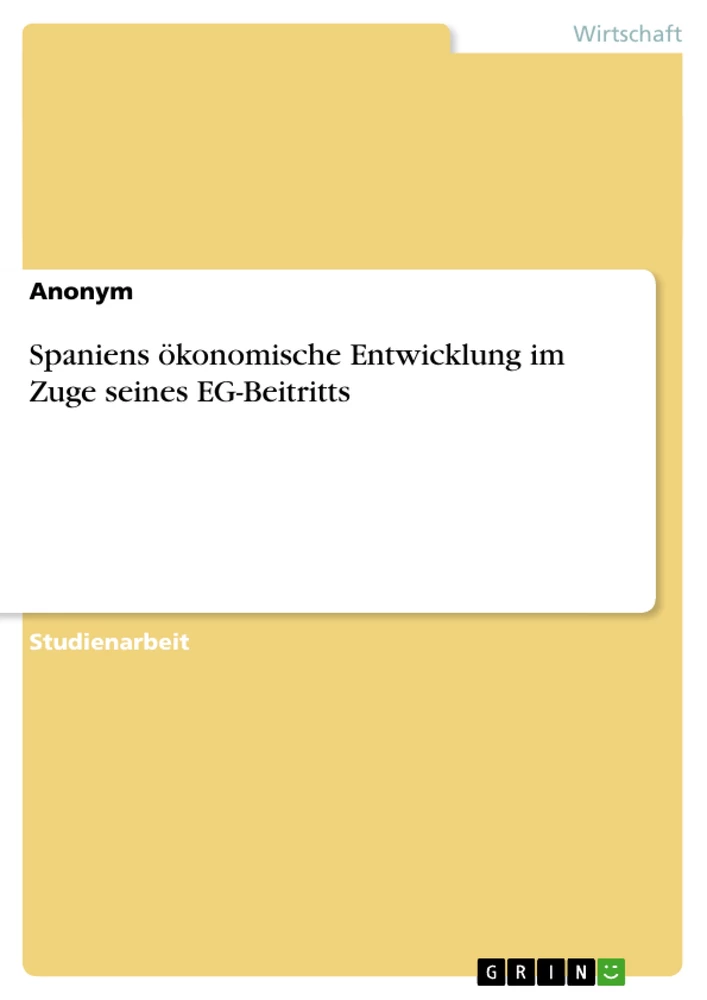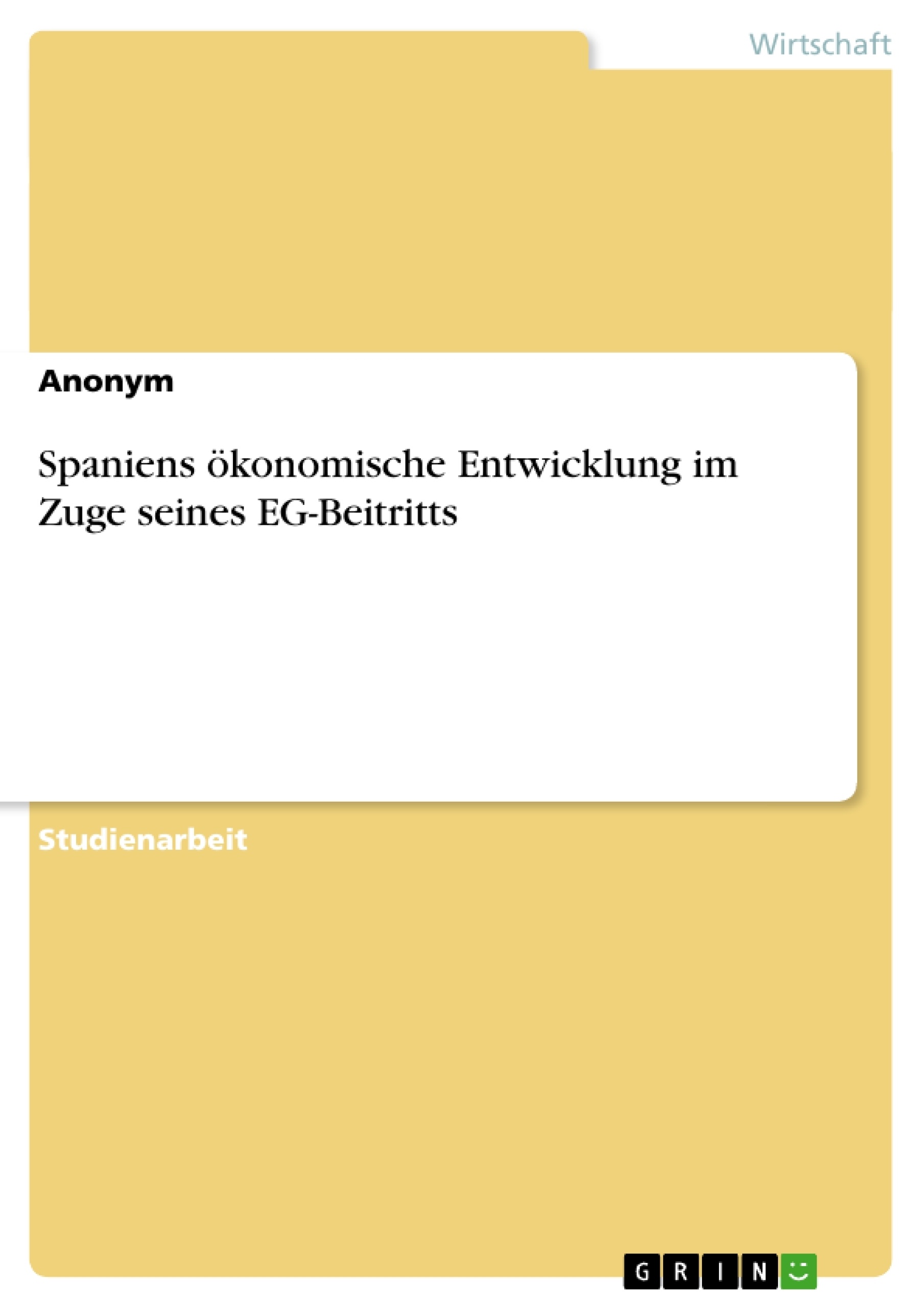Stellen Sie sich vor, ein Land steht am Scheideweg, zerrissen zwischen der dunklen Vergangenheit einer Diktatur und der verlockenden Verheißung eines europäischen Traums. Diese fesselnde Analyse entführt Sie in das Spanien der Jahre 1975 bis 1996, einer Ära des transformatorischen Wandels, in der das Land nicht nur seine Demokratie wiederentdeckte, sondern auch eine kühne wirtschaftliche Reise in die Europäische Gemeinschaft (EG) antrat. Von den turbulenten Anfängen der politischen Transition unter Franco über die schmerzhaften Anpassungen an den EG-Binnenmarkt bis hin zum euphorischen Boom der späten 1980er Jahre – dieses Buch enthüllt die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wirtschaftspolitik, sozialem Wandel und europäischer Integration. Verfolgen Sie, wie Spaniens gewagter Schritt in die EG tiefgreifende Auswirkungen auf seine Industrie, Landwirtschaft und Arbeitsmärkte hatte und das Land vor beispiellose Herausforderungen stellte, während es gleichzeitig neue Möglichkeiten für Wachstum und Wohlstand eröffnete. Entdecken Sie die strategischen Entscheidungen der spanischen Regierungen, die innovativen Reformen, die den Weg für den wirtschaftlichen Aufschwung ebneten, und die harten Kompromisse, die eingegangen werden mussten, um die Konvergenzkriterien für den Euro zu erfüllen. Mit scharfer Analyse und detaillierter Forschung beleuchtet dieses Buch nicht nur die Erfolge und Misserfolge der spanischen Wirtschaftsintegration, sondern wirft auch ein neues Licht auf die breiteren Auswirkungen der europäischen Integration auf nationale Wirtschaften und Gesellschaften. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für europäische Geschichte, Wirtschaftspolitik und die faszinierende Geschichte eines Landes interessieren, das sich neu erfunden hat. Tauchen Sie ein in die dynamische Geschichte des wirtschaftlichen und politischen Wandels Spaniens, ein Weg, der von ehrgeizigen Zielen, mutigen Reformen und der unermüdlichen Suche nach einem Platz im Herzen Europas geprägt ist. Erfahren Sie, wie Spanien die Herausforderungen meisterte, die Chancen nutzte und sich schließlich als integraler Bestandteil der Europäischen Union etablierte. Diese erschöpfende Untersuchung bietet tiefe Einblicke in die komplexen Dynamiken der europäischen Integration und die entscheidende Rolle, die Spanien bei der Gestaltung der europäischen Wirtschaftslandschaft gespielt hat.
Inhaltsverzeichnis
0. Gegenstand der Untersuchung und begriffliche Grundlegung
1. Der europäische Neuanfang Spaniens 1975 - 1985
1.1 Spaniens demokratischer Neuanfang und Durchbruch für den EG-Beitritt
1.2 Die wirtschaftspolitischen Vorbereitungen auf den Beitritt
1.3 Zehn Jahre Tal der Tränen: Wirtschaftliche Entwicklung 1975 - 1985
2. Spaniens EG-Beitritt und seine Folgen
2.1 Die Regelungen des EG-Beitritts
2.2 Wirtschaftspolitik ab 1985
2.3 Spanische Aufholjagd: Der Boom 1986 - 1990
2.4 Angekommen in Europa: Die Normalisierung 1990 - 1996 Literaturverzeichnis
0. Gegenstand der Untersuchung und begriffliche Grundlegung
Diese Arbeit zeichnet einerseits die Wirtschaftspolitik der demokratisch gewählten spanischen Regierungen nach, wie sie sie vor und während der EG-Integration betrieben haben. Andererseits soll gezeigt werden, welche Phasen ö konomischer Entwicklung das Land während dieses Beitrittsprozesses durchschritten hat. Es wird versucht, eine Verknüpfung dieser beiden Stränge herzustellen, indem sowohl die ökonomischen "Sachzwänge", die sich daraus für die spanische Politik ergaben, als auch die ökonomische Folgen der EG-Integration für Spanien aufgespürt werden. Beide Schlußfolgerungen werden mit Vorsicht gezogen: Denn einerseits ist die Motivation politischer Akteure oft nicht-ökonomischer Natur und letztlich eindeutig nur durch geschichtswissenschaftliche Quellenforschung freizulegen. An dieser Stelle bliebe nur zu untersuchen, ob die Regierungsmaßnahmen ökonomisch plausibel waren.
Zum Anderen ist der EG-Integrationsprozeß nur eine Rahmenbedingung unter mehreren für die spanische Ökonomie, also deren Entwicklung nicht nur aus dem Grad der EG-Integration heraus begründbar. Gleichwohl ist als roter Faden durch 15 Jahre EG-Integration die rasante Entwicklung und Umstrukturierung Spaniens als Ergebnis dieses Integrationsprozesses zu betrachten, weil erst die in Spanien eingeführten EG-Standards den (Investitions-) Aufschwung brachten und weil der weit überwiegende Teil des spanischen Handels inzwischen mit EU-Ländern abgewickelt wird.
Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut und betrachtet die spanische EG-Annäherung in zwei Epochen (siehe Inhaltsverzeichnis), die sich durch ein ,,vor" und ein ,,in der EG" voneinander abgrenzen und auch ökonomisch unterschiedlich verliefen. Abwechselnd werden die jeweilige Wirtschaftspolitik sowie die wirtschaftliche Entwicklungen anhand bestimmter Indikatoren untersucht. Am Ende eines jeden Abschnitts wird ein kurzes Résumee gezogen. Ich benutze bis 1992 durchgängig die Bezeichnung ,,EG" (die begrifflich immer die verschiedenen Verträge zusammengefasst hat), danach ,,EU" (Europäische Union), weil seit dem Maastrichter Vertrag diese Bezeichnung gängig ist und die neue Qualität der Integration ausdrückt. Der Leser möge im Hinterkopf behalten, dass mit ,,EG" in der jeweiligen Epoche Zusammenschlüsse verschiedener Größe gemeint sind, angefangen von der EG der 9 in 1975 bis hin zur EG/EU der 15 ab 1995.
1. Der europäische Neuanfang Spaniens 1975 - 1985
1.1 Spaniens demokratischer Neuanfang und Durchbruch für den EG-Beitritt
Der 1962 von Spanien gestellte Antrag auf Assoziierung mündete 1970 lediglich in ein Handelspräferenzabkommen mit der EG, das jedoch wenig Wirkung entfaltete und auch schon den Schlußpunkt der Annäherung zwischen der EG und dem faschistischen Regime in Madrid markierte1.
Mit dem Übergang zur Demokratie2 stand auch der politischen Annäherung Spaniens an die EG nichts mehr im Wege. Im Gegenteil: Die Gefährdung der jungen spanischen Demokratie3 und damit perspektivisch des Zugriffs auf den spanischen Markt wurde zur Hauptantriebskraft für die EG, Spanien möglichst schnell zu integrieren, und Spanien selbst erlebte die unsichere Phase des Übergangs als blockierend auch für die wirtschaftliche Entwicklung4. So bekam die politische Stabilisierung Vorrang vor dem wirtschaftlichen Umbau, eine Priorität, wie sie von beiden Seiten geteilt wurde5.
Und doch: (Agrar-) Wirtschaftlich motivierten Vorbehalten einiger EG-Staaten6 ist es zu verdanken, dass die Aufnahme Spaniens und Portugals7 seit dem Beitrittsantrag 1977 noch acht Jahre auf sich warten ließ8.
Als Zugeständnis der anderen EG-Staaten an Spanien wie auch die drei Blockierer wurde die Aufstockung der EG-Regional- und Strukturfonds beschlossen, aus der eine gezielte Beihilfe für sämtliche EG-Mittelmeeranrainer erwuchs und die erst den Weg für die Akzeptanz Spaniens in der EG freimachte9. Durch die jahrzehntelange, auf Importsubstitution ausgerichtete Industriepolitik des Franco-Regimes waren Branchen in ihrer Produktionskapazität und Beschäftigung überdimensioniert, die ohnehin schon in den Alt-EG- Ländern hochsubventionierte, langfristig abzuwickelnde Problembereiche waren: Stahlwerke, Werften, Textil- und Schuhindustrie sowie große Teile der Landwirtschaft und Fischerei. Die spanischen Unternehmen dieser Branchen traten nun auch wegen der geringen Löhne zum einen als bedrohliche, neu auf den EG-Markt drängende Konkurrenten auf, zum anderen machte ihre Dauersubventionierung eine deutliche Mehrbelastung der EG-Töpfe absehbar, was weder im Interesse der bisherigen EG-Nettozahler noch in dem der Nettoempfänger liegen konnte. Bedingung für den spanischen EG-Beitritt war dann auch, dass Spanien seine Kapazitäten in diesen Bereichen abbaute10 (siehe Kap. 1.3).
1.2 Die wirtschaftspolitischen Vorbereitungen auf den Beitritt
Schon im Vorfeld des EG-Beitritts11 begannen die spanischen Regierungen, die Umstrukturierung der Wirtschaft in Richtung EG-Kompatibilität in Angriff zu nehmen12. Bereits seit 1974 waren die Zinsen schrittweise liberalisiert worden, die Marktzutrittsbeschränkungen für ausländische Banken fielen 197813, das Rechtswesen wurde im gleiche Jahr weitgehend reformiert; die Vertragsfreiheit bekam eine herausragende Stellung14. Die neue Verfassung, 1978 in einer Volksabstimmung angenommen, schreibt explizit eine marktwirtschaftliche Ordnung vor, schützt das Eigentum und garantiert Tarifautonomie15. So konnten die bis 1979 geltenden staatlichen Lohnleitlinien 1980 durch frei ausgehandelte Tarifverträge16 ersetzt werden. 1979 baute Spanien gegenüber der EG einseitig Zölle ab und holte somit einen diesbezüglichen Rückstand auf Portugal und Griechenland, die zeitgleich in die EG wollten, auf17.
Aber der Reformprozeß verlief zu stockend und konzeptlos, weswegen noch vier Jahre nach Francos Tod die Fehlbildungen seines Wirtschaftssystems Spanien prägten18. Hinzu kam, dass isolationistische Kräfte der regierenden zersplitterten UCD-Koalition die Beitrittsbemühungen torpedierten und die Regierung zum 1982 zum Scheitern brachten. Die vorgezogenen Neuwahlen brachten den Regierungswechsel zu den eindeutig proeuropäischen Sozialisten (PSOE), nun wurde zielstrebiger mit der EG verhandelt19 und die Umstrukturierung im Inneren beschleunigt20.
Die Regierung Gonzalez verfolgte eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, wie sie damals in allen westlichen Ländern auf dem Vormarsch war. Diese schien das geeignete Mittel gegen die Deformationen zu sein, die jahrzehntelanger Staatsinterventionismus hinterlassen hatte. Im Rahmen des Versuchs, das Geflecht staatlicher Beteiligungen in unrentablen Unternehmungen zu entwirren, wurden 1982 die ersten staatlichen Betriebe privatisiert21, 1984 folgten Privatisierungen in der Nahrungs-, Textil-, Chemie-, Strom- und Autoindustrie22. Parallel dazu wurde ein staatliches Programm zur ,,Rekonversion" der Industrie23 aufgelegt, was die Umstellung des Produktionsprogramms, die Einführung neuer Techniken sowie die Umschulung der Beschäftigten beinhaltete24.1984 traten auch Reformen des Arbeitsmarktes in Kraft, die den Abschluß befristeter und Teilzeitarbeitsverhältnisse ermöglichten, Ausbildungsgänge und Praktika einführten und Entlassungen erleichterten25.1985 wurden ausländische Direktinvestitionen fast sämtlich genehmigungsfrei.
Parallel zu diesen vorweggenommenen Anpassungsmaßnahmen fanden die Beitrittsverhandlungen statt, die im Juni 1985 in die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags mündeten (siehe Kap. 2.1).
1.3 Zehn Jahre Tal der Tränen: Wirtschaftliche Entwicklung 1975 - 1985
Die anfängliche Euphorie über den demokratischen Aufbruch überdeckte nur für eine kurze Zeit die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen Spanien steckte. Die Ölkrisen 1973 und 1979 trafen Spanien stärker als andere Länder, da es nur 30% seines Gesamtverbrauchs an Energie deckte, also entsprechend viel Energie und damit Öl einführen mußte26. Der Energieverbrauch konnte wegen des Übergewichts energieintensiver Industrien nur langsamer gedrosselt werden als in anderen Ländern. Da diese Industrien in niedergehenden Branchen produzierten, schlug nun auch deren Krise als Strukturkrise voll auf die spanische Wirtschaft durch27.
Bei durchschnittlichen jährlichen BIP-Zuwachsraten von 1,8% (1975-1980) und 1,4% (1980-1985) konnte von ,,Aufholjagd Spaniens" keine Rede sein, denn auf weit höherer Ausgangsbasis stieg das BIP in der EG mit 3,1 bzw. 1,5% auch noch relativ schneller als das spanische28. Das spanische BIP pro Kopf nahm von 55% (1974) auf 50% (1985) des EGNiveaus ab29. Die Verteuerung der Einfuhren ließ die Preise beschleunigt wachsen: Bis 1977 stieg die Inflationsrate auf 25% jährlich. Sie nahm in allen Folgejahren kontinuierlich ab, lag aber stets über dem EG-Niveau30.
Dabei hatte die Perspektive eines demokratischen, auf die EG orientierten Spaniens anfangs noch Zuversicht bei ausländischen Investoren geschaffen31. Erst in den beiden Folgejahren geriet die Bilanz des langfristigen Kapitalverkehrs aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise in negative Zahlen32. Von 1975 bis 1984, mit der Ausnahme von 1980, nahmen die gesamten Investitionen33 ab34. Der Anteil der Bruttoanlageninvestitionen am BIP sank von 27% in 1975 (EG 23%) auf 19% in 1985 (EG auch 19%)35. Die im Umbruchprozeß mächtigen Gewerkschaften erkämpften Lohnzuwächse, die 1974 bis 1979 weit über denen der Produktivität lagen, und trugen somit dazu bei, den Investitionsspielraum der Unternehmen weiter einzuschränken36.
Von 1973 auf 1974 verdoppelte sich der Fehlbetrag der spanischen Handelsbilanz37 ; der Überschuß in der Leistungsbilanz, die von Ausfällen im Tourismus und bei Überweisungen der Gastarbeiter zusätzlich gebeutelt wurde, schlug in ein Defizit um38. Die innenpolitschen Gegner des EG-Beitritts hatten hier ein gutes Argument für die Gefahr dieses Unterfangens.
Ein Blick auf die Struktur der ausgeführten Güter zeigt, dass die spanische Wirtschaft zunehmend in der Lage war, hochwertige, veredelte Produkte auf dem Weltmarkt abzusetzen39: Der am Gesamtexport anteilige Wert der ausgeführten Maschinen und Fahrzeuge stieg von 4% (1961) auf 42% (1991), der der chemischen Produkte von 5 auf 8%, der der ,,verarbeiteten Produkte" (nach OECD-Definition) von 21 auf 28%. Im Gegenzug schrumpfte der Anteil exportierter landwirtschaftlicher Produkte von 55 auf 17%40. Noch beschleunigt durch die Krise änderte sich die Wirtschaftsstruktur Spaniens gravierend: Der Beitrag der Landwirtschaft (inklusive Fischerei) zum BIP halbierte sich fast41, während derjenige der Kredit- und Wohnungswirtschaft von 9 auf 17% hochschnellte. Handel und Gastronomie nahmen von 16 auf 19% zu, während 1980 in der Bedeutung der Industrie der ,,Turn-around"42 eintrat: Von da an verringerte sich ihr Anteil am BSP wie an der Beschäftigung kontinuierlich43.
Die Bedeutung der EG für die spanische Wirtschaft nahm sprunghaft zu: Nachdem bis 1980 der Anteil der Exporte in die EG an den Gesamtexportem 20 Jahre lang bei ca. 50% stagnierte, gingen 1991 schon 72% aller Exporte in die Gemeinschaft. Der jeweilige Importanteil verdoppelte sich gar von 1980 30% auf 1991 60%44. Noch vor dem eigentlichen Beitritt hatte die EG somit nachhaltigen Einfluß auf die spanische Wirtschaft genommen. Das schwerste Erbe aus der Krisendekade, das Spanien in die Gegenwart mitgenommen hat, ist die höchste Arbeitslosigkeit der EU: Durch den Einbruch der Beschäftigung von 1974 bis 1984 stieg die Arbeitslosigkeit von 3% auf 22%45.
2. Spaniens EG-Beitritt und seine Folgen
2.1 Die Regelungen des EG-Beitritts
Die Ratifizierung des am 1. Januar 1986 in Kraft tretenden Beitrittsvertrags kam der Verabschiedung eines umfassenden Reformpaketes für die spanische Wirtschaft gleich: Binnen sieben Jahren, bis zur Vollendung des EG-Binnenmarktes mit seinen vier Freiheiten von Kapital-, Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr 1993, mußte die spanische Regierung folgende Maßnahmen ergreifen46:
1. Schrittweiser Abbau der Zölle von 1986 bis zum 1.1.1993, dem Inkrafttreten des freien EUBinnenmarktes47. Das bedeutete einen zu Lasten Spaniens asymmetrischen Abbau, weil die EG mit dem Handelspräferenzabkommen von 1970 diesbezüglich schon in Vorleistung getreten war48 (siehe auch Kapitel 1.2).
2. Aufhebung jeglicher nicht-tarifärer Importkontingentierung sowie Exportsubventionierung.
3. Die Übernahme der EG-Außenzölle.
4. Die Einführung der EG-Bestimmungen zum freien Kapitalverkehr. Die Arbeitsaufnahme spanischer Staatsbürger in anderen EG-Ländern blieb jedoch noch bis 1992 reglementiert49
5. Die Einführung der Mehrwertsteuer
6. Die Übernahme der Regelungen von EG-Agrarmarkt und Montan-Union, die ohnehin schon mit Überkapazitäten zu kämpfen hatten. Erstere beschränkten den Export gerade der wettbewerbsfähigen spanischen Agrarprodukte in EG-Länder, letztere legte der spanischen Stahlindustrie eine Modernisierung und einen Kapazitätsabbau von 16% auf50.
7. Spanien verlor seine uneingeschränkte Souveränität über seine Küstengewässer und mußte sich den EG-Fischfang-Quoten unterwerfen51. Die Bedeutung dieser Regelung wird durch den Stellenwert der Fischerei in Spanien deutlich: Es hatte 1981 die größte Fischfangflotte der Welt, von der 700.000 Menschen lebten52. Auch heute noch gerät Spanien wegen Überfischung internationaler Gewässer regelmäßig in Konflikt z.B. mit Kanada.
8. Im Gegenzug wurde die spanische Textilindustrie durch Importbeschränkungen bis 1993 geschützt53.
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags wurde für alle wirtschaftlichen Akteure, gerade auch die potentiellen ausländischen Investoren, ein verläßlicher Rahmen und Zeitplan aufgestellt, der die beiden Phasen von 40 Jahren francoistischer Isolation und 10 Jahren politischer - und damit wirtschaftlicher - Unsicherheit beendete. Die Integration Spaniens in die EG wurde unumkehrbar und damit auch die innere politische und wirtschaftliche Umgestaltung nach westeuropäischem Muster absehbar. Dieser psychologische Effekt dürfte mindestens ebenso entscheidend für die ab 1985 folgende Reaktivierung der spanischen Wirtschaft gewesen sein wie die konkreten Wirkungen der Marktliberalisierung.
2.2 Wirtschaftspolitik ab 1985
Durch den EG-Beitritt geriet die spanische Industrie unter nie gekannten Wettbewerbsdruck auf dem Inlandsmarkt. Die spanische Regierung versuchte, die Marktmacht, Umstrukturierung und Modernisierung der heimischen Industrie zu unterstützen, sah sich dabei aber den Restriktionen gegenüber, die die EG-Regeln solchen staatlichen Hilfen auferlegen. Da die traditionellen Möglichkeiten der Handelspolitik (Protektion, Exportförderung) nun nicht mehr zur Verfügung standen, mußte man sich auf (Infra- )Strukurpolitik sowie Industriepolitik beschränken. Die spanische Regierung fing Mitte der 80er Jahre an, mit staatlichen Investitionsprogrammen Lücken bei Eisenbahn, Telefon, Erdölindustrie zu schließen, die sich dann auch in der Boomphase als Hemmnisse des Wachstums herausstellten54. Zu Beginn der 90er jahre sollte der Umstrukturierungsprozeß abgeschlossen sein, wofür die Regierung 1 Bio Pesetas (=16 Mrd DM) zur Verfügung stellte55. Dabei dürften die Nettozahlungen der EU-Partnerländer an Spanien, die von 0,6 Mrd ECU in 1987 stetig auf 7,3 Mrd ECU in 1995 anstiegen56, eine zusätzlich vitalisierende Wirkung entfaltet haben.
Die "reconversion industrial" (siehe Kap. 1.3) sollte die Konkurrenzfähigkeit der spanischen Industrie stärken. Diese sollte nicht länger auf niedrigen Lohnkosten basieren, die sich mit dem EG-Beitritt ohnehin nicht auf Dauer halten ließen, sondern auf Produktdiversifikation, Markenbildung und Qualitätssteigerung57. Hinzutreten sollte eine staatliche Förderung58 technologischer Innovation59, Forschung, Entwicklung und Ausbildung, ein Gebiet, auf dem Spanien seit Jahrzehnten rückständig60 und vom Ausland abhängig war61.
Durch besondere Unterstützung von Problemregionen62 - also quer zur Förderung der Branchen - versuchte der Staat, deren Umstrukturierung sozial abzufedern63. Trotz dieser sehr ausgabenfreudigen Politik konnte Spanien seit 1985 die EU-weit (mit Irland und GB) niedrigste Steuer- und Abgabenquote64 (1996 35% vom BIP) halten, obwohl die Aufwendungen für Arbeitslosigkeit immens waren65.
Die Politik der erfolgreichen Einbindung (Moncloa-Pakt bis 1984) und dann Konfontation mit den Gewerkschaften (Generalstreik 198866 )stabilisierte die im europäischen Vergleich geringe Lohnquote67 (und damit hohe Profitquote) am Volkseinkommen. Wie groß der Wohlstandsabstand Spaniens z.B. zur BRD noch war, zeigt der reale Bruttostundenlohn eines Arbeiters in der Industrie: Dieser wuchs zwischen 1985 und 1990 in Spanien von 10 auf 12 DM, in der BRD von 16,30 DM auf 20,40 DM68.
Die starke Rolle, die der Staat beim Umbau der Wirtschaft in Spanien spielte, zeigt, dass es sich hier keinesfalls um ein marktliberales Laisser-Faire-Programm handelte, jedoch ebensowenig um den Versuch staatlicher Konjunktursteuerung. Die Regierung Gonzalez verfolgte eine Politik der ,,staatsfinanzierten Angebotsorientierung", die die Verbesserung der Investitionsbedingungen im Blick hatte. Den fulminanten Start Spaniens in die EG ohne größere soziale Verwerfungen unter Beilegung auch der ethnischen Konflikte (Baskenland, Katalonien, Galizien) hinbekommen zu haben, ist auch ein Verdienst dieser Politik. Die 1982 unter Gonzalez begonnene, auf Preisstabilität, Lohnzurückhaltung und Verbesserung der Bedingungen für Profitmaximierung ausgerichtete Politik fand ihre Fortsetzung im Vorgehen der 1996 gewählten konservativen Aznar-Regierung. Sie wurde auch ein Stück weit von den EU-Partnern vorgegeben und war Bedingung dafür, dass Spanien Anfang der 90er Zuwendungen aus dem neugeschaffenen Kohäsionfonds erhielt und 1997 die Konvergenzkriterien erfüllen konnte, die 1999 die Eintrittskarte in den Euro bedeuteten.
2.3 Spanische Aufholjagd: Wirtschaftlicher Boom 1986 - 1990
Spaniens EG-Beitritt beendete fast schlagartig die Dauerkrise und induzierte ein nachholendes Wachstum, das erst 1992 auf europäisches Normalmaß abbremste.
Das BIP wuchs in den Jahren 1985 bis 1990 durchschnittlich jährlich um 4,4%, damit deutlich stärker als in der EG (3,1%)69. Insgesamt wuchs in diesen Jahren das spanische BIP70 real um insgesamt 24%, das der EG nur um 17%71. Das Pro-Kopf-Einkommen Spaniens stieg in diesem Zeitraum von 50% auf 59% des EG-Niveaus72. Allerdings blieben die Lohnzuwächse, wie anderen Industrieländern auch, schon ab 1980 hinter den Zuwächsen der Produktivität zurück73. Die Preise stiegen immer langsamer, allerdings immer jeweils stärker als EG-üblich74. Die Besiegelung und der Vollzug des EG-Beitritts entfachten ein Feuerwerk ausländischer Investitionen in Spanien75. Nach zehn Jahren rückgängiger Gesamtinvestitionen (siehe Kap. 1.4) explodierten die Zuwachsraten auf bis zu 14% jährlich
- Zahlen wie in Wirtschaftswunderzeiten76. Die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote stieg somit zwischen 1985 und 1990 von 19 auf 25% des BIP77. Die Zunahme der Kapital- Rentabilität gab den Investoren recht: Die durchschnittliche Verzinsung stieg von 10,5% (1982) auf 16,5% (1990)78. Die Wirtschaft beschäftigte jährlich 3,1% mehr Menschen79.1986 wurde somit der seit 10 Jahren andauernde Trend des Beschäftigungsabbaus (siehe Kap. 1.4) umgedreht und allein bis 1989 wieder das Beschäftigungsniveau von 1969 erreicht80. Allerdings war die Anzahl der Erwerbsfähigen seit damals um 2,5 Mio gewachsen81, so dass die Zunahme der Beschäftigung das Problem der Arbeitslosigkeit nur etwas mindern, nicht jedoch beheben konnte: Die Quote sank von 22 auf 16% (zum Vergleich: EG von 11 auf 8%)82.
Die rapide Liberalisierung der Handelsbeziehungen zur EG forderten aber auch ihren Tribut: Die Leistungsbilanz brach, nachdem sie Mitte der 80er Jahre sogar ein Plus von jährlich 4 Mrd ECU verzeichnete, in den Folgejahren immer weiter ein, bis sie 1992 ein Minus von über
16 Mrd ECU erreichte83. Hauptursache dafür waren die um 15 -20% jährlich wachsenden Einfuhren84. Die Öffnung des spanischen Binnenmarktes war für die europäischen Unternehmen ein lukratives Geschäft85. Auch die spanischen Ausfuhren wuchsen kräftig, jedoch auf geringerem Niveau: Von 29 Mrd ECU auf 51 Mrd ECU. Das traditionell positive Saldo der Dienstleistungsbilanz86 konnte diesen Verlust nicht ausgleichen, zumal es von 10 Mrd ECU (1986) auf 5 Mrd ECU (1992) zurückging87.
Die unmittelbare Wirkung der EG-Integration Spaniens läßt sich besonders gut an der Entwicklung der Handelsströme ablesen88:
1. Die EG wurde immer wichtiger für Spanien: 59% aller Importe Spaniens kamen aus dem EG-Raum (andere EG-Länder: 58%). Gar 65% der Ausfuhren gingen in die EG (andere EGLänder: 60%). Die Verflechtung Spaniens mit der EG war 1990 also schon weiter vorangeschritten als in der EG "üblich".
2. Das Handelsdefizit mit der EG betrug 12 Mrd ECU und machte somit deutlich, dass die Hauptprofiteure der Angliederung Spaniens zunächst die europäischen Unternehmen waren. Spaniens Ziel der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft war noch nicht erreicht.
3. Der Handel nahm generell für Spanien einen wachsenden Stellenwert ein: Die Einfuhren stiegen von 1985 bis 1990 um 57%, die Ausfuhren um 23%. Der Vergleich mit entsprechenden Zahlen für die anderen EG-Länder (Zuwächse von 20 bzw. 17%) zeigt, dass Spanien auch im Grade der internationalen Handelverflechtung aufgeholt hatte.
2.4 Angekommen in Europa: Wirtschaftliche Normalisierung 1990 - 1996
Spätestens mit der europaweiten 1993er-Krise mußte Spanien erfahren, dass auch für seine Wirtschaft die Bäume nicht in den Himmel wachsen und es noch ein weiter Weg sein würde, bis man zum "Kalifornien Europas" aufgestiegen ist. Der Boom der späten Achziger entpuppte sich zunächst als durch den EG-Beitritt entfachtes Strohfeuer, und ob es langfristig gelingen würde, wirtschaftlich zu Mitteleuropa aufzuschließen, blieb abzuwarten. Während 1990 bis 1996 in der EU das BIP real um insgesamt 11% wuchs, nahm es in Spanien nur um 9% zu89 90. Das Pro-Kopf-Einkommen ist bis 1996 von 59% (1990) auf 63% des EU-Durchschnitts geklettert91.
Die Verteilung des Volkseinkommens änderte sich in dieser Zeit - wie in der gesamten EU - zu Ungunsten der Lohnabhängigen: Absinken der Lohnquote von 59% auf 57%, wobei das Niveau der Lohnquote im Vergleich zum EU-Durchschnitt (Lohnquote 1996: 65%) gleichbleibend niedrig ist.
Die Arbeitslosenquote stieg im Zeitraum 1990 bis 1994 wieder von 16 auf 24% (EU: 8 auf 11%), nahm dann aber nach mit der Erholung von der 93er Krise bis 1999 auf 16 % ab (EU 9%)92.
Spanien weist mit 50 % die niedrigste Erwerbsquote der EU auf (BRD 56%), besonders bei den Frauen, von denen nur 36% erwerbstätig sind - gegenüber 70% in skandinavischen
Ländern93. Die Mitte der 80er Jahre von Gonzalez durchgesetzte Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, insbesondere die Ausweitung befristeter Beschäftigung von 15 auf 33% (siehe Kap. 1.2), führte zu einer dauerhaften Benachteiligung von Jugendlichen (in fünf Provinzen beträgt die Jugendarbeitslosigkeit jeweils 40%) und Frauen auf dem Arbeitsmarkt94.
Nach dem Einbruch der Leistungsbilanz bis 1992 infolge des ungehinderten Zugangs zum spanischen Markt erholte sich diese und wies 1995 und 1996 gar einen positiven Saldo aus. Die stärkere internationale Wettbewerbsfähigkeit Spaniens lies die Ausfuhr von Waren stärker steigen (von 50 auf 80 Mrd ECU), die Einfuhr geringer (von 74 auf 92 Mrd ECU). Ähnliche Entwicklung bei den Dienstleistungen: Die Einnahmen stiegen gegenüber 1992 um 10 Mrd ECU, die Ausgaben nur um 3 Mrd ECU95.
Der Prozeß des Zusammenwachsens des spanischen Wirtschaftsraumes mit der EU war 1990 - trotz des bis dahin erreichten hohen Niveaus (siehe Kap. 2.3) - keineswegs abgeschlossen: Der EU-Anteil an den spanischen Einfuhren stieg bis 1996 von 59 auf 70%, der Anteil der Ausfuhren in die EU von 65 auf 67%. Das gesamte Handelsvolumen mit der EU stieg von 72 Mrd ECU (1990) auf 123 Mrd ECU (1996). Dabei verringerte sich das spanische Handelsdefizit von 12 auf 9 Mrd ECU96, obwohl seit 1993 keinerlei Zollbarrieren und Sonderschutzregelungen die spanische Wirtschaft mehr schützen. Es scheint also, als hätte Spanien durch seine Aufholjagd mittlerweile eine dem EU-Standard entsprechende Wettbewerbsfähigkeit besonders seiner Exportwirtschaft herstellen können. Die Hauptprobleme der spanischen Wirtschaft sind ganz anderer Größenordnung als noch 1975, es sind solche Probleme, die ,,alle haben": hohe Arbeitslosigkeit, (noch) eine chronisch defizitäre Handelsbilanz - gerade im industriellen Bereich - sowie die gegenüber dem EU- Durchschnitt stärkere Tendenz zu Inflation. Hinzu kommen die starken regionalen Disparitäten in der Entwicklung97.
Diese durch den Wettbewerb verursachten oder verstärkten Fehlentwicklungen scheinen als Webfehler des alle EU-Staaten vereinenden Wirtschaftssystems nur durch politische Maßnahmen im europäischen Maßstab bekämpf- und womöglich lösbar zu sein.
Diese Probleme können jedoch die Erfolgsstory nicht trüben, die die spanische Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten 15 Jahren geschrieben hat. Aus der faschistischen Diktatur mit ihrem agrarisch geprägten, unproduktiven Wirtschaftssystem am Rande des Weltmarktes und Europas ist eine auch wirtschaftlich florierende Demokratie auf fast mitteleuropäischem Niveau hervorgegangen. Durch ihre Europäisierung im Zeitraffer haben die Spanier alle
Mahner98 blamiert, die sie von ihrer südländischen und stolzen Mentalität her gefährdet sahen, sich nicht anpassen zu können und zum Armenhaus Europas herabzusinken. Im Gegenteil: Spanien ist zum Vorbild für die in die EU drängenden osteuropäischen Länder geworden.
Literaturverzeichnis
DIHT, ,,Warenverkehr mit Spanien und Portugal - Zoll-Wegweiser", Bonn 1986
Dürr, E., Kellenbenz, H., Ritter, W. : ,,Spanien auf dem Weg nach Europa?", Stuttgart 1985 Ehrke, M. : ,,Die spanische Wirtschaft in Europa", Bonn 1990
Europartners (Commerzbank und Partner): ,,Euro-Cooperation Nr.24 - Zum EG-Beitritt Spaniens und Portugals", Frankfurt/Main 1986
Herzog, W. : ,,Spanien", München 1987
Hommel, K. : ,,Spanien und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft", Baden-Baden 1992 Laaser, C-F., Schrader, K. : ,,Die baltischen Staaten auf dem Weg nach Europa - Lehren aus der Süderweiterung der EG", Tübingen 1994
Lieberman, S.: ,,Growth and Crisis in the Spanish Economy 1940-93", London 1995 Ludwig, A.: ,,Der spanische Wirtschaftsstil", Frankfurt/Main 1988 Schömann, K. : ,,Sonnige Konjunktur und arbeitsmarktpolitische Schatten", in: Mitbestimmung 11/99, S.36 f
Schröder, P.: ,,Die Integration Spaniens in die Europäische Gemeinschaft", Frankfurt/M 1982
Statistisches Bundesamt (StBA), ,,Statistisches Jahrbuch für das Ausland", Ausgaben 1992 und 1998
Sundt, O. : ,,Die Rolle der spanischen Gewerkschaften im Modernisierungsprozeß", Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) 1993
Weidenfeld,W., Wessels,W.: ,,Europa von A-Z", Bonn 1997 Weiler, H. : ,,Wirtschaftspartner Spanien", Berlin 1990
Westenenk, R.O. : ,,Industrialisierung und Strukturkrise: Zur Entwicklungsökonomie Spaniens", Saarbrücken 1986
[...]
1 vgl. Hommel, S. 306, Westenenk, S. 247, Laaser, S. 175
2 Nach dem Ende der Franco-Diktatur 1975 fanden im Juni 1977 die ersten freien Wahlen seit 1936 statt; die siegreiche konservative Koalition UCD strebte wie alle anderen Parteien den EG-Beitritt an.
3 Noch 1981 kam es zu einem Putschversuch von Militärangehörigen, der u.a. durch den Einsatz des Königs Juan Carlos beendet wurde, Hommel, S. 348
4 Ehrke, S. 21
5 Laaser, S. 154-159
6 Die Beitrittsverhandlungen Spaniens mit der EG begannen im Februar 1979 und stießen - im Gegensatz zu den 60er Jahren- auf Vorbehalte Frankreichs, Italiens und Griechenlands, das als 1981 beigetretener Nettoempfänger EG-Hilfen für sich gefährdet sah.
7 Griechenland, das zur gleichen Zeit seinen Beitrittsantrag stellte, wurde bereits nach vier Jahren aufgenommen, weil das wirtschaftliche Argument bei diesem kleinen Land weniger schwer wog als seine strategisch wichtige geografische Lage an der Ostflanke der NATO, Laaser S. 197, 209,
8 Laaser, S. 197/198
9 Laaser, S. 197-200, 209, Herzog, S. 117
10 Sundt, S. 74
11 Im Juli 1977 stellte Spanien seinen Aufnahmeantrag, 1979 nahm der Rat der EG die Beitrittsverhandlungen auf, Hommel, S. 348/349
12 Dass das keine Selbstverständlichkeit war, zeigen die Beispiele Griechenlands und Portugals, die ihre Hausaufgaben wesentlich zögerlicher machten und - im Falle Griechenlands - vergeblich auf einen wirtschaftlichen ,,Eintrittsboom" warteten, wie ihn Spanien 1985 - 1990 erlebte, Laaser S. 142-209)
13 Hommel, S. 154 und 185
14 Hommel, S. 149
15 Hommel, S. 156
16 Diese wurden allerdings durch den bis 1984 geltenden Moncloa-Pakt zwischen den Sozialpartnern sowie der Regierung eingerahmt, der Lohnzurückhaltung gegen Beschäftigungsförderung versprach, Hommel, S. 156
17 Laaser, S. 188
18 Schröder, S. 178 -183
19 In seiner Antrittsrede kündigte der neue Ministerpräsident Felipe Gonzalez den Beitritt zur EG noch in der laufenden Legislaturperiode an und bekam postwendend von der EG- Kommission eine positive Antwort, Lieberman, S. 269
20 Sundt, S. 74
21 Laaser, S. 183
22 Laaser, S. 183, Ehrke, S. 229
23 Als Resultat des Rückzugs des Staates aus der Privatwirtschaft und durch Abwicklungen bei Stahl und Werften konnten die Verluste der staatlichen Industrieholding INI bis 1987 auf ein Drittel reduziert werden, die "reconversacion industrial" erbrachte bei Strom und Luftfahrt hohe Gewinne, Ehrke, S. 229
24 Laaser, S. 183
25 Laaser, S. 185
26 Westenenk spricht von einem Fall der ,,terms of trade" von 20-25% ab 1974, Westenenk, S. 108. Die Preisexplosion beim Öl ließ den Anteil für Energieimporte an den Gesamtimporten von 11% (1973) auf 38% (1981) steigen. Bis 1989 fiel dieser Anteil wieder auf 17%, Ehrke, S. 264
27 Ehrke, S. 20, 21
28 Laaser, S. 191
29 Laaser, S. 163
30 Europartners, S. 7
31 So wurden 1980 bis 1984 zwei bis vier Mrd USD jährlich mehr in Spanien investiert als rausgeschafft, Laaser S. 203
32 Laaser, S. 203
33 Das durchschnittliche Alter des Industrie-Kapitalstocks stieg von 3,6 Jahren (1967) auf 4,8 Jahre (1982), Ehrke, S. 22
34 Ehrke, S. 251
35 Laaser, S. 162
36 Ehrke, S. 258
37 Die Verluste in der Handelsbilanz entwickelten sich von 7 Mrd USD (1974), über 12 Mrd USD (1980) zu 4 Mrd USD (1984), Ehrke, S. 265, Europartners, S.7
38 Europartners, S. 6
39 Das dürfte einem zeitversetzt eingetretenen Effekt des Investitionsbooms der 60er Jahre zu verdanken gewesen sein, K.K.
40 Laaser, S.170/171, eigene Berechnungen
41 von 10% in 1975 auf 6% in 1985, Laaser, S. 165
42 Laaser sieht darin einen gegenüber der Entwicklung anderer Industriestaaten sogar schnelleren, sozusagen aufholenden Strukturwandel und beruft sich darin auf ein ,,Normal- Entwicklungsmodell", das Donges in einer internationalen Querschnittsanalyse 1982 entwickelt hatte, Laaser, S. 193. Die Wachtumsraten der späten Achziger Jahre bestätigen diese Theorie: Während mitten im Boom die Landwirtschaft sogar schrumpfte, wuchs die Industrie schwächer (Lieberman, S. 341), der Dienstleistungssektor stärker als der Durchschnitt, Ehrke, S. 248/249
43 Laaser, S. 165
44 Laaser, S. 175
45 Europartners, S. 7
46 nach Ehrke, S. 114
47 DIHT, S. 5
48 Laaser, S. 188
49 Laaser, S. 198/199, Lieberman, S. 273
50 auch Lieberman, S. 273
51 Weidenfeld, S. 205 -208
52 Dürr, S. 113 f
53 Sundt, S. 75
54 Ehrke, S. 230
55 Weiler, S. 4
56 StBA 1998 und 1992
57 Ehrke, S. 232-234
58 Ziel: Steigerung der Forschungsausgaben von 0,7 auf 1% des BIP
59 Inwiefern Spanien auf dem wichtigen Gebiet der Mikroelektronik eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik seit Mitte der 90er betrieben hat, wäre hier zu untersuchen, was mangels Materials aber leider zu kurz kommen muß.
60 1970 wurden pro Kopf nur 7 USD für Forschung ausgegeben (BRD: 20 USD), weil man lieber Lizenzen von Technologien einkaufte als selber welche zu entwickeln, Herzog, S. 75
61 Ehrke, S. 234/235, Weiler, S. 4
62 unterentwickelte Agrarregionen sowie Industriezentren mit hoher Arbeitslosigkeit
63 Weiler, S. 5
64 Inwieweit die geringe Abgabenbelastung private Investitionen animiert hat, wäre im Einzelfall zu untersuchen
65 StBA 1998
66 Sundt, S. 104 ff
67 1990: 59% (EG 67%), StBA 1998
68 StBA 1992
69 Laaser, S.191
70 Insbesondere die Bauwirtschaft verzeichnete aufgrund privater wie staatlicher Investitionen traumhafte Wachtumsraten, in 1987 und 88 jeweils 10%, 1989 13%, Ehrke, S. 248
71 StBA 1998, eigene Berechnungen, Lieberman, S. 345
72 Laaser, S. 163
73 Ehrke, S. 258
74 Inflation in 1985 8% (EG 6%), in 1990 6% (EG 4%), Laaser, S. 162
75 Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen von 2 Mrd USD (1985) auf 10 Mrd USD (1989). Das positive Saldo bei langfristigen Kapitalanlagen explodierte von 9 Mrd USD in 1987 auf 32 Mrd USD in 1991, Laaser, S. 203
76 Ehrke, S. 251, Lieberman, S. 346
77 Laaser, S. 162
78 Laaser, S. 201
79 Laaser, S. 162
80 Ehrke, S. 260
81 Ehrke, S. 259
82 Ehrke, S. 249 und 262
83 StBA 1992
84 Ehrke, S. 252
85 Führte Spanien 1986 noch Waren im Wert von 36 Mrd ECU ein, verdoppelte sich diese Zahl bis 1992, StBA 1998
86 Das seit 1985 zu beobachtende Stagnieren der Bettenkapazitäten im Tourismusgewerbe könnte darauf hindeuten, dass in dieser für die Dienstleistungsbilanz wichtigen Branche das vorläufige Ende des Wachstums gekommen ist, StBA 1998
87 StBA 1998
88 Zahlen jeweils vom StBA 1992 und eigenen Berechnungen daraus
89 StBA 1998, eigene Berechnungen
90 Seit 1997 allerdings wächst das spanische BIP mit 3-4 % wieder etwas schneller als im EU-Durchschnitt, Schömann, S. 36, Meldungen in diversenTageszeitungen von 1999
91 StBA 1998
92 Laaser, S. 162, StBA 1998, Schömann, S. 37
93 Schömann, S. 36
94 Nach Kritik selbst der OECD an diesem Zustand hat die EU-Kommission, nach Absprache mit den Verbänden, eine Richtlinie zur Bekämpfung willkürlicher Befristung erlassen, Schömann, S 37.
95 StBA 1998, eigene Berechnungen
96 StBA 1998, eigene Berechnungen
97 vgl. Dürr, S. 148 ff
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Analyse der spanischen Wirtschaft im Kontext der EG/EU-Integration?
Diese Arbeit untersucht die Wirtschaftspolitik der demokratisch gewählten spanischen Regierungen vor und während der EG-Integration. Es wird analysiert, welche Phasen ökonomischer Entwicklung Spanien während dieses Prozesses durchlaufen hat, wobei eine Verknüpfung zwischen politischem Handeln und wirtschaftlichen Folgen angestrebt wird.
Welche zeitlichen Epochen werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse ist chronologisch aufgebaut und betrachtet die spanische EG-Annäherung in zwei Epochen: 1975-1985 (vor dem EG-Beitritt) und 1986-1996 (nach dem EG-Beitritt). Diese Epochen unterscheiden sich sowohl politisch als auch ökonomisch.
Welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen wurden in Vorbereitung auf den EG-Beitritt ergriffen?
Die spanischen Regierungen begannen, die Wirtschaft in Richtung EG-Kompatibilität umzustrukturieren. Dazu gehörten die Liberalisierung der Zinsen, die Aufhebung von Marktzutrittsbeschränkungen für ausländische Banken, die Reform des Rechtswesens, die Verabschiedung einer marktwirtschaftlichen Verfassung und der Abbau von Zöllen gegenüber der EG.
Wie war die wirtschaftliche Entwicklung Spaniens im Zeitraum 1975-1985?
Die spanische Wirtschaft befand sich in einer schwierigen Phase, die von den Ölkrisen und Strukturkrisen geprägt war. Das BIP wuchs langsamer als in der EG, die Inflation war hoch, und die Investitionen nahmen ab. Die Arbeitslosigkeit stieg stark an.
Welche Regelungen umfasste der EG-Beitritt Spaniens?
Der EG-Beitritt umfasste den schrittweisen Abbau von Zöllen, die Aufhebung von Importkontingentierungen und Exportsubventionierungen, die Übernahme der EG-Außenzölle, die Einführung des freien Kapitalverkehrs, die Einführung der Mehrwertsteuer, die Übernahme der Regelungen von EG-Agrarmarkt und Montan-Union sowie die Unterwerfung unter die EG-Fischfang-Quoten.
Welche Wirtschaftspolitik wurde nach dem EG-Beitritt verfolgt?
Die spanische Regierung versuchte, die Marktmacht, Umstrukturierung und Modernisierung der heimischen Industrie zu unterstützen, sah sich dabei aber den Restriktionen gegenüber, die die EG-Regeln solchen staatlichen Hilfen auferlegen. Staatliche Investitionsprogramme wurden gestartet um bestehende Mängel in der Infrastruktur auszubügeln. Die Politik der Angebotsorientierung wurde mit dem Ziel verfolgt, die Investitionsbedingungen zu verbessern.
Wie war die wirtschaftliche Entwicklung Spaniens im Zeitraum 1986-1990?
Der EG-Beitritt löste einen wirtschaftlichen Boom aus. Das BIP wuchs stark, die ausländischen Investitionen nahmen zu, die Beschäftigung stieg, und die Arbeitslosigkeit sank. Allerdings nahm auch das Handelsdefizit zu.
Wie gestaltete sich die wirtschaftliche Normalisierung Spaniens im Zeitraum 1990-1996?
Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, und die Arbeitslosenquote stieg wieder an. Die Verteilung des Volkseinkommens änderte sich zu Ungunsten der Lohnabhängigen. Allerdings erholte sich die Leistungsbilanz, und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Spaniens nahm zu.
Welche Rolle spielte die EG/EU für die spanische Wirtschaft?
Die EG/EU spielte eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung Spaniens. Der EG-Beitritt ermöglichte den Zugang zum europäischen Binnenmarkt, förderte die wirtschaftliche Umstrukturierung und zog ausländische Investitionen an.
Welche Hauptprobleme der spanischen Wirtschaft blieben bestehen?
Trotz der positiven Entwicklung blieben einige Probleme bestehen, darunter die hohe Arbeitslosigkeit, ein chronisch defizitäre Handelsbilanz (gerade im industriellen Bereich) sowie die gegenüber dem EU- Durchschnitt stärkere Tendenz zu Inflation. Hinzu kommen die starken regionalen Disparitäten in der Entwicklung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Spaniens ökonomische Entwicklung im Zuge seines EG-Beitritts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99131